
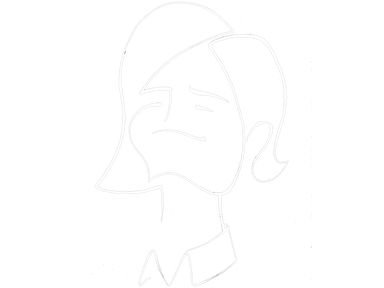
Die bürgerlichen Juso
Erneut steht eine Volksinitiative an, die mit einer Steuerreform die Ungleichheit verringern will. Es dürfte nicht die letzte sein. Denn wir haben ein Problem.
Von Daniel Binswanger, 04.09.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Es sieht aktuell nicht so aus, als hätte die 99-Prozent-Initiative grosse Chancen, angenommen zu werden. Dennoch sind die rund 45 Prozent Zustimmung, die sie in den ersten Umfragewellen erreichte, ein verblüffender Achtungserfolg: Einer Juso-Initiative mit Occupy-Wallstreet-Anklängen, die sehr offen (und interpretationsbedürftig) formuliert ist und zu einer radikalen Reform der Schweizer Steuersystematik führen würde, gelingt es mindestens in einer ersten Phase des Abstimmungskampfs, knapp mehrheitsfähig zu werden. Und das im reichsten Land der Welt!
Steht ein fieses sozialistisches Virus ganz kurz vor dem pandemischen Ausbruch? Erobert «Seuchen-Sozialismus» nun tatsächlich die Köpfe? Oder ist die Resonanz der 99-Prozent-Initiative ganz einfach ein Zeichen dafür, dass etwas Grundsätzliches allmählich aus dem Lot gerät?
Die Grundansage der Vorlage ist simpel: Entlastet Arbeitseinkommen, belastet Kapitaleinkommen! Natürlich zielt die angestrebte Verfassungsänderung auf eine höhere Belastung der Reichtumselite ab, aber die Einkommenshöhe ist dabei eigentlich nur der sekundäre Gesichtspunkt. Im Zentrum steht explizit die Einkommensart, auch wenn noch zu definierende Freibeträge sicherstellen sollen, dass wirklich nur das oberste Prozent zur Kasse gebeten wird.
Steuersystematisch ist das problematisch, politisch jedoch klug. Es ist eigentlich kein linkes, sondern ein zutiefst bürgerliches Anliegen, das die Jungsozialisten hier vertreten: die Valorisierung von Fleiss und Arbeit, die meritokratische Belohnung von Leistung. Können sich «wirtschaftsnahe» Parteien allen Ernstes gegen eine solche Agenda wenden?
Im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2007 präsentierte sich der stramm rechte Nicolas Sarkozy als der Vertreter des «Frankreichs, das früh aufsteht». Im jetzigen Abstimmungskampf führt Cédric Wermuth diese Rede. Die Partei der Arbeiter tritt auf als die Partei des Arbeitsethos – und müsste damit eigentlich auch ein Wählersegment mit prononciert bürgerlichen Werten erreichen.
Die 99-Prozent-Initiative ist ein weiteres Symptom, dass die zunehmende Ungleichheit nicht immer weiter ignoriert werden kann, auch nicht in der Schweiz. Die Juso-Vorlage mag scheitern. Das Thema ist damit aber nicht vom Tisch.
Die in der Schweiz traditionell sehr grossen Vermögensunterschiede haben sich auch in der Corona-Zeit noch einmal deutlich verstärkt und nagen am gesellschaftlichen Selbstverständnis. Obwohl das Wirtschaftswachstum pandemiebedingt sehr schlecht war: Die Reichen werden immer reicher – und alle anderen kaum. Die soziale Mobilität nimmt ab, die Reichtumseliten ziehen davon. Wer nicht schon über Vermögen verfügt, hat es zunehmend schwer, zu grossem Wohlstand zu kommen.
Die Forderung nach höherer Kapitalbesteuerung muss deshalb gar nicht mehr im Namen von sozialer Solidarität erhoben werden. Sie wird zur Forderung einer ehrgeizigen, gut gebildeten Mittelschicht, die den Weg nach oben mehr und mehr versperrt sieht. Können bürgerliche Parteien wirklich wollen, dass diese Entwicklung vom Steuersystem nicht abgefedert, sondern gefördert wird?
Die Schweiz ist ein interessantes Experimentierfeld für politische Verschiebungen, die rund um den Globus virulent werden. Die helvetische Besonderheit liegt darin, dass die Einkommensverteilung immer noch erfreulich ausgeglichen und stabil ist. Zudem ist das generelle Einkommensniveau sehr hoch, der soziale Druck, der durch Massenarmut entsteht, spielt deshalb kaum eine Rolle. All dies müsste einschneidende Umverteilungsprojekte eigentlich völlig chancenlos werden lassen.
Wir beobachten jedoch etwas anderes, und das hat seine Gründe: Die Vermögensverteilung ist extrem ungleich in der Schweiz – und prägt immer mehr das gesellschaftliche Leben. Zum Beispiel, weil sich ein immer grösserer Teil der Mittelschicht kein Eigenheim mehr leisten kann, da die Preise durch die Decke gehen und die Tragbarkeitserfordernisse rigoroser werden. Oder weil die Privatisierung des Bildungsmarkts voranschreitet – und zugleich nur den obersten Einkommen offensteht. Die immer stärkere Vermögenskonzentration setzt soziale Standards und führt zu Verdrängungseffekten. Zur Seefeldisierung des gesellschaftlichen Lebens.
Auch wenn die Einkommensverteilung relativ ausgeglichen bleibt, modifiziert sich das gesamtgesellschaftliche Gleichgewicht. Soll die Anlagegüterinflation einfach immer noch weiter gehen? Soll die Vermögensungleichheit immer weiter in den Himmel schiessen? Vermutlich wird es für die Tragbarkeit dieser Entwicklung irgendwo eine Grenze geben.
In jüngerer Zeit liegt das zentrale Problem darin, dass die expansive Geldpolitik, welche zum hauptsächlichen Mittel geworden ist, mit dem die Staaten auf Wirtschaftskrisen reagieren, ein noch nie da gewesenes Umverteilungsprogramm zugunsten der Reichtumseliten darstellt. Es sieht nicht danach aus, als würde diese Politik sich in absehbarer Zeit verändern. Die sagenhafte Wertsteigerung von Anlageobjekten – insbesondere Immobilien und Aktien – macht nur jenen Teil der Bevölkerung reicher, der bereits Immobilien und Aktien besitzt, an der grossen Mehrheit der Bürgerinnen zieht sie jedoch vorbei. Solange die Geldschleusen der Zentralbanken weiter offenstehen, werden die Reichtumseliten der übrigen Gesellschaft immer weiter davonziehen. Es sei denn, die Staaten holen sich wenigstens einen Teil der Vermögensgewinne zurück.
Als Hauptargument gegen eine Kapitalgewinnsteuer muss auch in der aktuellen Debatte die Vermögenssteuer hinhalten. Es ist richtig, dass die Schweiz eines der wenigen Länder ist, die noch eine Vermögenssteuer kennen – also eine Steuer auf dem Vermögensbestand und nicht auf dem Vermögensgewinn –, und dass dieser Umstand bis zu einem gewissen Grad die Tatsache kompensiert, dass Kapitalgewinne nur reduziert oder gar nicht besteuert werden. Die Einnahmen aus der Vermögenssteuer sind relativ substanziell und belaufen sich auf etwas über 1 Prozent des BIP. Trotzdem fällt der internationale Vergleich nicht zugunsten der Schweiz aus.
Nehmen wir die USA, ein Land mit vergleichbar ungleicher Vermögensverteilung. Die Vereinigten Staaten kennen keine Vermögenssteuer, dafür aber eine Kapitalgewinnsteuer, deren Einnahmen sich ebenfalls auf etwa 1 Prozent des BIP belaufen – im Volumen also etwa vergleichbar sind mit der Schweizer Vermögenssteuer. Allerdings: Die USA kennen zusätzlich noch die Steuer auf Erbschaften über 5 Millionen. Der Fiskus geht also insgesamt aggressiver um mit den grossen Vermögen.
Entscheidend ist jedoch ohnehin die diachrone Entwicklung: Auch die USA erleben eine immer stärkere Konzentration der Grossvermögen am obersten Ende der Verteilung. Nicht umsonst wird die Forderung nach einer wealth tax laut, die das immer schnellere Wachstum des Superreichtums bremsen soll. Exakt dieselbe Debatte ist auch in der Schweiz unausweichlich geworden: Ja, die Schweizer Vermögenssteuern sind vergleichsweise hoch, aber sie sind nicht hoch genug. Sie verhindern nicht, dass die grössten Vermögen weiterhin überproportional anwachsen.
Wollen wir eine bürgerliche Gesellschaft bleiben, die auf dem Fundament von Leistung, Bildung und Arbeit ruht? Oder akzeptieren wir die Entkopplung einer neuen Oligarchie, für welche eine Mittelschicht, die mit hohen Krankenkassenprämien, immer höheren Mieten und teuren Krippenplätzen kämpft, nur noch die nötigen Dienstleistungen erbringt – mit schwindender Aussicht, die Seiten zu wechseln?
Bürgerliche Gesellschaften sind Mittelschichtsgesellschaften. Es gibt keinen einzigen guten Grund, weshalb unser Fiskalsystem den Superreichtum fördern sollte: Er dient weder der wirtschaftlichen Produktivität noch der politischen Stabilität noch der gesellschaftlichen Integration. Was die Wirtschaftsentwicklung dieses Landes braucht, ist nicht verstärkte Kapitalkonzentration am obersten Ende, sondern gute Bildungsinstitutionen und eine vernünftige Verteilung der Kaufkraft.
Was ist ein zeitgemässer Begriff von Bürgerlichkeit? Das ist vielleicht die eigentliche Frage, die wir mit der 99-Prozent-Initiative verhandeln. Die sogenannten bürgerlichen Parteien haben dazu enttäuschend wenig zu sagen. Was für eine Ironie, dass diese Debatte inzwischen von den Juso angeschoben wird.
Illustration: Alex Solman