
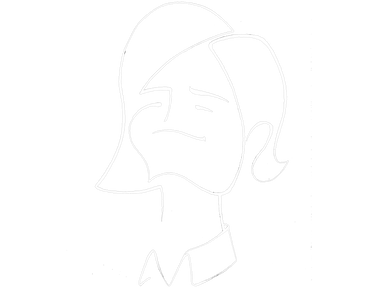
Die grosse Desintegration
Das Scheitern des Rahmenabkommens wird erst allmählich spürbar werden. Unmittelbar evident wird bloss die Schweizer Handlungsunfähigkeit.
Von Daniel Binswanger, 29.05.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Wir sind ein Land ohne Plan. Das ist die Einsicht, die am Mittwoch wie ein Komet ins öffentliche Bewusstsein einschlug. Eigentlich ist es erstaunlich, dass der Schock, den der definitive Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen ausgelöst hat, so heftig war. Schon seit Monaten ist schliesslich klar, dass Brüssel auf Nachverhandlungen nicht eintreten wird und dass in der Schweiz der nötige Parteienkonsens nicht gegeben ist, um den vorliegenden Vertragsentwurf zu paraphieren.
Trotzdem hat die bundesrätliche Pressekonferenz vom Mittwoch die Nation sehr unsanft aus dem Schlummer ihrer Selbstgefälligkeit gerissen: Es gibt keinen Plan B, keine weiterführende europapolitische Perspektive, keine einzige vernünftige Begründung, weshalb die Eidgenossenschaft sich selber auf hundert jahrelangen Umwegen in diese Sackgasse führen musste. Ausser Spesen nichts gewesen – nur eine desavouierte Landesregierung, verschlissene Verhandlungsführer und grosser Schaden für die Beziehungen zu Brüssel.
Warum haben die Bundesräte Schneider-Ammann und Cassis im Sommer 2018 die Gewerkschaften im Regen stehen lassen und entgegen dem Verhandlungsmandat die roten Linien des Lohnschutzes aufgegeben? Haben sie geglaubt, man würde die Linke schon noch ins Boot holen können, wenn man sie nur brutal genug vor vollendete Tatsachen stellt? Warum hat der Bundesrat im Dezember 2018 einen Vertragsentwurf akzeptiert und die Verhandlungen für abgeschlossen erklärt, obwohl er ebendiesen Vertragsentwurf dann nicht paraphieren wollte, sondern in eine innenpolitische Konsultation schickte? War man sich nicht bewusst, dass einem dann für Nachjustierungen kaum mehr Spielraum bleiben wird?
In einem normal regierten Land wird erst innenpolitisch die eigene Position ausgehandelt und dann versucht, diese aussenpolitisch durchzubringen. Der Bundesrat hingegen hat erst aussenpolitische Fakten geschaffen und dann innenpolitisch versucht, den passenden Konsens dazu zu zimmern. Oder besser: Er hat es nicht einmal versucht. An die Mehrheitsfähigkeit des von ihm selber verhandelten Abkommens mochte er schon gar nicht mehr glauben. Mehr Inkohärenz geht kaum. Nicht einmal die Regierung wusste, was sie eigentlich will.
In manchen Kommentaren wurde der letzte Mittwoch mit dem «schwarzen Sonntag» verglichen, der EWR-Niederlage im Jahr 1992. Das ist nicht die instruktive historische Parallele. Eher schon sollten wir uns an den 21. Mai 2000 erinnern, an den Tag, an dem die Bilateralen I inklusive flankierender Massnahmen im Anschluss an die Parlamentsdebatten vom Herbst 1999 von der Stimmbevölkerung gutgeheissen wurden.
Damals wurden die Voraussetzungen geschaffen für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Schweizer Wirtschaft erholte sich von der schweren Krise der Neunzigerjahre, das Wachstum entwickelte sich ausgezeichnet, und die Lohnverteilung blieb – im Gegensatz zum gesamten europäischen Umland – erstaunlich ausgeglichen. Jetzt wäre es darum gegangen, diese Erfolgsgeschichte zu sichern. Warum schaffen wir nicht mehr, was Ende der Neunziger noch möglich war?
Zitieren wir, um zu verstehen, was die Schweiz von 2021 von der Schweiz von 1999 trennt, einfach eines der grossen Schwergewichte der damaligen Politik: «Es ist wichtig, dass wir uns bei den flankierenden Massnahmen zusammenraufen, denn nach wie vor gilt das Wort: Einigkeit macht stark» (zitiert nach der NZZ vom 31. August 1999). Das sagte damals Ernst Mühlemann, führender FDP-Politiker und gemäss seinem geläufigen Übernamen der «Schattenaussenminister» der Schweiz.
Man mag es heute kaum mehr glauben, aber Sie haben richtig gelesen: So redeten damals freisinnige Politiker. Wäre jemals in irgendeiner Phase der Verhandlungen über das Rahmenabkommen von der heutigen FDP etwas Vergleichbares zu hören gewesen? Einigkeit macht stark? Wir müssen uns bei den Flankierenden zusammenraufen? Diese Tonlage ist aus dem bürgerlichen Diskurs verschwunden.
Die SP bezieht nun schwere Prügel für ihren «gewerkschaftlichen Linksnationalismus», und gänzlich unberechtigt sind diese Tiraden nicht. Die Linke hat sehr deutlich gesagt, was sie nicht akzeptiert – eine Schwächung der flankierenden Massnahmen (FlaM) –, aber sie hat wenig dazu gesagt, wie eine europakompatible Gewährleistung des Lohnschutzes aus ihrer Perspektive dennoch möglich sein könnte. Die gewerkschaftliche Besorgnis, die FlaM könnten durch das Rahmenabkommen ausgehöhlt werden, ist vollkommen berechtigt und hat mit den blödsinnigen Debatten um die 8-Tage-Regel nur wenig zu tun. Allerdings trifft es natürlich auch nicht zu, dass jedes Mitspracherecht des Europäischen Gerichtshofes die Schweizer Lohnstruktur sofort und irreversibel zerstören würde.
Wenn die Politik den Konsens gesucht hätte und alle Sozialpartner sich hätten einigen wollen, wäre ein Kompromiss zu finden gewesen.
Rein gar nichts beizutragen zu einem solchen Kompromiss wussten jedoch die bürgerlichen Parteien. Wo war das Vermittlungsangebot? Wo war der Versuch, sich zusammenzuraufen? Eine löbliche Ausnahme gibt es: Der aussenpolitische Thinktank Foraus hat entsprechende Konzeptpapiere produziert und versucht, eine gemeinsame Position der Sozialpartner zu erarbeiten. Aber das sollte nicht eine Aufgabe sein, die man einem Nachwuchs-Thinktank überlässt. Die Mitte, die FDP und die Wirtschaftsverbände hätten diese Rolle spielen müssen. Hätten.
Warum kann die sogenannte Willensnation einen gemeinsamen Willen nicht mehr aufbringen? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe: zum einen die Desintegration des Parteiensystems. Zum anderen die immer stärkere Polarisierung.
Die bürgerlichen Kräfte, die 1999 einen Kompromiss vermitteln konnten, das heisst die ehemalige CVP und die FDP, sind heute wesentlich schwächer. Die FDP muss akut um ihren zweiten Bundesratssitz fürchten, Die Mitte hat den ihren schon verloren, und es droht ihr eine immer noch stärkere Schrumpfung des Stimmenanteils in den traditionellen Stammlanden. Beide Parteien beurteilen den Wählerverlust an die SVP als die entscheidende strategische Gefahr. Beide Parteien ziehen daraus den Schluss, dass die Sicherung der rechten Flanke die oberste Priorität hat. Anstatt mit der Linken vernünftige Lohnschutzmassnahmen auszuhandeln, zeigen sie sich deshalb unerbittlich bei der Unionsbürgerrichtlinie. Anstatt das Rahmenabkommen aus wirtschaftlichem Pragmatismus zu retten, eröffnen sie eine zweite Front, um es definitiv zum Scheitern zu bringen.
Die Desintegration des traditionellen Parteiensystems manifestiert sich auch im Aufstieg der Grünliberalen. Sie sind die einzige Kraft, die konsequent für die Ratifizierung des Abkommens eingestanden ist, und treten mehr und mehr an die Stelle des europafreundlichen FDP-Flügels. Aber um Brückenbauerin zu sein, ist die GLP zu klein. Im Gegenteil: Im Wahlkampfjahr 2019 hat die Partei voll auf Europa gesetzt und das Thema mit aller Macht zum Knüppel gemacht, mit dem auf die Linke eingeprügelt und ihr möglichst viele Wähler abspenstig gemacht werden sollten.
Einmal abgesehen davon, dass das ein grotesker strategischer Fehler war, weil 2019 ausschliesslich das Öko-Thema zog und weil das substanziellste Wachstumsreservoir der GLP nicht in der linken, sondern in der bürgerlichen Wählerschaft liegt, verunmöglicht es sich die GLP auf diese Weise auch, eine neue Koalition der Vernunft anzuführen. Entweder man macht Wahlkampf, oder man stiftet Kompromisse. Als machtbewusste Kleinpartei hat die GLP sich für Ersteres entschieden.
Schliesslich und endlich: Die Schweiz ist heute noch einmal deutlich polarisierter als 1999. Schon damals bekämpfte die Zürcher SVP unter der Führerschaft von Christoph Blocher die Bilateralen, aber noch kontrollierte die Zürcher nicht die Schweizer SVP. Ein wackerer Parteipräsident namens Ueli Maurer tingelte unermüdlich durchs Land, um für die Bilateralen Stimmung zu machen. Heute scheint es Maurers intimster Wunsch zu sein, zum Totengräber seines eigenen Werks zu werden.
Der Himmel wird uns nicht auf den Kopf fallen, aber der Bilateralismus ist gefährdet und wird erodieren. Die tiefe Verstörung, die nun um sich greift, hat jedoch einen noch fundamentaleren Grund: Eine Willensnation, die keinen gemeinsamen Willen mehr hat, verliert ihre politische Identität. Der 26. Mai 2021 dürfte deshalb in der Tat ein Tag für die Geschichtsbücher sein. Nicht nur in aussenpolitischer Hinsicht.
Illustration: Alex Solman