
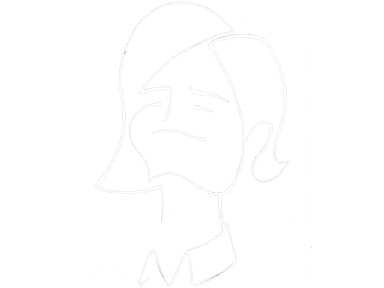
Nicht Brüssel ist das Problem
Das Scheitern des Rahmenvertrags mit der EU zeichnet sich ab. Es gäbe Lösungen. Die müsste man hierzulande aber wollen.
Von Daniel Binswanger, 24.04.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Am Ende wird es nur Verlierer geben – die kurz angebundene gestrige Medienkonferenz des Schweizer Bundespräsidenten war jedenfalls nicht dazu geeignet, diesen Eindruck zu zerstreuen. Nicht deshalb, weil die Schweiz darauf angewiesen wäre, das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU zwingend abzuschliessen. Auch nicht deshalb, weil es für die Schweizer Wirtschaft ohne eine Neuregelung des bilateralen Wegs keine Perspektiven mehr gibt. Sondern deshalb, weil das voraussichtliche Scheitern der sich seit sieben Jahren hinschleppenden Verhandlungen eine schwere politische Niederlage darstellen würde, die wir zuallererst uns selber zuzuschreiben hätten.
Es wäre eine Niederlage für die Schweizer Linke, die es nicht geschafft hat, das Ziel einer verstärkten europäischen Integration mit der Garantie eines starken Schweizer Lohnschutzes zu vereinen. Es wäre eine Niederlage für die FDP und die Mitte, welche beide zutiefst gespalten sind, genauso wie die Wirtschaftsverbände, die ebenfalls in feindliche Lager zerfallen. Es wäre schliesslich eine Niederlage für die bürgerlichen Progressiven – die Grünliberalen, die Liberos.
Triumphieren kann die SVP. Was sie aus eigener Kraft seit der Masseneinwanderungsinitiative nicht mehr geschafft hat – die nachhaltige Beschädigung des Schweizer Verhältnisses zur EU –, wird ihr nun quasi frei Haus geliefert.
Kann man der Linken vorwerfen, dass sie dazu übergegangen ist, das Rahmenabkommen in seiner heutigen Form zu bekämpfen? Nein. Die Stabilität des Lohngefüges, die positive Entwicklung des Niedriglohnsektors – und das in Verbindung mit einer guten Wirtschaftsentwicklung – sind die vielleicht grössten politischen Errungenschaften der Schweiz seit der Jahrtausendwende. Die Einkommensverteilung ist nicht irgendein Parameter unter vielen anderen, für den allenfalls engagierte Sozialpolitikerinnen eine besondere Leidenschaft entwickeln sollten. Sie ist der alles dominierende Faktor für das volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichgewicht.
Die Schweiz schneidet in dieser Hinsicht wesentlich besser ab als das gesamte europäische Umfeld. In Grossbritannien waren stagnierende Niedriglöhne in Verbindung mit starker Zuwanderung ein Hauptgrund für den Brexit. In Deutschland ging das exportgetriebene Wachstum einher mit einer massiven Zunahme des Niedriglohnsektors – und einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust der traditionellen Volksparteien. In Frankreich stagnierten unter dem deutschen Druck sowohl das Wachstum als auch die Lohnentwicklung – und Marine Le Pen hat gemäss den aktuellen Umfragen inzwischen eine realistische Chance, die nächste Präsidentin zu werden.
Die Schweiz hingegen verdankt ihrer Einkommensverteilung, die entscheidend durch die flankierenden Massnahmen (Flam) geprägt wird, einen Ausgleich, der auch den bürgerlichen Parteien am Herzen liegen sollte. Haben die progressiven helvetischen Europafreunde auf dem Schirm, was heute in diesem Land politisch los sein könnte, wenn wir die letzten zwanzig Jahre eine «europäische» Lohnentwicklung gehabt hätten?
Heftig umstritten ist allerdings, wie weit das neue Rahmenabkommen – und der durch dieses in die Überwachung der Verträge eingebundene Europäische Gerichtshof – die flankierenden Massnahmen tatsächlich bedrohen würde. Es ist richtig, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich sich heute stark bemühen, die Entsendung von Arbeitskräften auf ihr Territorium strikter zu regulieren. Es gibt im Übrigen eine ganze Reihe von Initiativen, um die Durchsetzbarkeit von Lohnschutzmassnahmen im EU-Raum zu verbessern, etwa die sogenannte Durchsetzungsrichtlinie.
Doch auch jüngere Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus den Jahren 2018 und 2019 setzen österreichische Lohnschutzmassnahmen ausser Kraft und geben der Dienstleistungsfreiheit den Vorrang. Auch die Befürchtung der Gewerkschaften, der EuGH könnte das gesamte Schweizer System der Lohnschutz-Überwachung durch die (nicht staatlichen) sogenannten paritätischen Kommissionen torpedieren und die sehr häufige Kontrolle ausländischer Firmen als diskriminierend betrachten, ist nicht einfach von der Hand zu weisen. Der Lohnschutz in der EU ist Stand heute weiterhin viel schlechter als in der Schweiz. Auch wenn er sich weiter verbessern dürfte, bleibt offen, wie weit die Veränderung tatsächlich gehen wird.
Allerdings liegt hier gar nicht das eigentliche Problem. Schliesslich wäre die Schweiz ja selbst dann, wenn der EuGH ihre aktuellen flankierenden Massnahmen für nicht vertragskonform erklären würde, nicht gezwungen, ihre Praxis zu ändern. Sie müsste lediglich gewärtigen, dass die EU bei Nichtrespektierung des Unionsrechts Ausgleichsmassnahmen ergreifen würde, wobei das vertraglich eingesetzte Schiedsgericht darüber zu wachen hätte, dass allfällige Retorsionen auch «verhältnismässig» bleiben. Der Schiedsgerichtsmechanismus, der den Preis für Sanktionen regelt, wann immer die Schweiz eine Regelung von der EU nicht übernehmen will, ist ja genau das, was den vorliegenden Rahmenvertrag für den schwächeren Partner so attraktiv macht. Jedoch nur unter einer Voraussetzung: Die Landesregierung müsste in einer entsprechenden Situation auch beschliessen, den Preis für die Nichterfüllung zu bezahlen.
Das führt uns zur politischen Kernfrage: Kann die SP der bürgerlich dominierten Landesregierung vertrauen, dass sie die flankierenden Massnahmen – oder äquivalente Lohnschutzbestimmungen – durch alle Böden verteidigen würde? Das ist, was wir hier verhandeln. Und leider lautet die Antwort: Nein.
Den grand bargain zwischen Links und Rechts, der es in den Neunzigerjahren erlaubt hat, die Schweiz aus der Stagnation und auf den extrem erfolgreichen bilateralen Weg zu führen, scheint es nicht mehr zu geben. Besonders dramatisch hat sich das gerade aus Anlass des Rahmenabkommens gezeigt: Es ist tatsächlich so, dass Ignazio Cassis und sein damaliger Unterhändler Roberto Balzaretti die «rote Linie» der Flankierenden preisgegeben haben und gar nicht mehr den Versuch machten, die Linke und die Bürgerlichen hinter einem gemeinsamen Verhandlungsziel zu einen. Wie soll die Linke darauf vertrauen, dass die Landesregierung auch unter widrigen Umständen die Flam verteidigen wird, wenn der Lohnschutz seine Unverhandelbarkeit verliert, bevor das Rahmenabkommen überhaupt in Kraft ist?
Wenn verbindlicher Konsens darüber bestünde, was die Schweiz eigentlich will, könnte die Linke der Herausforderung durch den Europäischen Gerichtshof gelassen entgegenschauen. Doch dieser Konsens existiert nicht mehr. Die Koalition der Vernunft ist Geschichte.
Das Einvernehmen mit der EU scheitert an der innenpolitischen Dynamik, das zeigt auch die Spaltung des bürgerlichen Lagers. Ohne die Sozialdemokraten ist der Rahmenvertrag nicht zustimmungsfähig, ohne Freisinn und Christdemokraten ebenfalls nicht. Auch sie sind für das Abkommen bekanntlich in der Mehrheit nicht zu haben.
Hier ist der Hauptgrund die sogenannte Unionsbürgerschaft, zu welcher der Rahmenvertrag das Tor öffnen könnte. Selbst Economiesuisse würde das Abkommen ohne Garantien gegen die Einführung der vollen Unionsbürgerschaft nicht unterschreiben wollen. Es wird befürchtet, dass die Unionsbürgerschaft zu einer «Zuwanderung in die Sozialsysteme» führt.
Nur schon, dass dieser Kampfbegriff sich durchgesetzt hat, beweist, dass es hier nicht um ökonomische, sondern um politische Bedenken geht. Es würde sicherlich zu einer stärkeren Belastung der Schweizer Sozialwerke durch nicht arbeitstätige, vor kurzem zugewanderte EU-Bürger kommen, aber die Kosten blieben sehr überschaubar. Avenir Suisse hat eine Rechnung gemacht, die bei konstanter Zuwanderung auf relativ bescheidene 75 Millionen Franken kommt pro Jahr – im allerschlechtesten Fall. Selbst wenn man dann zusätzlich noch davon ausginge, dass ein Sogeffekt entstehen könnte – wofür die historischen Erfahrungen keinen Anlass geben –, selbst wenn man damit rechnete, dass sich die Zahl dieser Sozialhilfeempfänger verdoppelt oder verdreifacht, blieben die absoluten Kosten problemlos tragbar.
Hier geht es nicht um einen fundamentalen Eingriff in den Schweizer Sozialstaat, sondern um die symbolische Sprengkraft dieser Zuwanderung. Offenbar wollen es sich weder die FDP noch die Mitte politisch leisten, dafür Hand zu bieten – schon gar nicht mit einem Abkommen, über das im Wahljahr 2023 ein Referendum stattfinden würde. Wenn die bürgerliche Mitte jedoch permanent damit beschäftigt ist, ihre rechte Flanke gegen die SVP abzusichern, ist eine Koalition der Vernunft erst recht nicht möglich.
Das zeigt sich auch an dem quasi post festum plötzlich wieder auferstandenen Souveränitätsargument, das ausgerechnet von Ex-Bundesrat Johann Schneider-Ammann lanciert wurde und im Wirtschaftsestablishment nun weite Kreise zieht. Dass es EU-Binnenmarkt-Abkommen ohne dynamische Rechtsentwicklung nicht mehr geben wird, ist jedoch klar. Dass die Schweiz mit dem vorgeschlagenen Schiedsgerichtsmodell im Hinblick auf die Rechtsübernahme sehr gut fährt, ist ebenfalls nicht in Abrede zu stellen. Wenn jetzt selbst die FDP-Spitzen beginnen, die vermeintliche Verteidigung der helvetischen Souveränität zum obersten Imperativ zu erklären, wird europapolitisch rein gar nichts mehr möglich sein.
Wir sind in einer extrem ungemütlichen Lage, vielleicht an einer historischen Weggabelung. Das Rahmenabkommen dürfte trotz des bundesrätlichen Rettungsversuchs gescheitert sein, ein überzeugender Plan B existiert nicht. Die Paralyse wird voraussichtlich keine unmittelbaren dramatischen Konsequenzen haben, aber dass sich auf dieser Basis die grosse Erfolgsgeschichte des Bilateralismus nicht lange fortschreiben lässt, steht ausser Zweifel. Unser Problem ist nicht die EU. Unser Problem sind wir selber. Und das ist sehr viel bedrohlicher.
Illustration: Alex Solman