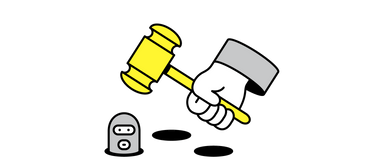
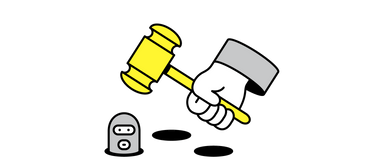
«Was ist wichtiger: Frieden oder Gerechtigkeit?»
Der Internationale Strafgerichtshof hat soeben zwei Verfahren gegen Angeklagte aus Afrika abgeschlossen. Einmal mehr wurde nur ein «kleiner Fisch» verurteilt. Anni Pues, Expertin für internationales Strafrecht, über eine umstrittene Instanz, die nur so gut sein kann wie die Welt um sie herum.
Ein Interview von Susi Stühlinger, 14.04.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) rückt wieder einmal in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Anfang April entschied die neue US-Regierung, die von Donald Trump verhängten Sanktionen gegen das ICC-Personal aufzuheben. Das betrifft etwa die Einreisesperre gegen die gambische Juristin und abtretende Chefanklägerin Fatou Bensouda.
Bensouda hinterlässt ein beachtliches Vermächtnis, darunter Ermittlungen zu allfälligen Kriegsverbrechen der US-Armee in Afghanistan und die Untersuchung von Vorfällen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten. In dieser Angelegenheit hat die fürs Vorverfahren zuständige Abteilung festgehalten: Trotz dem umstrittenen völkerrechtlichen Status Palästinas hat das Gericht die Befugnis, in der Sache zu urteilen.
Überdies fällte das Gericht in Den Haag soeben zwei endgültige Entscheide in langjährigen Verfahren. Es bestätigte die von der Vorinstanz ausgefällte Freiheitsstrafe gegen Bosco Ntaganda: Der stellvertretende Anführer einer Miliztruppe im Kongo wurde unter anderem wegen Mord, Vergewaltigung, sexueller Sklaverei und Rekrutierung von Kindersoldaten im zweiten Kongokrieg 1998–2003 verurteilt. Freigesprochen wurde hingegen der frühere ivorische Staatspräsident Laurent Gbagbo. Ihm waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bürgerkriegs 2010/2011 vorgeworfen worden. 2011 hatte die Elfenbeinküste ihn an den ICC ausgeliefert. Er war der erste ehemalige Staatspräsident, dem in Den Haag der Prozess gemacht wurde.
Anni Pues ist Expertin für internationales Strafrecht und Strafverteidigerin, mitunter auch vor dem ICC. Sie lehrt und forscht an der Universität Glasgow und ordnet im Gespräch mit der Republik die jüngsten Entscheide und die Arbeitsweise des Gerichtshofs ein.
Ort: Den Haag
Zeit: 30. und 31. März 2021
Fall-Nr.: ICC-01/04-2/06 und ICC-02/11-01/15
Thema: Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Frau Pues, der ivorische Ex-Präsident Laurent Gbagbo wurde von der Beschwerdeinstanz des Gerichtshofs endgültig freigesprochen. Kam das überraschend?
Nicht wirklich. Doch wenn ein Verfahren, das sich so lange hinzieht, am Schluss mit einem Freispruch endet, ist das natürlich aus der Sicht der Chefanklägerin eine Wahnsinnskatastrophe.
Aber aus Ihrer Sicht ist das Urteil richtig?
Als Strafverteidigerin muss ich sagen: Ja, auch wenn es einem vielleicht nicht schmecken mag. Individuelle Verantwortlichkeit braucht auch im internationalen Strafrecht eine ausreichende Beweislage. Sicherlich sind von der Regierung rund um Laurent Gbagbo Verbrechen begangen worden; ebenso wie von der Gegenseite. Aber die Beweise reichten schlicht nicht aus. Dass in dieser Situation ein Freispruch erfolgt, zeigt doch, dass der Internationale Strafgerichtshof in der Lage ist, zu funktionieren und Verfahren zu führen, die eben nicht immer nur zuungunsten der Angeklagten enden. Dies trotz der langen Untersuchungshaft, die den Druck auf die Gerichtsbarkeit erhöht, eine Verurteilung abzuliefern – vor allem, wenn die ganze Weltöffentlichkeit zuschaut.
Eine Kritik am ICC lautet: Die «grossen Fische», ehemalige Staatschefs wie Laurent Gbagbo, kommen ungeschoren davon. Verurteilungen treffen zumeist eher «kleine Fische» wie Bosco Ntaganda, der als Kommandant einer Miliz im Kongo Kriegsverbrechen begangen hat.
Ja, das ist so. Laurent Gbagbo ist jetzt freigesprochen worden, weil er, so kann man es zynisch sagen, vermutlich vom Geschehen weiter entfernt war. Je höher die Position, desto weniger machen sich die Täter in der Regel die Hände schmutzig. Die Fähigkeit des Gerichtshofs, nichtstaatliche Akteure wie Rebellen oder Milizen zur Rechenschaft zu ziehen, ist sicher grösser. Aber das liegt nicht nur am Gerichtshof, sondern ist Ausdruck eines grösseren, strukturellen Problems.
Erklären Sie.
Das internationale Strafrecht hat einfach nicht die Zähne, nicht die Möglichkeiten zur Durchsetzung des Rechts, wie es sie auf nationaler Ebene gibt. Das liegt wiederum daran, dass internationales Recht immer von den individuellen Interessen einzelner staatlicher Akteure geleitet ist. Da ist ein logischer Bruch drin. Der Internationale Strafgerichtshof wird immer nur so gut sein, wie die Welt um ihn herum. Und solange die Staaten dieses grössere Projekt nur teilweise und häufig auch nur halbherzig unterstützen, solange sie nicht bereit sind, staatliche Gewalt einzugrenzen und Rechenschaft von staatlichen Akteuren auf individueller strafrechtlicher Ebene einzufordern, ist es schwierig, das Projekt ICC umzusetzen.
Vor dem Hintergrund von Freisprüchen prominenter Figuren wird argumentiert, der Gerichtshof sollte sich besser auf die überschaubaren, gewinnbaren Fälle konzentrieren statt auf die komplexen Gemengelagen, wo die Beweislage schwierig ist.
Das ist der falsche Weg. Ich denke, dass es eine Mischung braucht. Auf der einen Seite sollte sich die Anklage auf Verfahren konzentrieren, die Substanz haben und potenziell zu Verurteilungen führen. Andererseits muss internationale Strafgerichtsbarkeit mehr leisten können als nur die Verurteilung von vergleichsweise kleinen Fischen. Es ist notwendig, sich der schwierigen Fälle anzunehmen, um zu zeigen, dass die Justiz auch in solchen Fällen nicht verschwindet und die strafrechtliche Verantwortlichkeit bestehen bleibt. Die neueren Entwicklungen, die Ermittlungen in Afghanistan und Palästina, sind da beispielhaft. Einerseits kann man sich fragen: Wie kann eine internationale Strafgerichtsbarkeit mit derart komplexen Situationen überhaupt umgehen? Andererseits sind das gerade jene Situationen, wo sonst jeder wegschaut und wo es notwendig ist, hinzuschauen.
Also hat rein die Existenz dieser Verfahren, egal welchen Ausgang sie nehmen, einen Nutzen – wegen der Notwendigkeit, hinzuschauen?
Ich hoffe es. Das ist eine Dimension, die häufig unterschätzt wird. Ich glaube, dass der Internationale Strafgerichtshof eine Symbolkraft besitzt, die über die einzelne Verurteilung hinausgeht. Dass Länder, dass Konfliktsituationen auf dieser internationalen Bühne landen, sollte dazu genutzt werden, um seitens der Öffentlichkeit Druck zu machen und hinzuschauen. Um beispielsweise zu fragen: Was passiert in Palästina? Um welche Verbrechen geht es da? Und um die Informationen, die gewonnen werden, für die Aufarbeitung zu nutzen. Auch wenn es teuer ist. Auch wenn es lange dauert. Auch wenn es frustrierend ist.
Ist es überhaupt realistisch, dass je ein ehemaliges Staatsoberhaupt verurteilt wird?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Warten wir einmal ab, was zum Beispiel mit Omar al-Bashir, dem ehemaligen Staatsoberhaupt des Sudans, passiert, gegen den derzeit ein Verfahren hängig ist. Lange, lange Zeit konnte sich niemand vorstellen, dass er irgendwann irgendwo im Gefängnis sitzen würde. Das ist jetzt der Fall. Es bleibt abzuwarten, wie der politische Wind in Sudan hinsichtlich dieses Verfahrens weht. Aber da könnten wir das tatsächlich zum ersten Mal erleben.
Sudan, Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo – die bisherigen Verfahren betrafen fast ausschliesslich Täter aus afrikanischen Ländern. Ist der ICC ein neokoloniales Projekt, wie ihm das aus afrikanischer Perspektive oft vorgeworfen wird?
Das ist zu simpel. Viele der afrikanischen Länder, in denen ermittelt wurde, haben die jeweiligen Verfahren selbst angestossen; mitunter aus politischen Gründen, weil es zum Beispiel um die Oppositionskräfte innerhalb eines Landes ging. Daraus resultierte, dass die erste Generation von Gerichtsverfahren tatsächlich genau entlang hegemonialer Strukturen stattgefunden hat. Das rechtfertigt aber auf keinen Fall, dass der Schwerpunkt der Anklage einseitig auf afrikanische Länder gelegt wurde. Ich bin froh, dass die jetzige Chefanklägerin, Fatou Bensouda, den Mut hatte, den Internationalen Strafgerichtshof aus Afrika herauszuführen. Und Situationen angegangen ist, in denen nun auch den mächtigeren Akteuren auf der Weltbühne auf die Füsse getreten wird.
Fatou Bensouda hat Verfahren in Palästina, Afghanistan und Burma angestrebt. Gegnerinnen werfen ihr vor, ihr Vorgehen sei zu forsch gewesen und hätte den ICC unnötig politisiert.
Ist es politisieren, wenn man anfängt, das Kind beim Namen zu nennen und zu sagen, dass in Afghanistan Verbrechen begangen worden sind, die ermittelt werden müssen? Ist es hinnehmbar, zu sagen: Nur weil bestimmte Situationen politisch aufgeladen sind, kümmern wir uns nicht um diese Taten – obwohl sie genauso in den Zuständigkeitsbereich des Internationalen Strafgerichtshofs fallen? Meines Erachtens lässt es sich gerade nicht rechtfertigen, zu sagen: Wir beschränken uns auf Afrika, weil das ja weniger politisch ist – was im Übrigen Quatsch ist. Für afrikanische Länder ist es extrem politisch. Es trifft halt einfach nicht die mächtigen, geopolitisch einflussreichen Staaten wie zum Beispiel die USA.
Mit Blick auf die Ermittlungen in Palästina wird Bensouda vorgeworfen, diese würden die ohnehin angespannte Situation zusätzlich belasten und den Friedensprozess im Nahen Osten schwieriger machen.
Da geraten wir in die Debatte, was wichtiger ist: Frieden oder Gerechtigkeit? Es gibt die Vorstellung, es käme zuerst der Friedensvertrag und danach irgendwann die Aufarbeitung der begangenen Straftaten. Aber was passiert in endlosen Konflikten, wie Palästina einer ist? Die Hindernisse für einen nachhaltigen Frieden zwischen Israel und Palästina liegen nicht beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich bin eine grosse Verfechterin der Haltung, dass der Gerichtshof so flexibel sein sollte, dass er auch mal einen Schritt zurücktreten könnte, wenn es im Interesse der Opfer liegt. Wenn also im Nahostkonflikt zum Beispiel ein Friedensvertrag in greifbarer Nähe wäre. Aber was, wenn das nicht der Fall ist? Heisst das, dass wir dann einfach jahrzehntelang wegschauen? So gesehen halte ich dieses Argument nicht für überzeugend.
Aber ist es auch nur halbwegs realistisch, dass die Ermittlungen des Strafgerichtshofs in Sachen Palästina zum Abschluss kommen und so etwas wie Gerechtigkeit bringen werden?
Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, dass wir immer auch ein bisschen in Utopien leben müssen. Denn nur wenn wir in der Lage sind, ausserhalb dessen zu denken, was realistisch erscheint, können wir Fortschritte erzielen. Gerade für die Frage nach Gerechtigkeit bei internationalen Verbrechen ist es immer wieder wichtig, aus dem Korsett des vermeintlich Realistischen herauszutreten. Viele Dinge erscheinen zunächst nicht realistisch – und plötzlich passieren sie doch.
Die Untersuchungen in Afghanistan und Palästina waren Anlass für Ex-US-Präsident Trump, die Chefanklägerin Bensouda und ihr Personal mit Sanktionen zu belegen. Diese wurden durch die Biden-Administration aufgehoben. Ist das die Wiederherstellung der Situation unter der Obama-Regierung – oder gibt es Hoffnung auf mehr?
Aus meiner Sicht liest sich die Erklärung, die US-Aussenminister Antony Blinken abgegeben hat, als Rückkehr zur Obama-Position. Es geht jetzt erst einmal nur um die Reparatur des Schadens, den Trump angerichtet hat; zurück auf einen Weg der, sagen wir mal, konstruktiven Distanz. Blinken hat die US-Kritik an den Ermittlungen in Palästina und Afghanistan explizit wiederholt. Das zeigt, dass keine weiteren Überraschungen zu erwarten sind; im Sinne, dass die Biden-Administration nun beginnen würde, den Gerichtshof offen und mehr als nur punktuell zu unterstützen.
Fatou Bensouda tritt im Juni ab. Bei der Besetzung des neuen – dritten – Chefanklägers am ICC gab es dieses Jahr erstmals keinen einstimmigen Vorschlag der Mitgliedstaaten, sondern eine Kampfwahl. Warum war es diesmal so kontrovers?
Die letzten beiden Besetzungen des Postens haben deutlich gemacht: Mit der Chefanklägerin steht und fällt ganz vieles. Es ist die Position, die ausschlaggebend dafür ist, wie der ganze Internationale Strafgerichtshof tickt. Sie entscheidet, was vor die Richter kommt: Sind es die sicheren kleinen Fälle, oder ist es ein internationaler Gerichtshof, der Zähne zeigt? Entsprechend politisiert und kontrovers war die Besetzung der Position dieses Mal. Es gab aber auch noch nie zuvor ein derartiges Level an Transparenz. Und zum ersten Mal hat mit Blick auf die #MeToo-Bewegung eine Überprüfung der Kandidaten auf ihre Integrität als Führungspersönlichkeiten stattgefunden; beispielsweise dahin gehend, ob sie keine sexuellen Übergriffe zu verantworten haben. Das hat zu einem langen, schwierigen Auswahlverfahren geführt – meiner Ansicht nach am Ende mit einer guten Entscheidung.
Die Wahl des britischen Anwalts Karim Khan wurde von US- und Israel-freundlichen Kommentatorinnen gut aufgenommen – zumal sein Gegenkandidat, der Ire Fergal Gaynor, bezüglich der Ermittlungen in Afghanistan und Palästina als befangen galt. Wie wird sich Karim Khan in diesem Verfahren positionieren?
Das ist schwer zu sagen. Als Leiter der Ermittlungen im Auftrag der Uno, der versucht, die Verbrechen des IS im Irak aufzuklären, hat sich Khan intensiv mit den Komplexitäten des Nahen und Mittleren Ostens befasst. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine hohe Sensibilität für diese Sachverhalte mitbringt – aber ebenso für die Notwendigkeit, dass diese Verfahren angegangen werden. Ich meine auch, dass er sich da klugerweise bislang nicht politisch positioniert hat.
Illustration: Till Lauer