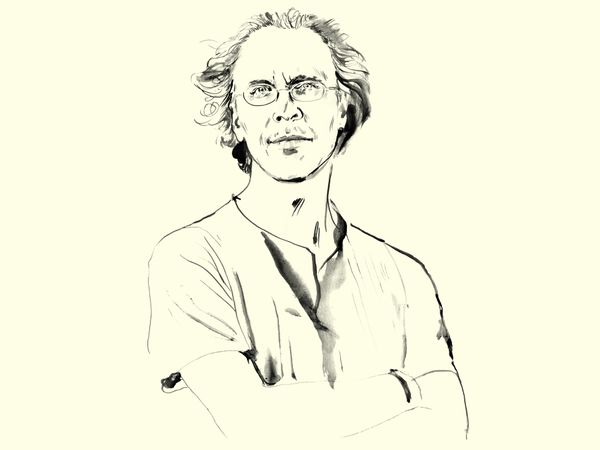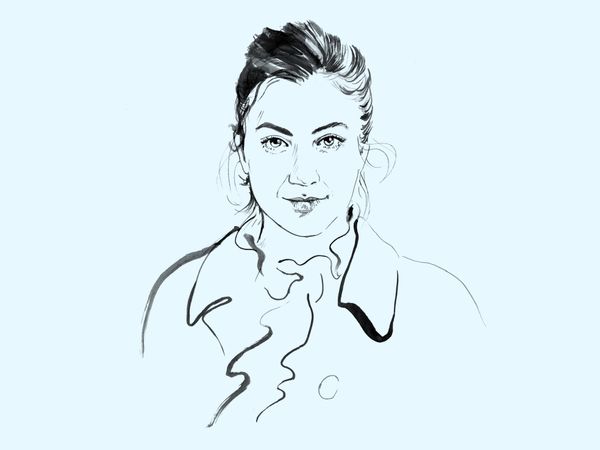Liebe Farah, die To-do-Liste haben wir unter Kontrolle, wenn alles andere den Bach ab geht
Vor einem Jahr hat die Autorin Michelle Steinbeck zuletzt mit ihrer Freundin Farah Grütter gefeiert. Dann kamen Kater und Shutdown. Ein Brief aus dem geschlossenen System der Pandemie-Routine.
Von Michelle Steinbeck (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 25.03.2021
Liebe Farah
Nun ist es schon über ein Jahr her, dass wir zusammen gegessen haben. Ich glaube, es war der Tag der Pressekonferenz, an dem der erste Schweizer Lockdown beschlossen wurde. Unser Znacht war noch erlaubt, trotzdem schrieben wir hin und her, ob wir nicht besser absagen sollten. Verschieben. Wahrscheinlich ahnten wir, dass es für eine lange Zeit das letzte Mal sein könnte.
Wir beschlossen, das Risiko einzugehen. Wuschen uns ostentativ die Hände («Seifibosch» – wann hast du das letzte Mal darüber gelacht?), tänzelten unsicher auf Abstand umeinander herum. Haben wir damals schon gelüftet? Kannten wir das Wort Aerosole?
Ein paar Stunden und Gläser später war die Fähigkeit, Distanzen zu schätzen, jedenfalls rapide gesunken. Vollkommen hemmungslos wurde es dennoch nicht mehr: Diese diffuse Vorstellung eines Schädlings, der unbemerkt in einer von uns sitzen und auf die andere überspringen könnte, hat uns wohl seither nicht wieder verlassen. Der Abend bleibt mir in Erinnerung als Abschied und Anfang, eine Art Silvester: Wir feierten in die Pandemie rein.
Zum Kater am nächsten Tag gesellte sich die Sorge. Auch das hat sich bis heute nicht verändert.
In den Tagen nach einer «ungeschützten» Begegnung reihen sich schwindelerregende Infektionsketten vor mir auf. Quarantänen, Krankheiten, von Gliederschmerzen bis Gerinnsel, Long Covid und Tode, die ich ausgelöst haben könnte. Dazu geht die hypochondrische Selbstüberwachung los: Ist das Wasser fad oder meine Zunge taub? Wen muss ich im Fall der Fälle alles informieren? Wer macht mein Testament? Und eine gemeine Stimme flüstert: «Na, hat sich das jetzt gelohnt?» Eine andere verflucht mich für meine Willensschwäche, die Lust an der kleinen Selbstzerstörung – für jede lungenreizende Zigarette, jedes immunsystemschwächende Glas.
Jeder hedonistische Moment potenziert die Möglichkeit fataler Konsequenzen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, die Selbstdisziplin versucht verbissen, Schritt zu halten. Kieferkrämpfe haben in diesem Jahr stark zugenommen: Das Internet ist uneinig, ob es ein Symptom von Covid-19 ist oder von gestresstem Maskentragen kommt.
Normal, es geht allen so, nicht wahr? Ich kann es auch nicht mehr hören. Es ist irgendwie out geworden, darüber zu reden.
Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir haben uns voneinander entfernt. Jetzt nicht konkret du und ich. Allgemein «Kontakte». Es steht etwas zwischen uns, und es ist unangenehm, davon zu sprechen.
Liegt es daran, dass wir uns seit einem Jahr unterschwellig voreinander fürchten? Dass wir Verhaltensweisen verurteilen und Angst vor Verurteilungen haben? Dass wir Beziehungen hierarchisieren? Dass uns der Körperkontakt fehlt, Umarmungen, das ungeschützt Unbeschwerte? Oder daran, dass wir die Pandemie in Phasen erleben und in diesen Phasen wie in Booten aneinander vorbeidriften?
Wer gerade aus dem dystopischen Testcenter kommt, weil er mit einer infizierten Person «ungeschützten Kontakt» hatte, ist vorsichtiger als eine, die gerade eine produktive Woche im einsamen Homeoffice hatte und sich nun aufs Wochenende freut: mal wieder unter Leute!
Mal wieder draussen unter Leuten höre ich mich und andere sagen: «Sorry, ich bin komisch geworden», oder: «Uh, echte Menschen, ich bin es nicht mehr gewohnt.» Die Antwort lautet stets: «Das geht uns doch allen so.» Das Thema ist damit abgehakt, aber verstanden fühlt sich, glaube ich, niemand. Wie geht es uns denn?
Meinst du, wir haben uns von uns selber entfremdet? Weil uns die Spiegel fehlen, die uns menschliche Begegnungen normalerweise hinhalten? Über den Bildschirm funktioniert dieses Spiegeln schlecht – vielleicht, weil wir uns da ständig selber sehen? Oder sind wir nach diesem Jahr im Gegenteil so «bei uns selbst» wie noch nie und empfinden andere als störend?
Der «Guardian» hat kürzlich getitelt, das Ende des Lockdowns würde in der Gesellschaft eine Welle von anxiety auslösen. Die Kommentierenden stimmten überwiegend zu. Einerseits, weil ihnen Lockerungen angesichts der pandemischen Lage zu früh erscheinen. Vor allem beschreiben aber viele, wie ihnen der Wegfall von sozialen Zwängen zusagt. Wie es ihnen guttut, mehr zu Hause zu sein. Einer meinte dazu: «You privileged white people can stay at home» – und sich Essen nach Hause liefern lassen von People of Color, denen nicht erlaubt würde, zu Hause zu bleiben.
Während andere sich exponieren, ist der Rückzug ein Privileg. Und er mündet in einer Routine, die süsslich stinkt, nach neoliberalem feuchtem Traum. Routine ist wichtig, das haben wir gelernt in diesem Jahr; an der Routine halten wir uns fest in diesen unsicheren Zeiten. Die To-do-Liste haben wir unter Kontrolle, wenn alles andere den Bach ab geht. Mit jedem erfolgreichen Abhaken erfährt der Selbstwert einen kleinen Boost. Wenn schon nicht systemrelevant, dann wenigstens fleissig.
Und diese neue Routine ist so gesund, organisiert und produktiv, ja rundum optimiert, dass sie bald ein geschlossenes System bildet. Alles, was nicht auf der Liste steht, was nicht der Selbstoptimierung und dem produktiven Output dient, prallt daran ab. Kurz: «Keine Zeit.»
Seit wann haben wir keine Zeit mehr? Oder vielmehr: Woher nahmen wir eigentlich früher die Freizeit? Wird sie zurückkehren, wenn wir wieder unbeschwert zusammenkommen dürfen? Werde ich bis dahin überhaupt noch Freundschaften haben? Meine Persönlichkeit hat sich verändert, ist mutiert von «Klar, bring alle mit!» zu: «Hm, hattest du in den letzten zehn Tagen viele Kontakte?» Sympathisch ist das nicht.
Du merkst, ich habe mich in der Mikroebene verrannt. Vielleicht ist das symptomatisch für diese zweite Welle: Wo in der ersten noch gross Gemeinschaftsgefühl gepredigt, ja gar die Solidarität vom Estrich geholt wurde, dominiert heute die Vereinzelung. Und während vor einem Jahr eine gewisse Entschleunigung beschworen und zelebriert wurde, hat sich diese klammheimlich in ihr Gegenteil verwandelt: Wir befinden uns in einem Tunnel aus Arbeit ohne Pause, ohne Ausgleich. Oder?
Haben wir überhaupt noch eine gemeinsame Wirklichkeit?
Während meine Wahrnehmung vornehmlich aus dem Komfort des heimischen Schreibzimmers entsteht, stehst du «an der Front». In den ersten Monaten der Pandemie haben sich die Kriegsmetaphern ja geradezu überschlagen. Damit einher ging auch eine Heroisierung von herkömmlich wenig prestigeträchtigen Berufen wie in der Pflege oder im Supermarkt. Das italienische Gesundheitspersonal soll nun für den Friedensnobelpreis nominiert werden, während Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen weiterhin auf taube Ohren stossen.
Wie hast du das erlebt? Und hat es sich seit der ersten Welle verändert?
Wenn ich einkaufen gehe, versuche ich jeweils möglichst schnell zu sein, um die Ansteckungszeit zu verringern. Im Gedränge vor dem Gemüseregal halte ich die Luft an. Dann sehe ich die Angestellten an der Kasse, beim Self-Check-out, die immer gleichen Security-Leute, und schäme mich. Kehre demütig heim, in die sichere Blase virtueller Parallelwelten: Arbeiten, Schreiben, Studieren, Lesen, Glotzen. Ich bin ein pulsierendes Hirn auf Beinen, die zum täglichen Auslauf automatisch den Hügel hochstaksen; ein Cyborg, eine bretonsche kommunizierende Röhre zwischen Hirn und Internet. Nur meine Augen hinken evolutionär hinterher, rot geädert, schönes Wort.
Aber dann ist da noch der Frühling, der danach drängt, alles aufzumischen. Das frische Gras glänzt. Die Störche mausen. Die Menschen strömen aus ihren Behausungen und erzählen sich auf dem Spaziergang von den neusten Umstellungen in ihrer Wohnung oder ihren Psychopharmaka. Manchmal wärmt die Sonne.
Komische Zeit, oder? Diese Spannung des Übergangs, noch unentschieden, wohin es uns treibt. Sind wir bald zurück in die Normalität geimpft? Oder steuern wir stracks in die dritte Welle?
Gestern war ich auf dem Hügel spazieren, und es war ein seltsames Wetter. Direkt auf den Feldweg schien die Sonne, aus einem hellblauen Himmelfleck, der jedoch immer kleiner wurde, während es sich rundherum dunkel zusammenbraute. Die Seelenlandschaft der Schweiz im März 2021. Ah, wohliges Pathos des Beinevertretens! Ich lache leise vor mich hin, während disziplinierte Lockdownkinder an mir vorbeijoggen und der eisige Schneeregenhagel einsetzt.
Die marxistisch-feministische Philosophin Silvia Federici schreibt in ihrem neuen Buch über den Körper im Kapitalismus: «Wir müssen (…) weniger arbeiten, die Kontrolle über unser Leben wiedererlangen und Verantwortung für das Wohlergehen einer breiteren Gruppe von Menschen als unserer Familie übernehmen. Wir haben keine Zeit mehr für Liebe, Freundschaft und Bildung. Durch den Kapitalismus haben wir den Blick für die Magie des Lebens verloren.»
Vor dem Fenster jetzt blaue Stunde. Krähen ziehen lärmend überm Nachbarsdach vorbei, schwarze Schnitte im klaren Abendhimmel. Es ist schon wieder Freitag. Morgen habe ich frei. Ich werde Ausschau halten auf dem Flohmarkt nach der Magie des Lebens.
Deine Michelle
Basel, 19. März 2021
Farah Faye Grütter studiert Soziologie und Philosophie. Dort spezialisiert sie sich auf Arbeitssoziologie, Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften und Politische Philosophie. Gerade arbeitet sie an einem Hörstück zu vermeintlichen Sprechverboten, Subjektivität und Rassismus für Radio X. Ferner schreibt sie hin und wieder, zum Beispiel für die Fabrikzeitung oder an Michelle. Und nebenbei arbeitet sie trotz allem wirklich gerne im Detailhandel.
Michelle Steinbeck ist Autorin von Büchern, Theaterstücken, Reportagen. Ihr Debütroman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch» (2016) war nominiert für den Deutschen sowie den Schweizer Buchpreis. 2018 folgte der Gedichtband «Eingesperrte Vögel singen mehr»; 2021 erscheint die Kurzgeschichtensammlung «The Return of the Lobster» in der Übersetzung von Jen Calleja. Steinbeck ist leitende Redaktorin der «Fabrikzeitung» und Kolumnistin der WOZ.