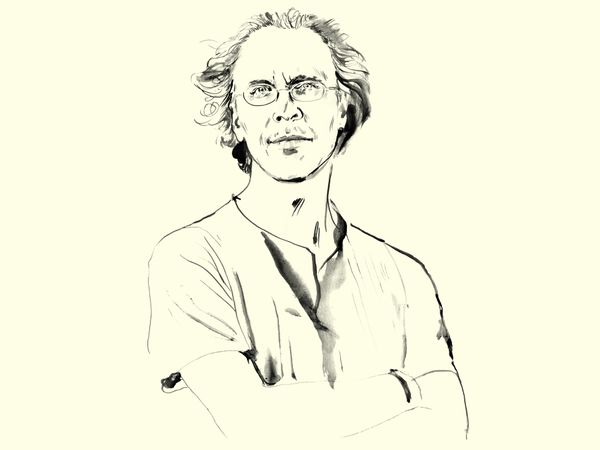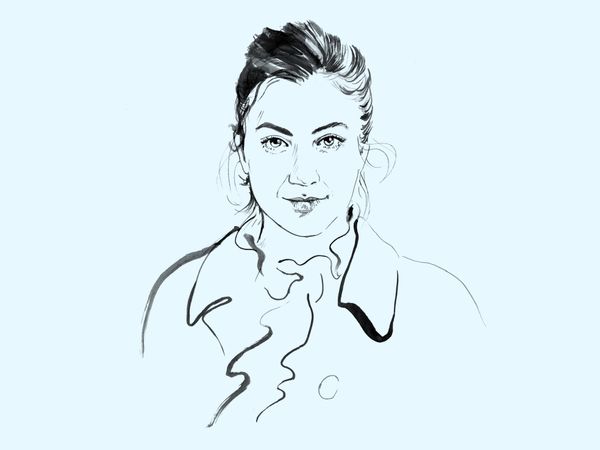Lieber Adolf, obwohl wir nichts weniger wollen, holt uns unser Virus wieder ein
Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji antwortet in der Reihe «Corona-Korrespondenz» auf den Brief von Adolf Muschg.
Von Melinda Nadj Abonji (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 13.03.2021
Lieber Adolf,
Das Stossgebet in dieser Zeit, so hast du geschrieben, lautet unverändert: zurück zur Normalität! Wir wollen wiederhaben, was wir nicht lassen können. Die Nebenwirkungen der Katastrophe – dass wir nicht mehr grenzenlos konsumieren, kaum noch fliegen, den Ausstoss an Schadstoffen tief halten – sei für uns kein Wink des Himmels, der uns die Augen öffnet.
Wir kehren also bald zur Normalität zurück, jubeln, weil wir alles wieder haben, wovon wir glauben, dass es uns zusteht, das Übliche und Gewöhnliche, das Bekannte, Normale eben, und wir reisen wieder zum Spottpreis ans andere Ende der Welt, fliegen mit Eindrücken und Souvenirs bereichert nach Hause, im Sommer planen wir die Winterferien, während der Arbeit den Feierabend, wir decken uns weiterhin ein mit smarter Technik, fotografieren unser ausgeklügeltes Essen, lassen unsere Freunde daran teilhaben, verschicken Rezepte unserer Lebensfreude to anybody who wants to share – die Liste ist lang –, wir umarmen uns geimpft und küssen uns innig an jeder Ecke, weil wir froh sind, dass der Spuk vorbei ist, führen endlose Gespräche, beteuern, wie dankbar wir sind, unser altes Leben wiederzuhaben, die Freiheit, auf die wir so lange und mit einer unfreundlichen Maske verzichten mussten – wir sind längstens wieder in unserem gewohnten Leben angekommen, als etwas Unerwartetes geschieht.
Während des ersten Shutdowns vor einem Jahr haben wir Stimmen der Schweizer Literatur zum Briefwechsel mit einer Adressatin ihrer Wahl gebeten. Jetzt haben wir erneut gefragt: Wie lebt es sich in Corona-Zeiten? Alle Briefe finden Sie hier.
Es spielt keine Rolle, wo wir gerade sind, ob auf einer Reise, beim Wandern, bei der Arbeit oder zu Hause, vielleicht liegen wir schlaflos im Bett – und es kommt uns so vor, als würde irgendwer ein hinterlistiges Spiel mit uns treiben –, da uns plötzlich ein Satz vor die Augen fällt, den wir nie haben denken wollen, der sich aber zu unserem Erstaunen nicht mehr wegwischen lässt: Nichts ist normal! Und im ersten Moment glauben wir an ein Versehen – alles ist normal, muss es doch heissen, nicht wahr? Wir wollen uns sicher nicht von einem einzigen, falschen Wort unser wiedergewonnenes Leben vermiesen lassen? Wir wittern sogar Verrat an uns selbst, listen hastig auf, was unser Leben zu einem schönen und guten und richtigen und aufregenden Leben macht. Aber so sehr wir uns bemühen, überfällt uns nur immer wieder dieser eine ungeliebte Satz.
Obwohl wir nichts weniger wollen, holt uns unser Virus wieder ein; in heftigen Fieberträumen, die uns an Bilder von Leonora Carrington erinnern, fallen mächtige Bäume zu Boden, und wir suchen verzweifelt nach ihren Namen, rufen wirre Wörter in die Luft, weinen keine Tränen, sondern Kieselsteine, halten uns vergebens die Ohren zu, halten das Krachen, die frei schwebenden Kettensägen nicht aus, wir schreien wie Vögel, die aus den Kronen auffliegen, wir schreien, weil eine unsichtbare Hand an unserem Bett sägt, wir liegen am Boden, mit dem Gesicht zur Erde, die Arme ausgebreitet, wir wimmern, die toten Baumkörper neben uns, und wir fliegen, unter uns fliehende Herden, Gnus, Zebras, Elefanten, Antilopen, wir fliegen höher, kopfvoran, durchbrechen eine milchige Schale, es tut weh, wir schmecken Eisen auf der Zunge, sehen nichts mehr, wo ist der Himmel? Wir sind doch ganz oben angekommen? Und weil wir fürchten, blind geworden zu sein, müssen wir aufwachen, müssen unbedingt aufstehen, uns die Hände waschen, das Gesicht, den ganzen Kopf.
Obwohl wir uns alle Mühe geben, uns an den Küchentisch setzen, uns mit einem Glas Wasser erfrischen, froh sind, dass es dämmert, wir den Himmel in einem rosa Schleier sehen; obwohl wir unsere Kleider anziehen, einen Kaffee aufsetzen, das tun, was wir immer tun, ahnen wir, dass der Traum nur der Anfang war – die Bilder ein Zeichen sind aus unserer Welt der Zerstörung. Und es überfällt uns eine unangenehme Gewissheit, dass wir längst nicht alle sind, dass wir vermutlich immer noch zu wenige sind, die träumen und die Grausamkeit unseres normalen Lebens nicht mehr ertragen.
Wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der wir uns an einem von uns gewählten Zeitpunkt des Tages dem Himmel zuwenden, unsere Blicke von Schuhspitzen, Fahrbahnen, Bildschirmen und Tastaturen lösen, unsere verkrampften Köpfe in die Luft heben, als wären wir unverschämt frei; wenn wir uns von hoch aufgeschäumten Wolken verführen lassen, unsere Finger dem Licht entgegenstrecken, in ein Gemurmel verfallen, als erinnerten wir uns dunkel an Rituale unserer Vorfahren; wenn wir den Vogelflügen folgen, uns staunend fragen, warum sie in der Abenddämmerung in flackernden Schwärmen genau über der Flusslinie fliegen – was wäre damit gewonnen? Wenn wir darüber rätseln, wo der Luftstoff aufhört, der Himmel anfängt, ob er überhaupt da ist, über unseren Köpfen – hätten wir damit etwas gewonnen?
Nein. Wir hätten rein gar nichts gewonnen. Die Kosten-Nutzen-Rechnungen und die in Kurven verbildlichten Kalkulationen sind dem Himmel egal, dem Licht, den Vögeln, dem Fluss. Unsere verbissene Rastlosigkeit, der zum Gesetz erhobene Zwang zu profitieren, zu geniessen, anderswo zu sein als da, wo wir gerade sind, kommt beim Schauen des Himmels zu einem Ende.
Erschöpft und möglicherweise ratlos erkennen wir, dass die Gesetze und Gewohnheiten, nach denen wir leben, für die wir leben, ausserhalb unserer Wirklichkeit keine Gültigkeit haben. Jeder graue oder barock gefärbte Himmel, der Wolkentumult, bevor die Tropfen fallen, die Mauersegler, um die wir fürchten, weil sie gefährlich nah an den Hausmauern vorbeiflitzen; diese Welt, die wir in unserer Unbeholfenheit «Natur» nennen, befragt uns – wenn wir uns ihr zuwenden –, sie stellt uns die Frage, woher wir uns das Recht nehmen, so zu leben, wie wir leben.
Ich setze mich hin, lege meine Handflächen auf den Tisch, der mir vertraut ist. Fühle mich vollkommen hilf- und ratlos, wie du dich auch. Zurück zur Normalität. Der Satz hat eine ungeheure Wucht, wenn wir ihn bedenken.
Wo ist die Grenze der täglichen Mitleidlosigkeit? Wenn es normal ist, dass unsere Baumgefährten geopfert werden, ohne die wir nicht leben können? Wenn es normal ist, unsere Tiere zu Nutztieren zu degradieren?
Ich muss das Fenster öffnen, in der kalten Morgenluft meinen Kopf zum Himmel drehen, durchatmen und einsehen, dass jede Katastrophe unsere Katastrophe ist und wir unverdrossen fleissig weiter daran arbeiten, unseren einzigen Planeten zu zerstören, wenn wir mit überzeugt-verrückter Stimme rufen: zurück zur Normalität!, und dabei den Wink des Himmels ignorieren, wie du wunderbar geschrieben hast. Und ich schäme mich, lieber Adolf. Die Normalität bedeutet die Abwesenheit der Moral – diese Erkenntnis tut weh.
In Verbundenheit und allem Dank für deine Worte,
Melinda
Zürich, 8. März 2021
Adolf Muschg, geboren 1934, ist eine der grossen Stimmen der Schweizer Literatur. Er war Germanistik-Professor an der ETH Zürich und Präsident der Berliner Akademie der Künste. Immer wieder hat er mit seinen Beiträgen die Schweizer Debatte geprägt, am kontroversesten mit dem Essay «Wenn Auschwitz in der Schweiz liegt». 2018 ist sein neuester Roman «Heimkehr nach Fukushima» erschienen.
Melinda Nadj Abonji wurde 1968 in Becsej im heutigen Serbien geboren und wuchs ab 1973 in Zürich auf, wo sie heute lebt. Ihre Familie gehörte zur ungarischen Minderheit in der Region Vojvodina. Nadj Abonji ist Musikerin und Schriftstellerin und gehört zu den wichtigen Stimmen der Schweizer Literatur. Für ihren Roman «Tauben fliegen auf» erhielt sie 2010 den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. 2017 erschien ihr Roman «Schildkrötensoldat», der mit dem Schillerpreis ausgezeichnet wurde.