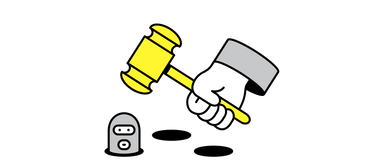
«Strafrecht dient zu oft politischen Zwecken»
Staatsanwälte haben viel Macht: Sie entscheiden die meisten Strafverfahren selber und müssen ihre Entscheide nicht mal begründen. Staatsanwalt Christoph Ill über die rechtsstaatlich heikle Rolle seines Berufsstands.
Ein Interview von Dominique Strebel, 09.12.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Staatsanwältinnen sind im Strafrecht die entscheidenden Player: Sie führen nicht nur die Strafuntersuchungen, sondern entscheiden 98 Prozent der Fälle gleich selbst. Sie stellen Verfahren ein oder erlassen einen Strafbefehl – eine Art Urteilsvorschlag, der dann zum Urteil mutiert, wenn ihn die Verurteilten akzeptieren. Nur wenn eine Verurteilte Einspruch erhebt, beugt sich ein Gericht über die Sache – oder in jenen Fällen, in denen die beantragten Sanktionen höher liegen als sechs Monate Freiheitsstrafe oder 180 Tagessätze Geldstrafe: Das ist die Obergrenze für Strafbefehle. Richter werden damit zu Nebenfiguren. Sie entscheiden weniger als zwei von hundert Straffällen.
Nur so könne die Flut der Strafverfahren schnell und kostengünstig bewältigt werden, argumentieren Politikerinnen, Richter und Staatsanwältinnen. Doch das Strafbefehlsverfahren hat einige Konstruktionsfehler: Staatsanwälte müssen Beschuldigte vor ihrem Entscheid nicht einvernehmen und ihre Strafbefehle nicht begründen. Auch lässt sich ihre Arbeit schlecht kontrollieren, weil Einstellungsverfügungen nicht öffentlich aufgelegt und der Zugang zu Strafbefehlen in fast allen Kantonen stark erschwert ist. Alles muss schnell und kostengünstig gehen.
Obwohl Staatsanwältinnen in den allermeisten Strafverfahren faktisch richten, sind sie in den meisten Kantonen nicht Teil der richterlichen Gewalt (Judikative), sondern der ausführenden (Exekutive). Und sie werden in den meisten Kantonen weder von den Parlamenten noch vom Volk gewählt, sondern vom Regierungsrat. So hat der ständige Ausbau des Strafrechts Gewaltenteilung und Rechtsstaat in Schieflage gebracht. (Besonders heikel ist die Rolle von Staatsanwälten, wenn Fehlverhalten von Polizistinnen untersucht werden soll. Einen Report dazu lesen Sie hier.)
Christoph Ill ist Erster Staatsanwalt des Kantons St. Gallen und kennt die Problematik von Grund auf – er führt seit dreissig Jahren Strafverfahren.
Christoph Ill (59) ist seit Oktober 2018 Erster Staatsanwalt des Kantons St. Gallen. Seit 1990 war er im Kanton St. Gallen als Untersuchungsrichter und später als Staatsanwalt tätig. Zudem ist er Co-Direktor der Staatsanwaltsakademie, die der Universität Luzern angegliedert ist. Im CAS Forensics (und an der Schweizer Journalistenschule MAZ) unterrichtet er unter anderem Einvernahmetechniken. Christoph Ill ist parteilos.
Ort: Staatsanwaltschaft St. Gallen, St. Gallen
Zeit: 13. November 2020
Wie sieht der Alltag von Staatsanwälten aus? Kommen die ins Büro und wälzen Akten – oder düsen sie an den Tatort und jagen zusammen mit der Polizei Verbrecher?
Es gibt nicht den Staatsanwalt oder die Staatsanwältin. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich. Hat ein regionaler Staatsanwalt Pikettdienst, sieht seine Woche ganz anders aus als jene einer Wirtschaftsstaatsanwältin. Im Pikettdienst kann es sein, dass am Montagmorgen ein Mord gemeldet wird, am Nachmittag ein schweres Sexualdelikt. Dann werden Einvernahmen, Hausdurchsuchungen und weitere Zwangsmassnahmen oder Gutachten etc. nötig. Eine Wirtschaftsstaatsanwältin hingegen studiert je nachdem wochenlang im Büro Akten.
Am Ende einer Strafuntersuchung fällen Staatsanwälte meist auch gleich das Urteil.
Aber nicht bei den oben erwähnten schweren Fällen wie Mord, schweres Sexual- oder Wirtschaftsdelikt.
Trotzdem: In mehr als 98 Prozent aller Strafverfahren entscheiden heute Staatsanwältinnen und nicht Richter. Wie erklären Sie das?
Dafür sind unsere National- und Ständeräte verantwortlich. Sie haben in den letzten Jahren unglaublich viel Verhalten für strafbar erklärt. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Hund nicht anmelden, gibt es ein Strafverfahren. Wenn Sie Ihre Parkbusse nicht bezahlen, landet das auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Wenn Sie im öffentlichen Verkehr keine Hygienemaske tragen und verzeigt werden, gibt es ein Strafverfahren. So erklärt sich die hohe Zahl von 98 Prozent aller Strafverfahren, die Staatsanwälte entscheiden. Es sind nämlich zur Hauptsache Bagatellfälle. Und im Ernst: Ich verstehe nicht, wieso all diese Bagatellen im Rahmen eines formellen Strafverfahrens abgehandelt werden müssen. Werden Strafen inflationär, verlieren sie ihre Wirkung. Strafrecht sollte Ultima Ratio sein – das schärfste Mittel einer Gesellschaft.
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Strafrecht dient viel zu oft politischen Zwecken. Taucht in der Gesellschaft ein neues Problem auf, ist es für Politikerinnen und Politiker attraktiv, einfach eine Strafnorm zu fordern. Andere Massnahmen sind aber oft deutlich erfolgreicher.
Welche denn?
Verbesserte Information und Prävention.
Sollte man Strafen im Bagatellbereich also abschaffen?
Im Bagatellbereich kann man Strafen durch eine Art Lenkungsabgaben ersetzen, wie Alt-Bundesrichter Niklaus Oberholzer das schon vorgeschlagen hat. Das fände ich sinnvoll, auch wenn man die konkrete rechtliche Regelung wie etwa die Verfahrensrechte noch im Detail abklären müsste.
Ist Corona ein Beispiel für unnötige Strafen im Bagatellbereich?
Ja und nein. Bei Corona sollte der Staat das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern vor allem über Information und Appell an die persönliche Verantwortung steuern. Aber offenbar brauchen wir einen Befehl von oben, bis wir machen, was jeder bereits freiwillig vorkehren könnte: Maske tragen, Distanz halten, Hände waschen.
Wir warten also auf die Norm, bis wir unser Verhalten anpassen.
Ja, das hat die Einführung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gut gezeigt. Und dann muss der Staat entscheiden, was passiert, wenn die Norm nicht eingehalten wird. Bei der Maskenpflicht kann die Strafe zumindest als Denkanstoss wirken. Nach zwei, drei Strafen, über die auch Medien berichten, richten sich die meisten Leute danach. Flachen die Ansteckungszahlen aber ab, verliert eine solche Strafnorm an Legitimation. Dann ist von Polizei und Staatsanwältinnen viel Augenmass gefragt.
Sind die Strafnormen zu Corona klar?
Nein. Die gesetzliche Grundlage ist kompliziert und widersprüchlich. Die Verordnungen wurden ja auch im Rekordtempo erstellt und geändert. Zum Teil mussten wir die Verordnungen gestützt auf Aussagen von Bundesräten an Medienkonferenzen auslegen.
Zurück zur Grundsatzfrage: In 98 Prozent der Strafverfahren entscheiden nicht mehr Richterinnen, sondern Staatsanwälte. Ist das rechtsstaatlich nicht bedenklich?
Diese Frage müssen Sie dem Gesetzgeber stellen, nicht mir. Aber klar ist: Es kostet weniger, wenn Staatsanwältinnen mittels Strafbefehlen selbst Entscheide fällen können und es nicht in allen Fällen Richter tun. Wenn Staatsanwälte alle Verfahren vor Gericht zur Anklage bringen würden, bräche das Justizsystem zusammen.
Hatten die Staatsanwälte schon immer eine so grosse Macht?
Nein. Im Kanton St. Gallen durften Staatsanwälte lange nur Freiheitsstrafen bis maximal vier Wochen verhängen, später dann drei Monate. Erst seit der eidgenössischen Strafprozessordnung von 2011 haben wir die Kompetenz, Freiheitsstrafen bis sechs Monate Gefängnis oder Geldstrafen bis 180 Tagessätze auszusprechen. Dadurch hat natürlich die Zahl der Strafverfahren, die wir eigenständig entscheiden können, massiv zugenommen.
Staatsanwälte gehören nicht der richterlichen Gewalt an, sondern der Exekutive, und trotzdem richten sie in 98 Prozent der Fälle. Das widerspricht doch der Gewaltenteilung.
Richtig, wenn sie nur die administrative Unterstellung betrachten. Fachlich beaufsichtigt uns aber die Anklagekammer des Kantonsgerichts. Sämtliche Verfahrenshandlungen und Verfügungen der Staatsanwaltschaft können mit Beschwerde angefochten werden und unterliegen so einer richterlichen Prüfung. Zudem kann die Anklagekammer allgemeine Weisungen erlassen, beispielsweise zum Akteneinsichtsrecht nach rechtskräftigem Strafverfahren.
Trotzdem: Sie wurden vom Regierungsrat des Kantons St. Gallen gewählt. Sagt Ihnen der Justiz- und Sicherheitsdirektor des Kantons St. Gallen auch, wo Sie Ihre Ressourcen einsetzen sollen – zum Beispiel, dass Sie mehr gegen Wirtschaftskriminelle vorgehen sollen als gegen Drogendelinquenten?
Diese Entscheide fällen die Mitglieder der Staatsanwaltskonferenz des Kantons St. Gallen – das sind die leitenden Staatsanwälte der regionalen Staatsanwaltschaften, der Jugendanwaltschaft und ich als Erster Staatsanwalt. Wir setzen die Prioritäten, das tut nicht der Regierungsrat.
Und wie setzen Sie die Prioritäten?
Wir setzen die Ressourcen im Zweifel dort ein, wo die Sozialschädlichkeit am grössten ist. Wir würden zum Beispiel einen Betrugsfall, bei dem vor allem ältere Anleger geschädigt und um ihre Pension gebracht wurden, prioritär behandeln gegenüber einem Betrugsfall, bei dem Anlageprofis Geld verloren haben. Angesichts des Strafverfolgungszwanges ist der Spielraum jedoch eng.
Wie prioritär sind Strafverfahren wegen Corona?
Das ist eine Diskussion, die wir intensiv führen. Bei Corona wurden plötzlich Verhaltensweisen strafbar, die vorher erlaubt waren. Zuallererst hat aber die Polizei mit diesen Fällen zu tun. Und da war es mir ein Anliegen, dass die Polizei mit Augenmass vorgeht – was sie auch tut. Landet dann ein Fall trotzdem bei uns, ist mir wichtig, dass sofort und schnell eine Strafe gefällt wird. Nur so hat die Strafe die erwünschte Wirkung zur Bekämpfung der Pandemie.
Wenn Staatsanwälte eine Strafe aussprechen, sind sie nicht verpflichtet, Beschuldigte vorgängig einzuvernehmen. Wie oft wird einvernommen?
Genaue Zahlen habe ich nicht, aber Einvernahmen sind auf die gesamte Menge der Strafbefehlsverfahren gesehen eher die Ausnahme.
Staatsanwältinnen schauen meist nur in die Polizeiakten und entscheiden am Bürotisch, ohne den Beschuldigten gesehen zu haben. Ist Ihnen wohl, so zu entscheiden?
Die meisten Fälle sind Bagatelldelikte, die durch eindeutige technische Aufzeichnungen klar belegt sind – etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen. In vielen Fällen wurden die Beschuldigten bereits von der Polizei einvernommen. Wieso soll ich bei klarem Sachverhalt nochmals vorladen? Damit sie mir nochmals das Gleiche erzählen? Das verstehen Beschuldigte oft nicht. Wie jener Bauer im Toggenburg, dem der Staatsanwalt – wie es das Gesetz vorsieht – zu Beginn der Einvernahme erklärte, er sei nicht verpflichtet, eine Aussage zu machen. Da fragte der Bauer erstaunt: «Wieso lässt du mich dann überhaupt kommen, du Tubel?»
Sind die Polizeiakten verlässlich?
Ja, in der Regel ist die Qualität gut.
Sie unterrichten auch Einvernahmetechniken. Geben Sie uns drei ultimative Tipps, um Leute zum Reden zu bringen.
Gegenfrage: Mit wem reden Sie gerne?
Mit jemandem, der sich für mich interessiert, der sich in mich einfühlt, der Verständnis zeigt und dem ich vertraue, dass er nachvollziehen kann, was ich sage.
Ich habe diese Frage schon oft gestellt – auch Richtern aus Bhutan. Es ergeben sich immer die gleichen Kriterien: Die Befragerin muss vorurteilsfrei sein, empathisch, interessiert und sympathisch. Es geht nicht darum, Beschuldigte zu belehren, sondern darum, möglichst präzise rekonstruieren zu können, was wirklich passiert ist. Darum sind meine drei Tipps: Erstens zuhören, zweitens zuhören und drittens zuhören.
Zurück zu den Einvernahmen, die im Strafbefehlsverfahren ja oft fehlen. In der aktuellen Revision der Strafprozessordnung will der Bundesrat Gegensteuer geben. Gemäss seinem Entwurf müssen in Zukunft Staatsanwälte immer einvernehmen, wenn es um Freiheitsstrafen ab vier Monaten oder Geldstrafen ab 120 Tagessätzen geht. Was halten Sie davon?
Ich finde diesen Vorschlag gut. Vier Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen sind einschneidend. Da sollte eigentlich zwingend einvernommen werden. Aber die Politikerinnen sollten dann auch konsequent sein und uns mehr Stellen bewilligen. Denn mehr Einvernahmen bedeuten auch mehr Arbeit.
Wie viele zusätzliche Leute brauchen Sie?
Diese Frage muss ich mir nicht stellen. Denn aktuell erhalte ich eh nicht mehr Ressourcen. Erstaunlicherweise sind es gerade jene Politiker, die nach mehr Strafrecht rufen, die uns die nötigen Ressourcen für die Verfahrensführung nicht bewilligen wollen.
Wenn Staatsanwältinnen eine Strafe aussprechen, müssen sie ihren Entscheid – den Strafbefehl – nicht einmal begründen. Finden Sie das richtig?
Das ist suboptimal. Aber der Gesetzgeber verlangt das halt nicht.
Aber wenn Strafbefehle nicht begründet werden, verstehen die Verurteilten oft gar nicht, warum sie bestraft werden.
Das ist ein Problem. Das wird in der Rechtswissenschaft auch kritisiert. Aber wie gesagt: Wir Staatsanwälte haben die Regeln zum Strafbefehl nicht erfunden. Das war der Gesetzgeber.
Aber Sie könnten über das hinausgehen, was der Gesetzgeber verlangt.
Dafür müssten wir mehr Ressourcen haben.
Trotzdem: So wirken die Strafen kaum. Die Verurteilte wird nicht einvernommen, erhält einfach einen Brief mit der Strafe ohne Begründung. Viele verstehen nicht, dass sie vorbestraft sind, wenn der Strafbefehl rechtskräftig wird und Urteilscharakter bekommt.
Das ist nicht optimal. Aber gerade deshalb begründen wir im Kanton St. Gallen die Strafbefehle oft, obwohl wir von Gesetzes wegen gar nicht müssten. Das machen wir bei Freiheitsstrafen in etwa der Hälfte aller Fälle. Zudem können die Beschuldigten natürlich Einsprache erheben und werden danach einvernommen, bevor es zum ordentlichen Strafprozess kommt.
Viele Kantone erschweren den Medien und der Öffentlichkeit die Kontrolle der Strafbefehle. Man muss vor Ort gehen, um sie einzusehen.
Transparenz ist mir wichtig, damit die Öffentlichkeit kontrollieren kann, ob die Staatsanwaltschaft das Recht korrekt anwendet.
Darum gilt im Kanton St. Gallen eine vorbildliche Praxis: Akkreditierte Journalisten erhalten eine Liste der Strafbefehle per Mail zugestellt und können einzelne Entscheide als PDF bestellen. Machen Sie damit gute Erfahrungen?
Grundsätzlich schon. Aber oft geht es den Medien nicht um die Justizkontrolle, sondern um Pranger und Klicks. Boulevardmedien funktionieren nach einem einfachen Schema: Sie kombinieren ein bestimmtes Delikt wie Pornografie mit einem prominenten Namen. Aber unsere Haltung ist: Wir müssen den Anspruch der Öffentlichkeit auf Information rechtlich korrekt gewähren. Was die Medien daraus machen, liegt nicht in unserer Verantwortung.
Illustration: Till Lauer