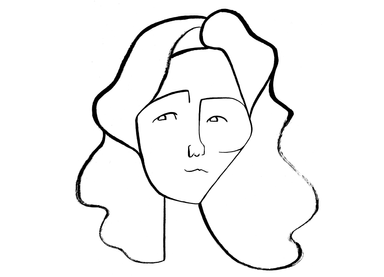

Besser sterben
Homeoffice, Homeschooling, Hometraining: In der Pandemie ist nahezu alles Denken und Reden auf das Leben ausgerichtet. Warum ist der allgegenwärtige Tod derart tabu?
Von Mely Kiyak, 10.11.2020
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Es fiel mir schon im Frühjahr auf. Aber ich war mir unsicher. Nicht so sehr darüber, ob mein Eindruck richtig, sondern ob er berechtigt war.
Nun, während der sogenannten zweiten Welle, wieder das gleiche verstörende Gefühl: wie sehr es bei der Pandemie um das Leben geht und, im Vergleich dazu, nahezu gar nicht um das Sterben und seine Bedingungen. Gerade jetzt müsste man sich doch darin überbieten, über Sterbekulturen und -praktiken zu sprechen, über Gottes- und Jenseitsbilder, über Ängste, Hoffnungen, Trost. Über letzte Begegnungen, Worte und Berührungen. Darüber, was es bedeutet, wenn sie unmöglich gemacht werden. Und ob das eigentlich rechtens ist.
Stattdessen ist es so: Obwohl wie verrückt gestorben wird, wird das Sterben ohne grösseren gesellschaftlichen Widerspruch ins System integriert. Der Tod hat sich der bestehenden Infrastruktur der Intensivmedizin und ihren routinierten Abläufen gnadenlos unterzuordnen. Zur Not sterben die Menschen ohne Begleitung, zwar unter dem Gepiepse der Maschinen, aber eben auch still und klammheimlich. Das Sterben soll die Dienstpläne und Hygienekonzepte nicht stören.
Und nicht zum ersten Mal verabscheue ich diesen Grundsatz der Intensivmedizin, dass selbst im Sterbeprozess noch die Lebenserhaltung im Zentrum aller Bemühungen steht und bis zum Schluss die Maschinen und Schläuche surren, dröhnen und fiepsen. Auch wenn man meinen könnte, dass es doch eine Oase der Ruhe geben müsste, in der ein Kranker seine letzten Atemzüge nehmen darf.
Selbst jetzt, wo die einsamen Tode auf den Intensivstationen zunehmen werden, findet kein Gespräch darüber statt, ob diese Art, Infizierte sterben zu lassen, nicht eigentlich hochgradig grausam und pervers ist. Es ist, als ob jeder, der mit seinen Angehörigen diesen Prozess durchlebte, anschliessend keine Kraft mehr hat, für Veränderungen zu streiten. Man versteht es. Es hat sich ja auch erledigt. Und eigentlich ist es die Aufgabe der noch nicht direkt Betroffenen, für die Würde der Sterbenden einzustehen.
Wer die letzten Monate gezwungen war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil er oder sie krank ist, wer nach Möglichkeiten des friedlichen Sterbens für eine Angehörige oder sich selbst Ausschau halten musste, weiss: Zu den Grunderfahrungen einer jeden Kranken gehört es, dass sich im medizinischen Sektor fürs Sterben keiner zuständig fühlt. Da werden dann verschämt die Handzettel auf die Ablage des Rollschranks gelegt. Darauf stehen die Öffnungszeiten der krankenhausinternen Kapelle, die Durchwahl des sozialpsychiatrischen Dienstes oder die Handynummer eines evangelischen Pfarrers; ganz gleich, welcher Religion die Patientin angehört.
Der Tod ist auch sprachlich ausgelagert.
Wenn es darum geht, die pandemiebedingten Beschränkungen zu erklären, heisst es, man müsse «das Gesundheitssystem entlasten». Die «Situation der Intensivbetten» verbessern. Aber es geht doch nicht ernsthaft um Betten, oder? Wenn verbal stets ein System im Zentrum steht, nicht aber der erkrankte und möglicherweise im Sterben liegende Mensch, dann spricht das für eine Gesellschaft Bände. Die Ärzte sagen, es gehe darum, dass so viele Patientinnen wie möglich überleben. Ich entgegne, dass es darum geht, dass möglichst wenige sterben. Beides stimmt. Aber in meiner Version wäre man gezwungen, sich auch zu fragen, wie die, die sterben müssen, besser sterben können.
Dieses Thema ist freilich immer virulent. In Deutschland starben im Jahr 2018 eine Viertelmillion Menschen an Krebs. Und jedes Jahr erkranken eine halbe Million Menschen neu an Krebs. Auch in der Schweiz ist dies die zweithäufigste Todesursache: Von den knapp 70’000 Todesfällen jährlich sterben die Hälfte an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs.
Bereits ohne Covid wurde also viel gestorben.
Trotzdem war und ist der Tod kaum Alltagsthema. Jedenfalls nicht so, wie es Alltag ist, dass Paare detailliert über ihre Zeugungsversuche und Geburten Auskunft in den Medien geben.
Auch über Sexualität wird viel und in allen Facetten gesprochen, aber so gut wie nie über das Sterben und den Tod. Das alles sind aber Facetten des Lebens: lieben, leben, sterben.
Vor einigen Jahrzehnten war es absolut üblich, dass die Privatsender um die Mittagszeit Nahaufnahmen aus Geburtsstationen zeigten. In Close-ups konnte man den Gebärenden teilweise bis in die geöffneten Muttermünder hineinschauen und minutenlang auf gedehnte Vulven starren, aus denen haarige Köpfchen ragten. Der Zuschauer sah das Baby früher als der werdende Vater am Kopfende der Frau. Etwas vergleichbar Nahes und Intimes sieht man über das Sterben nie. Jedenfalls nicht, wenn es sich nicht um das Original-Obduktionsfoto einer zerfledderten Leiche handelt. Die nämlich sieht man auf Netflix mittlerweile in jeder Crime-Documentary.
Aber das alltägliche, übliche Sterben, das ohne Stichwunde und Schussverletzung, das kalte Sterben unter Neonlicht, hat keine Bilder und kaum Erzählungen.
Bevor das Sterben in die Krankenhäuser ausgelagert wurde, starben Menschen in Gemeinschaften, zwar privat, aber in Gesellschaft. Da, wo ich herkomme, brachte man Sterbende in ein Sterbezimmer, Enkel, Kinder und Dorfbewohnerinnen liessen weder den Sterbenden noch seine Angehörigen alleine. Mein Grossvater starb so. Im Beisammensein seiner Familie und seines Dorfes. Man war still, aber da. Und wenn der Sterbende tot war, dann gab man ihm Zeit, völlig entschwinden zu können. Selbst in diesem Prozess wurde er begleitet. Danach gestreichelt, verabschiedet, gewaschen und in ein Tuch gewickelt. Bis ins Grab fasste keine fremde Person den Sterbenden an, nur seine Söhne, Enkel, Neffen. Die Töchter, Nichten oder die Frau. Vielleicht der engste Freund.
Während des Lockdowns empfand ich die Konzentration auf das Leben angestrengt und selbstbezogen. Permanent ging es darum, wie man trotz der Kontaktbeschränkungen und trotz Homeoffice, Homeschooling, Hometraining schön weiterleben konnte. Aber es kann während einer Epidemie doch nicht permanent um die Gesunden und die Lebenden gehen! Die Onlineauftritte der Zeitungen überboten sich in Gymnastik-, Koch- und Spieltipps – alles war auf das Leben ausgerichtet.
Auch die Politik reagierte sofort auf die Situation: Steuererleichterungen für das Homeoffice, Wirtschaftshilfen für in Not geratene Unternehmen – aber nichts, was den Sterbenden das Sterben erleichtern könnte. Oder ihren Angehörigen helfen könnte. Staatliche Zuschüsse für Beerdigungen – wirklich nur eine Idee, denn Beerdigungen in Deutschland sind absurd teuer – wurden nicht diskutiert. Wir kennen die Anzahl der Intensivbetten, nicht aber die Anzahl der Krematorien und die Terminlage. Wir kennen nicht die Bestände der Friedhöfe und der Gräber.
Sterbekonzepte für Corona-Patientinnen wären ein anderes Thema. Muss es wirklich auch in der zweiten Welle so sein, dass infizierte Kranke alleine und isoliert sterben müssen? Schon wieder? Wird Sterben mit Kontaktbeschränkungen jetzt zur Routine?
Um uns herum ist der Tod. Das zu sehen, hat mit Reife zu tun, mit innerer Stärke und mit dem Bewusstsein für die Endlichkeit. Sogar an Allerheiligen, das in manchen deutschen Bundesländern immer noch ein gesetzlicher Feiertag ist, gab es in den grossen Medien keinen einzigen Text, der sich mit den Corona-Toten beschäftigte. Sie sind schlicht nicht Teil unseres Lebens und Alltags, sondern allenfalls eine Grafik, eine Zahl. Es ging zu keinem Zeitpunkt der Pandemie darum, wie die Kranken besser sterben dürfen, sondern immer darum, wie die Gesunden besser leben können.
Eine wohltuende kleine Insel des Sprechens über Sterben und Tod war eine Sendung im Schweizer Fernsehen. Sie trug zwar einen albernen Titel («Nach mir die Würmer»), sorgte aber für einen der seltenen Momente, in dem man zum Beispiel mal einen Menschen sah, der unheilbar krank war und sagen durfte, dass er sich auf den Tod freute. Und der über die Umstände ein wenig fantasieren konnte.
Das ist zu selten, dass man auch einmal seine Todesvorstellungen verbalisieren darf und nicht immer nur die Angst davor. Wer krank ist und gezwungen, sein nahendes Ende mit sich selbst auszumachen, muss sich die passende Literatur zusammensuchen und hoffen, dass jemand in seinem Umfeld bereit ist, ein Gespräch darüber auszuhalten. Ansonsten herrscht Schweigen.
Aber Sterbenmüssen, -wollen oder -können muss nicht automatisch zur Sprachlosigkeit führen. Es muss möglich sein, das Sterben zu thematisieren. Schon allein deshalb, damit man auch in einem hoch industrialisierten Land darüber nachdenken kann, wie es von einem Hightechsterben zu einer würdevollen slow-dying-Kultur kommen kann.
Gerade jetzt, wo wieder viel gestorben werden wird.
Selam
Ihre Kiyak
Illustration: Alex Solman