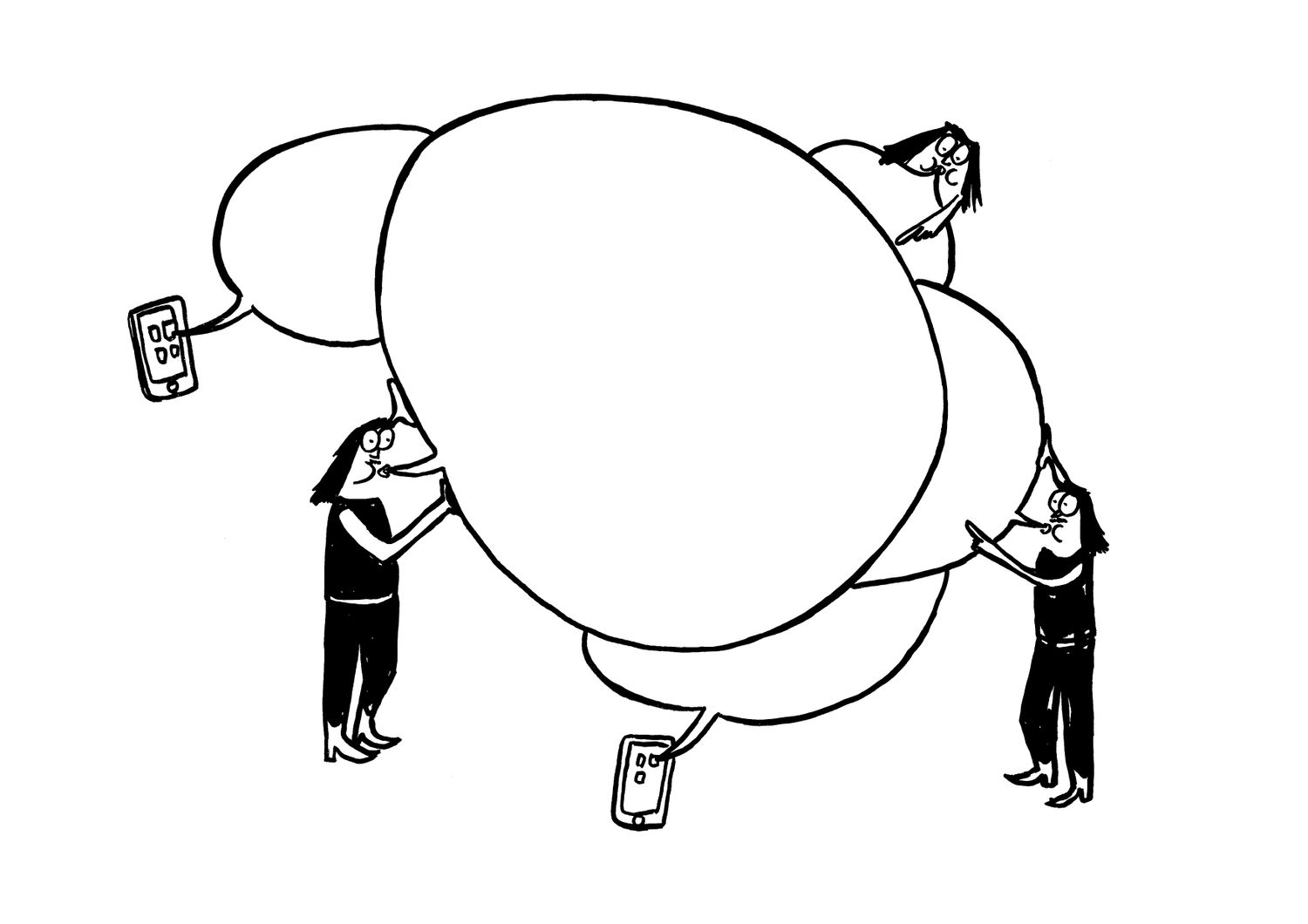
Wer oder was wird «gecancelt»?
Die aufgeheizte Debatte zur «Cancel-Culture» braucht Differenzierung und Deeskalation von allen Seiten. Und dennoch: Der Verlust von Privilegien ist nicht nur ein unangenehmer Nebeneffekt, er ist Kern emanzipativer Politik.
Von Franziska Schutzbach (Text) und AHAOK (Illustration), 14.08.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Derzeit wird wieder ausgiebig über politische Korrektheit diskutiert, das aktuelle Stichwort lautet Cancel-Culture. Verschiedene Autorinnen beklagen Meinungsverbote und Intoleranz, gerade auch von links. Selbst einflussreiche Intellektuelle, die des Konservatismus eher unverdächtig sind, schätzen die Lage offenbar als so problematisch ein, dass sie vergangenen Monat im «Harper’s Magazine» einen öffentlichen Brief publizierten, um sich gegen totalitäre Tendenzen und eine Pranger-Kultur im Netz auszusprechen.
Darin verzichten die 153 Unterzeichnenden auf polemische und pauschalisierende Schlagwörter wie «Redeverbote», «Political Correctness» oder «Zensur». Inhaltlich sorgen sie sich aber gleichwohl um das Verschwinden einer Diskussionskultur, in der verschiedene Meinungen und Perspektiven akzeptiert und respektiert werden; einer Gesprächskultur, in der auch Experimente und Fehler möglich sind.
Yascha Mounk, renommierter Politikwissenschaftler und ein dezidierter Kritiker rechtspopulistischer Tendenzen, die ihm zufolge die liberale Demokratie gefährden, sieht die öffentliche Debatte mittlerweile auch durch progressive Kräfte bedroht und hat deshalb ein Magazin gegründet («Persuasion») mit dem Ziel, die offene Gesellschaft zu bewahren und offene Debatten ohne Trollkultur zu fördern.
Die Frage also stellt sich: Was ist dran an der Besorgnis?
In der Tat ist das Diskussionsklima in den Social Media kein Sonntagsspaziergang. Es wird kräftig ausgeteilt, und zwar von allen Seiten. Deshalb ist es dringlich zu fragen, wie wir eigentlich miteinander kommunizieren und umgehen wollen, welche Regeln und Übereinkünfte es im öffentlichen Raum, auch im digitalen, geben muss.
Hate-Speech oder Beschimpfungen sind widerwärtig und falsch. Egal, von wem sie kommen, und egal, gegen wen sie gerichtet sind. Dass etwa die «Harry Potter»-Autorin J. K. Rowling sexualisiert angegriffen wurde, ist inakzeptabel. Auch wenn man ihre Äusserungen für transfeindlich hält – wofür sich plausible Gründe anführen lassen –, gibt das noch niemandem das Recht, selbst Grenzen zu überschreiten.
Franziska Schutzbach ist Geschlechterforscherin und Soziologin, freie Autorin und Speakerin. Seit vielen Jahren ist sie auch als politische Aktivistin tätig. Forschungs- und Themenschwerpunkte sind: Geschlechterverhältnisse, reproduktive Gesundheit und Biopolitik, rechtspopulistische Kommunikationsstrategien, Antifeminismus und Maskulismus. Zuletzt erschien von ihr «Politiken der Generativität. Reproduktive Gesundheit, Bevölkerung und Geschlecht». Sie ist ausserdem Mitherausgeberin des Bandes «I Will Be Different Every Time. Schwarze Frauen in Biel. Femmes noires à Bienne. Black Women in Biel».
Aber über das Thema Hate-Speech hinaus gefragt: Haben wir ein allgemeines Intoleranzproblem seitens der sogenannt progressiven Kräfte?
Es gibt dazu sehr unterschiedliche Einschätzungen. Eine pauschale Antwort auf die Frage nach der Cancel-Culture scheitert bereits an der Tatsache, dass die Ausgangslage je nach Land extrem unterschiedlich ist. Obwohl genau dies ständig gemacht wird: Wir können US-amerikanische Debatten nicht einfach umstandslos auf hiesige Verhältnisse übertragen.
Ferner kann die Frage, welche Anliegen wie legitim sind, in der Regel nicht einfach objektiv definiert werden. Schon deshalb, weil viele Perspektiven in den medialen oder politischen Institutionen unterrepräsentiert oder gar nicht vertreten sind: Sie sind «sozusagen seit ihrer Geburt gecancelt», weil sie keine Stimme haben. Die Debatten, um die es geht, werden eben nicht einfach als Kämpfe unter Gleichrangigen um das bessere Argument ausgetragen. Sie transportieren selbst gesellschaftliche Schieflagen mit. Ausserdem kann eine Forderung oder eine Sichtweise grundsätzlich legitim und berechtigt sein, andererseits in der Art, wie sie vorgebracht wird, dogmatische Elemente enthalten.
Was die Debatten also dringend brauchen, ist Differenzierung – und die Anerkennung von Komplexität.
Selbstkritik – auch auf der Opferseite
Natürlich kann und soll dabei auch darüber diskutiert werden, inwiefern bei den emanzipatorischen Kämpfen der Gegenwart in konkreten Fällen übers Ziel hinausgeschossen wird. Selbstverständlich soll es möglich sein, sowohl die inhaltlichen Forderungen als auch die Formen des Protests zu kritisieren. Es ist wichtig und legitim zu fragen, inwiefern auch progressive Kräfte manchmal dogmatische oder einseitige Sichtweisen propagieren, in denen manichäische Weltbilder zirkulieren, die ein Richtig-oder-falsch-Denken nahelegen.
Gerade auch die gesellschaftliche Linke ist gefragt, Einspruch zu erheben, wenn Ambivalenzen und plurale Sichtweisen zu wenig Raum haben. Das Denken der Differenz, Adornos Forderung, ohne Angst verschieden sein zu können, gilt es immer wieder von neuem zu prüfen. In diesem Sinne sind Statements wie der «Harper’s»-Brief wertvolle Debattenbeiträge – auch für diejenigen, die mit vielen Inhalten nicht einverstanden sind.
Oder anders gesagt: Es braucht die Forderung nach Selbstkritik und nach einer kontinuierlichen Prüfung der eigenen Axiome nicht nur in Richtung der sogenannten Mächtigen und Privilegierten; es kann auch aus der Sicht von Unterdrückten oder weniger Privilegierten keine fixen und für immer gültigen Positionen oder Perspektiven geben.
Allerdings – und das geht in der aktuellen Debatte allzu oft vergessen – geht das Problem sehr viel tiefer.
Legitimer Boykott oder «Hexenjagd»?
Unverkennbar dient die Behauptung, die emanzipatorischen Kämpfe der Gegenwart hätten allgemein eine antitolerante Tendenz, auch als konservatives oder rechtes Instrument, um bestehende Machtstrukturen zu erhalten und notwendige Gerechtigkeitsdiskussionen zu torpedieren. Pauschale Thesen, wonach progressive Kräfte und Minderheiten die Gesellschaft mit Verboten und Boykotten belegen oder «Hexenjagden» veranstalten, vertragen sich schlecht mit der Empirie einer vielstimmigen Diskussion.
Nehmen wir ein Beispiel: Sollen Bücher oder Texte von umstrittenen Autorinnen boykottiert, aus Lehrplänen oder Uni-Seminaren gestrichen oder aus Kindergärten entfernt werden? Was machen wir mit den kolonialrassistischen Klischees in «Tim und Struppi»-Comics? Mit dem N-Wort in «Pippi Langstrumpf»-Büchern? Wie verfahren mit den Rassentheorien in Texten von Immanuel Kant? Schaut man sich die konkreten Vorschläge an, wie mit solchen Texten, Passagen, Bildern oder auch mit Denkmälern umgegangen werden soll, wird schnell klar, dass die Konzepte extrem unterschiedlich sind. Statt einer Übereinkunft darüber, dass es das einzig Richtige wäre, diese zu «verbieten», gibt es stark divergierende Ideen und Forderungen.
Und noch etwas anderes ist von grundlegender Bedeutung: Diejenigen, die mit ihren Deutungsansprüchen, Perspektiven und Millionen Followern lange Zeit relativ unwidersprochen blieben, neigen manchmal dazu, heftige Kritik und Kontroversen vorschnell als Ausdruck von Zensur abzutun. Dabei sind Kontroversen gerade ein notwendiger Bestandteil pluraler Gesellschaften.
Darin liegt eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich, und um diese Ambivalenz besser zu verstehen, braucht es einen kleinen Umweg über die Sozialwissenschaft.
Erst Veränderung erzeugt Konfrontation
Forscherinnen wie Naika Foroutan, Aladin El-Mafaalani und andere sind der Auffassung, dass die zunehmenden Konfrontationen auch auf emanzipatorische Entwicklungen verweisen. Gemäss ihnen sind sie Ausdruck einer Demokratisierung, davon also, dass sich heute mehr und vor allem unterschiedliche Menschen am politischen Diskurs beteiligen.
Die offenen Konflikte – zum Beispiel um Begriffe, Sprache, den Bildungskanon, Statuen, Repräsentation und Erinnerungskultur, aber auch um Polizeigewalt und Einbürgerungspraxen, um strukturellen Rassismus oder um Gewalt gegen Frauen (#MeToo) – sind ein Indikator dafür, dass sich tradierte Machtstrukturen verändern, dass Ungleichheit und Diskriminierung tatsächlich abnehmen.
Foroutan bezieht sich dabei auf das in der Soziologie bekannte Tocqueville-Paradox: Es kommt nicht in dem Moment zu Auseinandersetzungen, in dem die Ungleichheit besonders gravierend ist – in einer Situation unhinterfragter Unterdrückung ist es nämlich schwierig, Ungleichheit anzuprangern, Kritik zu formulieren und Forderungen zu stellen. Es kommt vielmehr dann zu Auseinandersetzungen, wenn mit Reformen begonnen wurde und bereits mehr Partizipation möglich ist. Tatsächlich sind heute Minderheitenanliegen bekannt, von denen vor wenigen Jahren kaum jemand wusste. Je mehr Sichtbarkeit und Legitimität diese Anliegen erhalten, desto eher nimmt auch das Bewusstsein dafür zu, wenn sie missachtet werden.
Anders gesagt: In dem Moment, in dem wir mehr Teilhabe und Gleichheit haben, erscheint die Gesellschaft paradoxerweise erst einmal besonders ungerecht. Umso lauter und wütender fallen entsprechend Empörung, Kritik und die Forderungen nach Veränderung aus.
Die gute Nachricht also lautet: Die vielen Kontroversen der Gegenwart bedeuten nicht, dass alles immer schlechter wird, im Gegenteil. Sie sind auch ein Effekt zahlreicher Fortschritte beim Kampf um eine gerechtere, inklusivere Gesellschaft.
Daneben gibt es aber auch die – je nach Perspektive – schlechte Nachricht: Die Auseinandersetzungen um Gerechtigkeitsfragen werden bis auf weiteres nicht ab-, sondern eher zunehmen.
Backlash-Phasen der Emanzipation
Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Mehr Teilhabe führt nicht zu mehr Harmonie, sondern zu mehr Verteilungs- und Interessenkonflikten. Auch deshalb, weil die mit neuem Selbstbewusstsein vorgetragenen Kritiken und Forderungen zu Gegenreaktionen führen. Auf Kritik an Rassismus wird oft mit Rassismus reagiert. Je offensiver Sexismus skandalisiert wird, desto offensiver tritt dieser zutage – wie man an zahlreichen Beispielen von extremem Frauenhass im Netz sehen kann. Emanzipationsprozesse sind von enormen Spannungen begleitet, und sie finden auch nicht linear statt. Nicht selten gehen sie einher mit Backlashs und heftigen Gegenreaktionen.
Daraus folgt zweierlei. Das Erstarken der Rechten in Europa und anderswo und die damit einhergehenden realen Gefahren, dass Errungenschaften wie das Recht auf Abtreibung oder anderes wieder rückgängig gemacht werden, sollten nicht verharmlost werden.
Gleichzeitig sollten diese Tendenzen aber auch nicht dazu verleiten, Fortschritte zu übersehen und Durchbrüche kleinzureden. Auf progressiver Seite wird manchmal eine Art Katastrophismus gepflegt, ein Pessimismus, der keinerlei emanzipatorischen Fortschritt zu honorieren bereit ist, solange nicht der ganz grosse Umschwung eintritt. So aber macht man die bereits erzielten Erfolge unnötig klein.
Ich habe das, durchaus auch selbstkritisch, in meinem Buch über Rechtspopulismus beschrieben: Ausschliesslich um die noch existierenden Missstände zu kreisen wie Motten um das Licht – also etwa dem Erstarken der Rechten mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung zu verleihen, als es verdient –, birgt die Gefahr, sie dadurch noch grösser zu machen. Vor allem kann Untergangsstimmung die eigene Handlungsfähigkeit und auch Stärke unterminieren. Sich aus der marginalisierten Perspektive einseitig auf einen Standpunkt der Ohnmacht, der Diskriminierung oder der Unterdrückung zu berufen, hiesse am Ende, genau die Position zu reproduzieren und zu akzeptieren, die einem von den herrschenden Verhältnissen zugewiesen wird: eine Position der Marginalität. (Mehr dazu in meinem Text «Wider die bequeme Weltuntergangslust».)
Doch auch hier gilt wiederum: Würde es allein darum gehen, dass emanzipatorische Bewegungen durch Kritik und Selbstreflexion die Fallen vermieden, in die andere sie nur zu gerne treten sähen, wäre die Sache vergleichsweise einfach.
Die «heimlich Mächtigen»
Der zentrale Punkt ist vielmehr: Die Anliegen von marginalisierten Menschen wurden zu allen historischen Zeiten für überzogen oder extrem gehalten. Schweizerinnen etwa wurden bei ihrem Kampf ums Stimmrecht jahrzehntelang beschuldigt, die Gesellschaft zu gefährden und zu spalten. Heute wirken ihre damaligen Forderungen wie das Normalste der Welt. Wenn jene, die als weniger wert gelten, mitreden wollen, wird das zunächst nicht als gerechter Ausgleich, sondern als Frechheit, als Umkehrung der Verhältnisse, als anmassend und übertrieben empfunden – oder eben als «Terror der Minderheiten». Wissenschaftliche Studien scheinen das zu stützen: So wird etwa der tatsächliche Frauenanteil in einer Gruppe von vielen Männern überschätzt, und wenn Frauen gleichermassen mitreden, wird das schnell als Dominanz wahrgenommen.
In gesellschaftlichen Debatten gibt es ein ähnliches Muster: Wenn Kritik ausgerechnet von jenen formuliert wird, die in der gesellschaftlichen Hierarchie eher unten stehen (Frauen, Migrantinnen, People of Color usw.), wird das von manchen, die sich – oft unbewusst – als die Überlegenen betrachten, als eine Schmach erlebt. Manche Menschen bewältigen diese Erschütterung, wie etwa die Ressentiment- und die Autoritarismus-Forschung zeigen, indem sie die Schwachen zu Übermächtigen emporstilisieren.
Zentral ist dieser Widerspruch etwa im Antisemitismus: Das, was man als ohnmächtig und minderwertig betrachtet, wird gleichzeitig als das heimlich Mächtige imaginiert. Ähnliche Mechanismen beobachten wir heute im Antifeminismus oder im Anti-Political-Correctness-Diskurs: Frauen oder Minderheiten werden lächerlich gemacht und abgewertet. Gleichzeitig unterstellt man ausgerechnet ihnen eine totalitäre Übermacht und redet von einer «Genderdiktatur» und von «Sprachpolizei».
Die vermeintlich hinterlistige Stärke der Schwachen ist also ein verschwörungsähnliches Narrativ, das die schwierige Erfahrung von gesellschaftlichem Wandel und Verunsicherung erträglich machen soll.
Der Männlichkeitsforscher Robert Claus hat das Phänomen am Beispiel der antifeministischen Männerrechtsbewegung wie folgt beschrieben: Die Verunsicherung, die viele Männer aufgrund des Wandels der Geschlechterverhältnisse erfahren, ist ein Gefühl der Schwäche, das in vorherrschenden Männlichkeitsidealen, also in der Idee von Stärke und Überlegenheit, eigentlich keinen Platz hat. Diese Verunsicherung ist für manche Männer nur dann legitim und erträglich, wenn sie sich einem schier übermächtigen Gegner gegenübergestellt sehen («Genderdiktatur») – schwach darf man nur angesichts eines scheinbar unbesiegbaren Gegenübers sein.
All das bedeutet nicht, dass es nicht auch reale Situationen gibt, in denen Männer Unrecht erfahren, etwa im Zuge eines Sorgerechtsstreits oder falscher Anklagen in Bezug auf sexualisierte Gewalt. All das gibt es. Nur: Von einer Machtübernahme der Frauen, einer Umkehrung der Verhältnisse oder von Totalitarismus im eigentlichen Wortsinn sind wir, wenn wir berücksichtigen, wer tatsächlich an den Hebeln der Macht sitzt, weit entfernt.
Das ist die eine Seite.
Andererseits hat die Behauptung, «politisch Korrekte» wollten unsere Freiheit einschränken, auch einen wahren Kern.
Ein Verlust ist ein Verlust
In seinem bemerkenswerten Aufsatz «‹Political Correctness› als Kern der Politik. Mit Nietzsche gegen die neue Rechte» (2020) entwickelt der Politikwissenschaftler Karsten Schubert folgendes Argument: Es geht bei Gerechtigkeitsprozessen tatsächlich um einen Kampf um Privilegien – und Emanzipation bringt für manche auch Privilegienverluste und Einschränkungen mit sich. Diese Einsicht, so Schubert, sollte nicht beschönigt werden. Gemeint sind mit den Privilegienverlusten und Einschränkungen aber nicht Fälle von Unrechtsbehandlung, wie sie einzelne Männer im Zuge von Sorgerechtskonflikten erfahren. Gemeint ist, dass bei der Umsetzung von Gleichstellung fortbestehend informelle Privilegien und Freiheiten, die die Freiheit anderer einschränken und strukturelle Diskriminierung verursachen, aufgegeben werden müssen.
Wenn mehr Frauen in Chefpositionen oder Parlamente kommen sollen, dann heisst das, dass weniger Männer solche Positionen innehaben können. Wenn Menschen, die vorher unbescholten «M***kopf» sagten oder Frauen im Club an den Hintern fassten, das nun nicht mehr unbescholten tun können, wird ihnen tatsächlich etwas weggenommen: nämlich die Möglichkeit, allein zu bestimmen, welche Begriffe adäquat sind und welche nicht, welches Verhalten angemessen ist und welches nicht.
Wer bisher nicht reflektieren musste, was er sagte oder wie sie sich verhielt, erlebt das verständlicherweise als Einschränkung. Weil es eben auch eine ist! Die Herstellung von Gerechtigkeit, Inklusion und Teilhabe ist nicht einfach ein formaler Verwaltungsakt, über den sich alle freuen und von dem alle gleichermassen profitieren. Quoten zum Beispiel bevorzugen und fördern bestimmte Menschen. Natürlich bedeutet das eine (temporäre) Schlechterstellung derjenigen, die nicht in die Quote fallen. Das ist aber nicht antiliberal, sondern – wie auch juristisch festgestellt wurde – angesichts der vorherrschenden und historischen Unterrepräsentation bestimmter Menschen menschenrechts- und verfassungskonform. Quoten dienen der tatsächlichen Durchsetzung von Antidiskriminierung und Gleichheit. Sie sind verhältnismässig, sofern sie auf der nachweislich strukturellen Benachteiligung einer bestimmten Gruppe in bestimmten Bereichen beruhen.
Frauen und Minderheiten beanspruchen Mitsprache und Gleichberechtigung. Und sie wollen nicht nur ein Stück des Kuchens, sie wollen mitbestimmen über die Rezeptur des Kuchens, sprich: Die Regeln des Zusammenlebens und die Verteilung von Macht, Einfluss und Ressourcen sollen gleichberechtigt ausgehandelt werden. Wenn aber mehr Menschen am Tisch sitzen und über das Rezept reden, müssen diejenigen, die zuvor aufgrund von diskriminierenden Strukturen allein da waren, Platz machen, sich einschränken, Redezeit und Ressourcen abgeben. Das ist zwar schmerzhaft, ist aber angesichts der nachweislichen Ungleichheitsverhältnisse keine anmassende oder «autoritäre» Forderung; die Herstellung tatsächlicher – nicht bloss formaler – Gleichheit ist ein Kernauftrag demokratischer Verfassungen.
Oder zugespitzt formuliert: Der Verlust von bestimmten Privilegien ist kein unangenehmer Nebeneffekt, sondern ein Kern emanzipativer Politik (Schubert). Man sollte das nicht verharmlosen oder beschönigen. Es reicht deshalb auch nicht, Political Correctness als konservativen Kampfbegriff, als reine Erfindung oder Konstruktion abzutun. Bei dem, was gerne als Political Correctness delegitimiert wird, handelt es sich oft um reale und legitime politische Gleichstellungsziele. Diese müssen also auch als solche verteidigt werden.
All das entlässt progressive Kräfte oder diejenigen, die Marginalisierung und Gewalt erfahren, aber nicht aus der Verantwortung, selbst bestimmte Regeln in diesem Kampf um Gerechtigkeit einzuhalten und für die Einhaltung dieser Regeln zu sorgen. Es entlässt sie nicht aus der Verantwortung, selbstkritisch immer wieder neu die Wahl der eigenen Mittel zu reflektieren.
PS: Während ich diesen Text schreibe, hat der «Welt»-Kolumnist Don Alphonso die Politikwissenschaftlerin und Rechtsextremismus-Expertin Natascha Strobl in mehreren Texten mittels Verzerrungen und auch Falschmeldungen an den Pranger gestellt. Was folgt, sind unzählige Gewaltdrohungen gegen Strobl aus rechten und rechtsextremen Kreisen. Ihre Kinder werden angegangen, ihr verstorbener Vater verspottet. Das war dem Chefredaktor der «Welt»-Gruppe, Ulf Poschardt, keinen Hinweis wert. Die Kritik an Don Alphonso hingegen geisselte er als «Cancel-Culture».