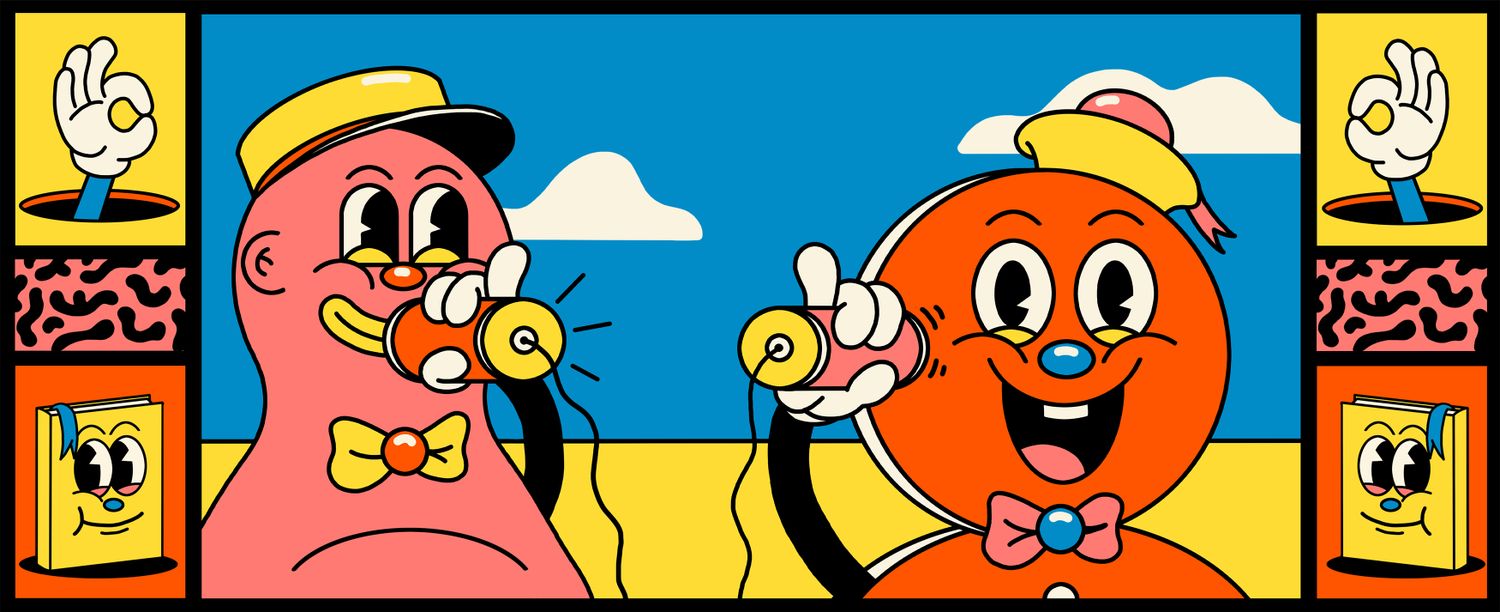
Jetzt sag doch was
Charakteren eine eigene Stimme zu verleihen, gehört zur hohen Kunst der Literatur. Aktuelle Neuerscheinungen zeigen: Daran scheitern auch namhafte Autoren.
Von Daniel Graf (Text) und Yeye Weller (Illustration), 24.07.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Wenn die Stimme nicht stimmt, stimmt der ganze Text nicht. Wie literarische Figuren sprechen, verrät immer auch etwas über die Qualität eines Werks. Packende Dialoge und eine unverwechselbare Stimme machen einen Charakter unvergesslich, missratene Wortwechsel und unglaubwürdige Selbstgespräche hingegen verhindern echtes Kopfkino, selbst wenn die Autorin einen tollen Stoff zu erzählen hat.
Was aber macht einen literarisch «guten» Dialog aus? Und woran lässt sich das erkennen?
Ein Erklärungsversuch anhand deutschsprachiger Gegenwartstexte – featuring Arno Camenisch, Monika Helfer, Tom Kummer, Andreas Neeser und Regula Portillo.
1 Raum für Leser
Wozu sind Dialoge im Roman überhaupt da? Um die Figuren zu charakterisieren? Die Handlung voranzutreiben? Eine Atmosphäre zu kreieren?
Wie wichtig sämtliche dieser Funktionen sind – und wie viel das mit dem Verhältnis zwischen Text und Leserin zu tun hat –, all das demonstriert Andreas Neeser in seinem Roman «Wie wir gehen» schon auf den ersten zwei Seiten.
Wie schnell die heute bauen, hast du gesagt. Ein paar Wochen und der Kasten steht. Direkt vor eurer Nase.
Ich bin aufgestanden und habe mich neben dich gestellt.
Du solltest endlich Vorhänge kaufen, hast du gesagt.
Das da drüben ist die Schlafzimmerseite, Vater.
Noch wissen wir nicht einmal, wer das Ich dieser Erzählung ist. Aber dass die Person mit ihrem Vater spricht, erfahren wir, ganz beiläufig, durch die Anrede. Und beiläufig wird sich erschliessen, dass die Ich-Stimme einer Frau gehört. Ebenso en passant, wie uns der Roman beibringt, dass wir hier besser nicht auf Anführungszeichen warten.
Vom scheinbar Belanglosen aus wird dann, schneller noch als jener Neubau, der Konfliktraum eines ganzen Familienlebens hochgezogen:
Minergie, habe ich gesagt.
Grossartig. Ein Klotz vor dem Kopf, aber immerhin Minergie.
Das spart Heizkosten. Und schont die Umwelt.
Wers glaubt. – Reine Geldmacherei ist das.
Und das Lamm? Wars wieder zu wenig durchgebraten?
Also das Gratin –
Immerhin, sagte ich.
Wie wir eben miteinander reden.
Aber dann habe ich noch etwas gesagt.
Und weisst du was, Geburtstagskind? Du kannst stolz sein, habe ich gesagt. Ehefrau, Tochter, Enkelkind. Ein eigenes Haus und ein langes Berufsleben. Ich finde, junger Mann, du hast einiges richtig gemacht in deinem Leben. Und das mit den Tierchen – das hast du jetzt auch im Griff.
Dann habe ich dich umarmt. Zum ersten Mal. An deinem dreiundachtzigsten Geburtstag, Vater.
Und jetzt weiss ich auch nicht weiter.
Die Sprachlosigkeit zwischen Vater und Tochter, ihre Entfremdung, aber auch der Wunsch, beides endlich zu überwinden, bevor es unwiderruflich zu spät ist: Um ganz unaufdringlich Dringlichkeit zu schaffen, braucht Neeser nicht einmal einen Erzählerkommentar. Alles kann in dieser Anfangsszene auf engstem Raum geschehen – weil der Autor der Leserin Platz lässt. Statt das Rätselhafte, noch Unverstandene durch beflissene Erklärung wegzuschwafeln, verleitet er lieber zum aktiven, beteiligten Lesen. Und der virtuoseste Passus in dieser Anfangsszene ist der scheinbar banalste:
Also das Gratin –
Immerhin, sagte ich.
Nein, streng genommen hat der Vater die Frage nach dem Lammbraten nicht beantwortet, er beurteilt, rein wörtlich, nicht mal das Gratin. Aber aus dem «Immerhin» der Tochter erschliesst sich die Antwort auf beides.
Das führt bereits auf Entscheidendes: das Unausgesprochene zwischen den Zeilen; und die Dynamik zwischen den Figuren. Gute Dialoge schütten diesen Zwischen-Raum nicht zu, sie reissen ihn auf. Weil alles, was Lesen zu einem aktiven, gar identifikatorischen Erlebnis macht, sich hinter diesen Türen abspielt.
Bevor es aber so weit kommt, haben Leser in der Regel selbst ein paar unausgesprochene Fragen an den Text. Und die kategorischste dabei lautet: Ist das alles überhaupt authentisch? Sind das realistische Figuren? «Glaube» ich dem Autor die Szene?
Das sind keine trivialen Fragen. Denn Empathie, gar Identifikation kommt letztlich nicht aus ohne das Gefühl, es könnte theoretisch auch mir so ergehen – unter anderen Umständen, in einem anderen Leben, an einem anderen Ort dieser Welt. Was heisst das für literarische Dialoge?
Zweimal Probe aufs Exempel bei Andreas Neeser.
Szene 1 folgt fast direkt auf die Einleitungspassage. Mona bittet ihren 83-jährigen Vater, ihr seine Lebensgeschichte in ein Diktiergerät zu sprechen: Sie wisse fast nichts über ihn, und um ihn zu kennen, müsse sie doch erfahren, wie er zu dem geworden sei, was er ist.
«Keine Psychologie, Vater, bloss nicht. Ich will die Geschichte.»
«Die ist schnell erzählt», sagte er. «Viel ist da nicht hängen geblieben.»
«Du tust es?»
«Wenn es sein muss.»
«Es muss sein», sagte sie.
Monas Vater liess sich Zeit mit seiner Geschichte. Dann aber brachte er ihr das Diktiergerät zurück. Ohne sichtbare Regung drückte er es ihr in die Hand: «Siebenundvierzig Minuten für vierundzwanzig Jahre», sagte er, «mehr ist mir nicht eingefallen. Hab ich dir ja gesagt. Viel Gestotter, viele Pausen, man muss auch mal nachdenken beim Reden. So bleibt am Ende wenig von einem Leben. Sehr wenig.»
Szene 2: Mona und ihre Tochter beim Abendessen, Noëlle ist kürzlich vom Besuchswochenende bei ihrem Vater zurückgekehrt.
«Irrgänger», sagte Noëlle.
«Irrgänger? Was soll das sein?»
«Das frage ich dich.»
«Keine Ahnung. Gibt es das Wort überhaupt?»
«Seit heute Morgen», sagte Noëlle. «Unter der Dusche.»
Etwas blitzte in ihren Augen.
«Und?»
«Einer, der in die Irre geht. Vor allem aber ein Irrer, der geht. Oder schon gegangen ist. Und besser wegbleibt.»
Und dann, wenige Zeilen später:
«Sag nicht man, Mama! Das mit der Liebe ist dein Problem, nicht meins.»
«Und welches ist deines?»
«Das hat sich erledigt. Abgeduscht. In der Kanalisation. Es ist weg.»
«Väter sind nie weg, Noëlle.»
«Meiner ist eben was Besonderes. Und wenn er nicht in der Kanalisation ist, dann ist er meinetwegen in der Wüste.»
Welche dieser beiden Szenen ist «authentisch»? Beide? Eine? Und was heisst «authentisch» in der Literatur?
2 Glaubwürdig, nicht authentisch
Kleiner Umweg über ein Gedankenexperiment.
Ein Mann spricht auf der Strasse eine wildfremde Person an: «Verzeihen Sie bitte, wie viel Uhr ist es?»
Nun gibt es, je nach Genre, Stil und Setting, in der Literatur unzählige Möglichkeiten, wie die Antwort lauten könnte. Zum Beispiel:
«Es ist schon lange fünf vor zwölf.» (Dystopie)
«Zeit der Abrechnung, Kleiner!» (Actionkino)
«Zeit für einen Kaffee?» (Lovestory)
«Seit wann siezen wir uns, Mike?» (Psychothriller)
Nur eines ist ziemlich sicher literarisch die falsche Antwort: die richtige Uhrzeit, und dann Ende des Gesprächs.
Will heissen: Gelungene Dialoge in der Literatur (und natürlich im Film) verlaufen nie exakt so, wie sie «im wirklichen Leben» verlaufen – warum sollte man sich das Ereignislose und tausendfach Gehörte noch einmal lesend antun? Das Wahrscheinlichste ist selten auch das Aufregendste. Oder wie es die Autorin Katharina Hacker in einem ihrer Minuten-Essays ausdrückt: «Das Authentische neigt zu Socke und Trainingshose.»
Deshalb muss die Literatur der Wirklichkeit nachhelfen – ohne dass die Plausibilität darunter leidet. Denn Literatur beschäftigt uns nur dann, wenn sie mit literarischen Mitteln ein reales menschliches Problem erfasst. Das geht weder mit Wirklichkeitsignoranz noch mit plattem 1:1-Realismus. «Die ästhetische Nachahmung», so der Literaturwissenschaftler Peter-André Alt, «bedeutet keine einfache Imitation, sondern den Umbau der Wirklichkeit.»
Mit dem sogenannten «Authentischen» also braucht man Romanen eher nicht zu kommen – sehr wohl aber mit dem Anspruch auf Glaubwürdigkeit.
Was heisst das für Szene 1 oben bei Neeser? Das Gesprächsthema – unaufgearbeitete Vergangenheit – ist eine familiäre Standardsituation; das Diktiergerät hingegen eine eher unkonventionelle Lösungsmethode (und eine literarisch ausgesprochen produktive Idee).
Eine ähnliche Spannung zwischen Allgemeinem und Besonderem prägt die Figurenrede: Was hier verhandelt wird, könnte in so gut wie jeder Familie der Welt Tischgespräch sein. In kaum einer allerdings werden Vater und Tochter sich dabei so zielstrebig und prägnant die Bälle zuspielen – bis hin zum recht philosophisch formulierten Cliffhanger «So bleibt am Ende wenig von einem Leben». Authentisch ist das nicht – aber ausgesprochen glaubwürdig. Denn der Autor legt den Figuren keinen einzigen Satz in den Mund, den sie nicht tatsächlich sagen könnten. Sie finden halt etwas häufiger als im echten Leben direkt die prägnanteste Formel dafür.
So funktioniert literarische Verdichtung im Dialog: Die Figurenrede weicht ab von der Wirklichkeit alltäglicher Dialoge – aber nur, um die zwischenmenschlichen Dynamiken dahinter samt ihrer emotionalen Amplitude umso präziser einzufangen.
Wie verhält es sich mit Szene 2, in der Noëlle über den «Irrgänger» sinniert?
Der Eindruck stellt sich ein, hier sei mehr vom Autor zu hören als von der Teenagerin. Neeser hat es auf eine Parallele zwischen den beiden Vater-Tochter-Konstellationen seines Plots abgesehen und spielt sein titelgebendes Leitmotiv «gehen» weiter durch. Die «Irrgänger»-Spielerei verirrt sich dabei selbst in einen ziemlich aufgesetzten Sound. Denn auch melodramatisch veranlagte Jugendliche eröffnen ein ernstes Gespräch am Esstisch wohl nicht mit einer theatralisch eingeworfenen Wortschöpfung; um dann am Ende gleich noch die anfangs erwähnte Dusche zur pathetischen Metapher umzubauen.
Das Interessante daran: Neeser scheitert hier auf hohem Niveau. Schlechte Literatur erkennt man unter anderem daran, dass die Figuren Dinge zueinander sagen, die sich für die Dialogpartner eigentlich von selbst verstehen: völlig überflüssige Infos in der Welt der Charaktere; aber Infos, die der Autor seiner Leserin für das Verstehen der Handlung zukommen lassen will – und es auf elegantere, beiläufige Weise nicht schafft. Der Dialog treibt dann nicht mehr eine Dynamik zwischen den Figuren voran; er ist vielmehr pures Info-Management.
Bei Neeser hingegen herrscht hier momenthaft das gegenteilige Problem: Form-Management. Der Autor mit seinem sprachlichen Gestaltungswillen schiebt sich vor die Figur – und rückt sie damit eigenartig fern. Man spürt die künstlerische Absicht – und schon ist die Stimme verstimmt.
Es spricht allerdings für den Rang dieses Autors, dass auch dies sich schon nach wenigen Zeilen wieder «erledigt» hat. – «Abgeduscht.»
3 Drive
Auch Regula Portillo hat mit «Andersland» einen eindringlichen Familienroman vorgelegt, der sich zwischen den Achtziger- und den Nullerjahren und zwischen zwei Kontinenten aufspannt. Matilda lebt bei ihrem Vater, Pascal, in einem Schweizer Dorf; ihre Mutter in Mexiko hat sie noch nie gesehen. Es sind ihr Onkel Tobias und sein Partner Michael, die dem kleinen Mädchen quasi zum zweiten und dritten Elternteil werden. Viele im Dorf allerdings haben mit beidem ein Problem: mit einem schwulen Paar; und mit einem alleinerziehenden Vater, der deshalb im Dauerverdacht steht, in Sachen Erziehung und Fürsorge alles falsch zu machen.
Davon erzählt Pascal seinem Arbeitskollegen Andreas bei der Mittagspause in der Fabrik: Nein, er komme nicht zum Firmenjubiläum, denn er habe die Blicke der Leute so satt. Wenn er zum Beispiel Matilda mit einem Pferdeschwanz zum Kinderturnen schicke, komme sie mit geflochtenen Haaren zurück. Und die Nachbarin, wenn sie vorschlägt, für Matilda eine Geburtstagsfeier zu organisieren, lasse gleich noch möglichst beiläufig die Bemerkung fallen, «dass auch bald Ostern sei».
«Die Leute meinen es doch nur gut, Pascal.»
«Ja, ich weiss. Aber es fühlt sich an, als würde man mir nicht zutrauen, meiner Aufgabe gerecht zu werden. Verdammt, Andreas, ich weiss, wann Ostern ist, und mein Pferdeschwanz ist gut. Oder zumindest gut genug.»
«Du hast insofern recht, als es einer alleinerziehenden Mutter vermutlich anders ergehen würde. Aber jeder Mensch trägt nun mal einen Rucksack mit sich herum und stolpert hin und wieder durch die Tage. Wetten, dein Bruder würde, was die Andersbehandlung angeht, gern mit dir tauschen?»
Ist das der Duktus zweier Fabrikarbeiter in den Achtzigerjahren? Oder doch eher der diskurssensible Konversationston 2020, der sorgsam konjunktivisch abwägt, mit viel «zumindest», «vermutlich» und «insofern, als»? Viel wichtiger noch: Warum darf die Leserin nicht selber merken, wie «es sich anfühlt» für Pascal? «Verdammt, Andreas, ich weiss, wann Ostern ist» – damit wäre doch alles gesagt.
Andreas ist hier ebenfalls etwas zu redselig geraten – oder die Autorin einem falschen Realismus gefolgt. Gut denkbar, dass der Kollege «im echten Leben» zu Floskeln greifen würde. Aber im Roman wird aus der ungebrochen übernommenen Redensart mit dem Rucksack halt kein guter Dialog.
Kurz: Die Szene hat zu viele Wörter und zu wenig Leerstellen, die die Leserin selber ausdeuten muss. Das nimmt dem Passus den Drive und dem Leseerlebnis die Intensität – kurzzeitig. Denn nicht nur Portillos Roman mit seinem starken Plot wird über das Eingangskapitel hinaus deutlich an erzählerischer Kraft gewinnen. Auch Andreas und Pascal kommen noch rechtzeitig vor Ende ihrer Mittagspause in Fahrt.
«Du kannst dich beschweren, so viel du willst. Aber Selbstmitleid bringt dich nicht weiter.»
«Ist ja gut.»
«Heisst das, du kommst zum Firmenjubiläum?»
«Du kannst mich mal.»
Apropos Drive. In Tom Kummers neuem Roman «Von schlechten Eltern» gibt es ebenfalls einen alleinerziehenden Vater. Er heisst genau wie der Autor selbst, teilt mit ihm auch noch mehr als nur den Namen und hat – eine Fortführung von Kummers vorigem Roman «Nina & Tom» – die Liebe seines Lebens an den Krebs verloren.
Wenn Tom nachts Taxi fährt, vorwiegend im Auftrag von Geschäftsreisenden aus afrikanischen Ländern, lenkt er seine Fahrgäste auch zielsicher Richtung Smalltalk – Dialoge gehören zum Service. Und Tom Kummer liefert.
[Der Fahrgast] starrt jetzt auf das Foto am Armaturenbrett.
Ist das Ihre Familie?
Ja. (...)
Und Ihre Frau ist bei den Kindern, während Sie arbeiten?
Nein. Sie ist tot.
Der Afrikaner schaut zur Seite, lockert seinen Krawattenknoten.
Das tut mir leid.
Für einen Moment sehe ich ihn an seiner Krawatte von einem Baum hängen. Vielleicht ist es die Langeweile.
Sie sind alleinerziehender Vater?
Ja.
Keine Frau in Aussicht?
Er spielt weiter mit seiner Krawatte.
Ich bin nicht allein, sage ich und studiere die roten Muster auf dem zu breiten Ding.
Ich halte mir eine Schweizer Hausangestellte, die ich übers Internet buche.
Stille. Der Senegalese hustet, als ob er sich verschluckt hätte.
Dann beugt er sich vor, Schweiss auf seiner Stirn, er legt die Hand an meine Rückenlehne.
A Swiss maid, really?
Ja, sieht sogar aus wie meine verstorbene Frau.
So geht das in einer Tour; bei jeder Tour. Kummers Taxi-Driver ist ein hemmungsloser Storyteller: für seine Fahrgäste; für sich. Um wach zu bleiben. Und um die existenzielle Leere, die in sein Leben eingezogen ist, mit umso krasserem Stoff aufzufüllen. Wahrheitstreue ist ihm dabei sekundär. Wenn der Ich-Erzähler schon in dieser Auftaktszene verrät: «Ich lüge ihn an. Ich lüge sie alle an», stecken wir als Leser längst im klassischen Kreter-Paradox, in dem die Lüge und die Wahrheit kaum mehr zu trennen sind – nicht mal innerhalb des Plots.
Als Journalist war Tom Kummer mit seiner dialogischen Erfindungsgabe definitiv am falschen Ort – und nach all den Skandalen um gefälschte Interviews und geklaute Reportage-Passagen ging sein Wechsel in die Literatur nicht ohne Plagiatsaffäre vonstatten, als er 2017 mit «Nina & Tom» debütierte. Nun gefällt sich der neue Roman stellenweise auch im Spiel mit moralischen Grenzüberschreitungen, was man nicht sympathisch finden muss.
Für die Frage nach der Machart von Dialogen ist das Buch aber schon deswegen interessant, weil es in der deutschen Literatur derzeit nur wenige geben dürfte, die ähnlich schlackenfrei eine Punchline neben die nächste setzen können. Dass diese tarantinohafte Macker-Attitüde mit ihrer Eskalationslogik und Pointenobsession literarisch ein Gegengewicht braucht, weiss der Autor dieses Romans besser als seine Hauptfigur. Und Tom Kummer führt lehrbuchmässig vor: Anders als im Theater bestehen starke Dialoge in der Literatur nie nur aus Figurenrede.
Was den Taxi-Szenen ihre Unentrinnbarkeit, ihre permanente Überbietungsdynamik verleiht, ist die Verschränkung von Erzählstimme, innerem Figurenerleben und wörtlicher Rede. Auch Kummers Erzähler spricht vollkommen schnörkellos, drosselt höchstens hie und da das Tempo, damit die Beschleunigung danach umso wuchtiger wirkt. Wo andere in ein ständiges «sagte er, meinte sie» verfallen (gerne mit reichlich Adjektiven), lässt Kummer alles nicht unbedingt Notwendige weg: weil er weiss, dass die Leserin selbst in ihrem Kopf ergänzt, ausschmückt, konkretisiert; und dass genau dieses Wechselspiel aus schriftstellerischem Trigger und rezeptiver Aktivität den Glutkern der Leseerfahrung bildet. Die Kunst des literarischen Dialogs besteht auch im nonverbalen Dialog mit den Lesern – und darin, ihnen Raum zu lassen.
Vor diesem Hintergrund noch einmal zurück zu Regula Portillo. Denn auch bei ihr werden die Dialoge im Fortgang des Buches zunehmend verdichtet. Äusserlich ähnelt das den Dialogen bei Kummer und ist doch vollkommen anders im Ton.
Matilda lebt inzwischen, nach tragischen Vorfällen, bei ihrer Mutter in Mexiko und ihrem Halbbruder Daniel. Und im scheinbar harmlos-familiären Gespräch kann sich aus Vergangenem jederzeit die Passivaggression der Gegenwart entwickeln.
«Wen magst du lieber, Daniel oder mich?»
Lucía schlägt die Augen auf, ist wieder hellwach. «Matilda, was fragst du denn da? Ich habe euch beide gleich lieb, das weisst du doch.» Sie erschrickt selber über den harten Ton, den sie angeschlagen hat. (...)
«Das gilt nicht», beharrt Matilda genauso streng, «du musst dich entscheiden.»
«Das kann ich aber nicht.»
«Du musst.»
4 Liebe deine Figuren
Es gibt Autoren, deren Schreiben fast ausschliesslich von den Figurenstimmen lebt: Arno Camenisch zum Beispiel. Seit Jahren betreibt er eine Archäologie der aussterbenden Alltagsphänomene, in jeweils neuen Mischverhältnissen aus Deutsch und Rätoromanisch, Standardsprache und Mundart. Dafür, dass er dabei, ganz lutherisch, den Leuten aufs Maul schaut, wird er geliebt und gefeiert. Mit Blick auf sein neues Buch fragt sich nur: warum?
«Goldene Jahre» beginnt so (und der Beginn ist auch die Mitte ist auch das Ende ist einfach Dauerschleifen-Sound):
Auf zum Mond, sagt die Margrit und dreht den Schalter, die gelbe Leuchtreklame auf dem Dach vom Kiosk geht an. Sie tritt zur Türe vom Kiosk raus und schaut zur Leuchtreklame hoch. Eine Freude ist das, wie schön sie leuchtet, sie lächelt, da geht einem grad das Herz auf, wenn wir am Morgen die gelbe Leuchtreklame einschalten, in aller Herrgottsfrühe, wenn noch die letzten Sterne am Himmel sind. Und bald wird es hell, sagt sie und geht ein paar Schritte bis zur Strasse und dreht sich zum Kiosk. Bereits von weitem sieht man sie, die schöne Reklame, so wissen die Leute, dass wir hier sind und offen haben, sobald das Licht auf dem Dach angeht, geht auch das Leben im Dorf an, das ist wie der Hauptschalter. Die Rosa-Maria kommt um die Ecke und steht neben ihr hin. Hm, sagt die Margrit und nickt, seit 1969 gibt es uns bereits, ja, ja, im 69 ist die Leuchtreklame zum allerersten Mal auf dem Dach angegangen, in ihrer ganzen Pracht, das ganze Tal ist aufgeleuchtet an diesem Tag, sogar von Brigels runter konnte man die Leuchtreklame sehen, …
… und wer jetzt noch nicht das Licht wieder ausgeknipst hat, der schafft auch die weiteren fünf- oder sechsmal Leuchtreklame auf der Anfangsseite.
Die Botschaft immerhin ist klar: «Goldene Jahre» lässt eine fast schon vergangene Welt aus Panini-Bildern und Raketenglace wiederaufleben; und er zeigt, mit welch ungebrochen warmherziger Verklärung die beiden Betreiberinnen auch nach einem halben Jahrhundert auf ihr kleines Reich blicken, das zu errichten im Dorf einst so pionierhaft erschien wie die gleichzeitige Mondlandung. Weshalb das Duo sich halb nostalgisch, halb kompensatorisch an den immer gleichen Geschichten von damals erwärmt.
Ist das nun ein liebevolles Porträt der beiden Frauen oder literarische Ridikülisierung?
Es fiele leichter, Ersteres (und damit dem Klappentext) zu glauben, wenn Camenisch seine Figuren weniger einfältig gezeichnet hätte.
Als Vergleich: Simone Lappert hat vergangenes Jahr in ihrem Roman «Der Sprung» einen ähnlichen aus der Zeit gefallenen Mikrokosmos, das Quartierlädeli, eingefangen. Aber sie hat ihren Figuren Tiefe und Entwicklung gegeben.
Bei Camenisch dürfen die Heldinnen fast so oft ihre Frisuren richten, wie sie ihre Kehrverse aufsagen. Besonders gern sollen sie Sachen sagen mit «Mond» drin, weil der Mond ja ein Leitmotiv ist («auf den Mond schiessen», oder «diese schönen Mombuts … ai, die gaben denn schön warm an den Füssen, so Moonboots nannte man diese, sagt sie, Mondschuhe halt»). Und sie müssen Dialoge führen wie diesen, über ihre liebste Verkaufsrakete:
Oh, ja, das ist ein Evergreen, sagt die Rosa-Maria und lächelt. Ein was ist das, fragt die Margrit. Ein Evergreen, sagt die Rosa-Maria, ein Dauerbrenner sozusagen, diese feinen Glacés. Ach so, sagt die Margrit und isst ihre Raketa (…)
Die «Brille mit Goldrand» zu erwähnen, die Rosa-Maria noch ein bisschen öfter richtet als ihre Frisur, bleibt hingegen als Running Gag der Erzählstimme vorbehalten – eine Imitation der Figurenrede, die man wohl kaum anders denn als Parodie verstehen kann. Einmal, als Margrit von «diesem Collins» erzählt, dem dritten Astronauten der Mondlandung, der «beinahe vergessen» ging, weil er, als die Welt auf die beiden Kollegen schaute, «gerade auf der Rückseite Warteschleifen mit der Kapsel drehte wie ein Taxi, das auf Kundschaft wartet» – da darf sie ausnahmsweise einmal selber witzig sein. Ansonsten ist hier für die Frauen in Sachen Humor offenbar eher die Objektrolle vorgesehen.
So verfestigt sich mehr und mehr der Eindruck, als Grundlage dieses Autor-Leser-Paktes werde die gemeinsame Selbsterhebung über die beiden schrulligen Damen zumindest nicht grad ausgeschlossen. Man kann wohl davon ausgehen, dass das nicht die Intention des Autors ist – dass der Text dennoch in dieses Fahrwasser zu geraten droht, hat unmittelbar mit den gewählten Stilmitteln und ihrer etwas zu selbstgenüsslichen Anwendung zu tun.
Kein einziges Mal tritt in den Dialog jemand anderer ein als die beiden Frauen. Wenn sie einander also unablässig Geschichten erzählen, von denen sie wissen, dass die andere sie kennt, dann soll das womöglich zeigen, wie Nostalgie funktioniert: Alte Weggefährtinnen teilen immer dieselben Geschichten – das kennt jeder.
Aber auch solche Rituale haben ihre Gesetze. Und würden die Kolleginnen wirklich folgende Sätze über ihren Kiosk mit Zapfsäule tauschen?
Also auf dieser Seite hier, also hier rechts, meine ich, da haben wir Benzin, und hier auf der linken Seite der Zapfsäule gibt es Diesel, für wer lieber Diesel will. Und ein Kännli mit etwas Öl haben wir auch hinten im Kämmerli, für wer gleich noch den Ölstand ausgleichen will.
Also unterstellt man als Leserin wohlwollend, dass man sich offenbar noch einen Beobachter vorzustellen hat: eine Lokalreporterin oder eben einen Autor auf Recherche, an den die Frauen ihre Botschaften eigentlich richten, damit dieser verstehe, was es hier alles gibt und wie top der Service ist. Allerdings lassen sie sich an anderer Stelle über die Geheimnisse zwischen ihnen und einzelnen Stammkunden aus, die sie schon deswegen nicht vor Dritten ausbreiten würden, weil sie Diskretion zu ihrem Berufsethos rechnen. Und so geht die Sache immer an irgendeiner Stelle nicht recht auf; wie auch die Wechsel zwischen verschiedenen Sprachregistern oft eher willkürlich erscheinen.
Bleibt am Ende – weil den beiden Frauenstimmen (und den Charakteren im Ganzen) ohnehin kaum Unterscheidbarkeit zugestanden wird – nur das versöhnliche Fazit im Duett:
… ja, ist das denn die Möglichkeit, dass wir bereits so alt sind.
Oh, wenn man mit zwanzig anfängt, ist man einundfünfzig Jahre später knapp siebzig, sagt die Rosa-Maria. Ja, das stimmt auch wieder, sagt die Margrit.
Wer wollte da noch widersprechen?
5 Gretchenfragen
Weil das Beste angeblich zum Schluss kommt, ist Monika Helfers Roman «Die Bagage» hier richtig. Auch sie erzählt – in einem ganz anderen Setting als bei Camenisch – von einfachen Menschen und ihrer Lebenswelt. Und welche Kraft sie dabei entwickelt, welche Würde sie ihnen gibt, hat entscheidend mit genauestens gearbeiteter Figurenrede zu tun.
Der Schauplatz: tiefe Vorarlberger Provinz. Und «die Bagage», wie die Dorfbewohner die Familie nennen, von der hier erzählt wird, lebt noch ein bisschen mehr am Rand, in jedem Sinn des Wortes.
Die Geschichte der «Bagage» ist auch die Familiengeschichte der Autorin. Halb recherchiert, halb imaginiert, changiert die Ich-Erzählung zwischen dokumentarischer Spurensuche und literarischer Eigengesetzlichkeit.
Monika Helfer hat die Figur ihrer Grossmutter, Maria, zum Kraftzentrum dieser zugleich archaischen und hochreflektierten Erzählung gemacht. Maria ist von einer märchenhaften Schönheit, und als ihr Mann Josef (!) in den Ersten Weltkrieg zieht, weiss er, warum er dem Bürgermeister (mit dem er ohnehin hin und wieder «ein Geschäftchen» macht) steckt, es wäre ihm recht, «wenn du zuschaust, dass keiner zu ihr hinaufgeht». Da ahnt man schon: Es wird nicht zuletzt Gottlieb, der Bürgermeister, sein, der regelmässig zu ihr hinaufgeht und die bittere Armut der Familie schamlos ausnutzt. Und weil dieser plötzlich aufgetauchte Deutsche Maria ebenfalls umgarnt, fragt sich nicht nur der Dorfpfarrer, als Maria mit Grete schwanger ist, ob das wirklich an den zwei kurzen Fronturlauben von Josef liegt.
Wie Maria dann tatsächlich zu dem Kind gekommen ist, werden wir nie erfahren, es spielt auch keine Rolle. Was Monika Helfer hier literarisch unternimmt und meisterhaft ausführt, ist etwas ganz anderes: ein Familienporträt als Milieustudie zu zeichnen – tiefenscharf, aber mit so wenigen Strichen wie möglich. Helfer begreift die Charaktere von den Strukturen her, in denen sie leben, und aus der Wechselwirkung, die sie aufeinander haben.
Beides kommt nirgendwo deutlicher zur Sprache als durch die Stimmen der Figuren selbst.
Wie der 9-jährige Lorenz mit dem Gewehr in der Hand die Mutter vor den Zudringlichkeiten des Bürgermeisters zu schützen versucht; wie das Ehepaar nach Josefs Rückkehr das Unsagbare des Krieges zur Sprache zu bringen sucht. Oder wie Josef mit Gottlieb die, nun ja, Gretchenfrage klären will, sich beide mit Worten duellieren – und ausgerechnet der ehemalige Bürgermeister den Respekt vor dem Mädchen bei ihrem eigenen (?) Familienvater einklagt:
«Was ist dran?»
«An was?»
«Du weisst genau, was ich meine. Das, warum der Pfarrer das Kreuz abmontiert hat. Das!»
«Was ist an was dran! Kannst du nur herumreden, Josef, und hast nicht einmal den Mut auszusprechen, was du meinst?»
«Dass der Balg nicht von mir ist. Das meine ich.»
«Wer sagt das?»
«Was ist dran?»
«Du willst etwas wissen», sagte der ehemalige Bürgermeister, der nun nur noch Gottlieb Fink hiess. «Ich will auch etwas wissen. Wie sollen wir tun? Sollen wir uns gegenseitig Antwort geben oder nicht?» (...)
«Ich frag dich. Genau das frag ich dich, Bürgermeister.»
«Ich bin nicht mehr Bürgermeister. Ich bin Gottlieb Fink und sonst nichts.»
«Dann frag ich den Gottlieb Fink. Ist der Balg von mir?»
«Auch wenn du aus dem Krieg kommst, Josef, und auch wenn es so ist, dass der Krieg den Menschen nicht besser macht, sondern das Gegenteil davon, und auch wenn die Margarethe nur ein Kind ist und nicht mehr, so ist sie doch ein Mensch und hat einen Namen, und es wäre mir lieb, wenn du in meiner Gegenwart nicht Balg sagst, sondern ihren Namen. Sie heisst Margarethe und wird Grete genannt.»
Dann meldet sich Monika Helfers Erzählstimme zu Wort: «So stelle ich mir vor – so möchte ich mir vorstellen –, dass Gottlieb Fink mit Josef Moosbrugger gesprochen hat.»
Man kann diesen Satz vielleicht so übersetzen: Dialoge in der Literatur, so sehr sie der Wirklichkeit abgelauscht sein mögen, sind immer konstruiert. Das Realistische ist ein literarischer Effekt – und Readymades aus dem echten Leben nicht allzu häufig. Versierte Autorinnen wissen das. Manchmal weiss es sogar die Erzählerin.
Arno Camenisch: «Goldene Jahre». Engeler-Verlag, Schupfart 2020. 101 Seiten, ca. 25 Franken.
Monika Helfer: «Die Bagage». Hanser-Verlag, München 2020. 160 Seiten, ca. 27 Franken.
Tom Kummer: «Von schlechten Eltern». Tropen-Verlag, Stuttgart 2020. 245 Seiten, ca. 31 Franken.
Andreas Neeser: «Wie wir gehen». Haymon-Verlag, Innsbruck 2020. 216 Seiten, ca. 26 Franken.
Regula Portillo: «Andersland». Edition Bücherlese, Luzern 2020. 272 Seiten, ca. 28 Franken.