
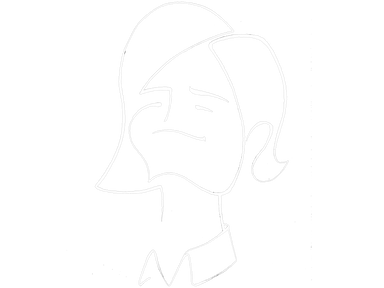
Spiel mir das Lied vom Tod
Die Corona-Krise zeigt auf besonders brutale Weise den dramatischen Niedergang der amerikanischen Gesellschaft. Allerdings hat der schon Jahrzehnte zuvor eingesetzt und Hunderttausende Tote gekostet.
Von Daniel Binswanger, 27.06.2020
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Die Lage ist verheerend: In den USA liegen die Fallzahlen mit über 40’000 am Freitag gemeldeten Infektionen wieder in demselben Bereich, in dem sie sich im April auf dem vermeintlichen Höhepunkt der Krise schon befanden. Mit über 600 Todesfällen pro Tag zeigte auch diese Zahl gestern nach oben. Die «Führungsmacht der freien Welt» erweist sich in unfassbarem Mass als unfähig, die Covid-Krise in den Griff zu bekommen.
Was werden dereinst Historiker sagen über dieses epochale Regierungsversagen? Nach heutigem Kenntnisstand sind Zehntausende Amerikanerinnen und Amerikaner einen überflüssigen und vermeidbaren Tod gestorben, weil im Weissen Haus ein narzisstischer Psychopath residiert. Sicherlich: Für das Virus ist Trump nicht verantwortlich. Die katastrophal inadäquate Reaktion der US-Behörden geht jedoch weitgehend auf das Konto seiner Administration. So, wie es heute aussieht, werden bis zur voraussichtlichen Abwahl des Präsidenten im kommenden November noch mehrere zehntausend weitere US-Bürger eines unnötigen Todes sterben.
Es ist ein schwacher Trost, aber immerhin zeigen nun die amerikanischen Meinungsumfragen, dass Trumps Abwahl sehr viel wahrscheinlicher zu werden beginnt. So bodenlos der Wahnsinn scheint, er könnte doch an seine Grenzen stossen.
Ein nationaler «New York Times»-Poll vom letzten Mittwoch ergab nicht nur, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden um 14 Prozentpunkte besser abschneidet als Trump, er zeigte auch, dass der Präsident nach heutigem Stand selbst bei weiten Teilen seiner Stammwählerschaft Verluste hinnehmen muss. So schlägt Biden seinen Rivalen bei den über 65-Jährigen – eine Wählerkategorie, die sich vor vier Jahren noch deutlich für Trump aussprach – und kann auch bei den weissen Wählern starke Zugewinne verzeichnen. Allerdings gibt es eine Subgruppe, die sich immer noch recht deutlich für den Amtsinhaber ausspricht: Weisse ohne College-Abschluss. Weiss und niedrig qualifiziert: Dieses Wählersegment, so wird uns auch unter Covid-Bedingungen in Erinnerung gerufen, bildet den unverwüstlichen Kern des Trump-Elektorats.
Angesichts der heftigen Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus wird Trump ohne Zweifel weiterhin versuchen, sich als Garant für Law and Order und Beschützer vor den «Gangstern» zu positionieren – sprich, seine Wähler abzuholen, indem er kaum verhohlen an rassistische Affekte appelliert. Auch ein medienwirksam inszenierter Besuch an der wall, also an der umstrittenen Grenzmauer gegen Mexiko, mit der er schon vor vier Jahren Wahlkampf machte, ist bereits absolviert worden.
Die Trump-Präsidentschaft, die in den letzten Wochen die Abwehrreaktion einer neuen Bürgerrechtsbewegung ausgelöst hat, ist ein weiteres tristes Kapitel in der langen und gewaltsamen Geschichte der amerikanischen Rassendiskriminierung. Für die politische Orientierung der weissen, niedrig qualifizierten Unterschicht der USA spielt Rassismus eine wichtige Rolle.
Das ist keine strittige Erkenntnis, aber eines sollte dennoch nicht vergessen gehen: Es gibt zahlreiche andere Faktoren, welche die Lebensrealitäten und die politische Haltung jener Wählergruppe bestimmen. Ihre Situation war schon vor der Corona-Krise verzweifelt, an Leib und Leben bedroht. Ja, viel schlimmer noch: Der Niedergang der amerikanischen Gesellschaft ist so dramatisch, dass sich die Zahl der vermeidbaren, blosser Achtlosigkeit geschuldeten Toten schon vor dem Ausbruch der Covid-Epidemie in Zehntausenden, ja Hunderttausenden zählen liess.
Der letzte Satz kommt Ihnen absurd vor? Eine Behauptung, wie sie vielleicht unter Verschwörungserzählern, USA-Hasserinnen und linken Kapitalismuskritikern kursieren mag? Es wäre zu wünschen, Sie hätten recht. Leider aber beruht sie auf solider Wissenschaft.
Eine atemberaubende ökonomische Analyse zum Thema Leben und Sterben in den heutigen USA haben der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton und seine Frau, die ebenfalls hoch respektierte Princeton-Professorin Anne Case, vor ein paar Wochen publiziert. Sie trägt einen Titel, der sich zunächst anhört wie eine Kreuzung aus Soap-Opera und Systemkritik: «Deaths of Despair and the Future of Capitalism» (Tode aus Verzweiflung und die Zukunft des Kapitalismus). Die Verfasserinnen haben allerdings nicht die geringste Neigung zum Melodrama und schon gar nicht den Wunsch, den Kapitalismus abzuschaffen. Das Werk stellt vielmehr eine nüchterne, auf sehr granularem Zahlenmaterial beruhende Analyse der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft dar.
Was sind «Tode aus Verzweiflung»? Case und Deaton operieren mit einer präzisen Definition: Es handelt sich um Todesfälle, die entweder auf einen Suizid, eine Überdosis mit einem Opioid wie Heroin, Oxycodon und Fentanyl oder auf Folgen schwerer Alkoholsucht wie Leberzirrhose und Leberkrebs zurückzuführen sind. Mit der Aufarbeitung dieser Verzweiflungstode gehen Deaton und Case einem singulären Phänomen auf den Grund: Obwohl sie sich im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts in allen Industrieländern kontinuierlich stark verbessert hat, ist in bestimmten Bevölkerungsgruppen in den USA die Sterblichkeitsrate – also der Prozentsatz der Menschen innerhalb einer Gruppe, die im Laufe eines Jahres versterben – plötzlich nicht mehr gesunken und sogar leicht gestiegen.
Am frappierendsten ist dieser Trend für die Sterblichkeitsrate der 45- bis 54-jährigen weissen, nicht hispanischen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Während Jahrzehnten sank sie jedes Jahr um 2 Prozent. Doch plötzlich, im Jahr 1990, hörte dies auf. Das ist umso erklärungsbedürftiger, als in anderen Industrieländern wie Frankreich, Grossbritannien oder Schweden die Sterblichkeit in dieser Altersgruppe sich vor 1990 in etwa wie in den USA entwickelte – und nach 1990 im selben Rhythmus weiterhin konstant abnahm. Wie erklärt sich der amerikanische Ausreisser?
Der Grund sind ausschliesslich die Verzweiflungstode, also Suizide, Alkohol- und Drogenmissbrauch, die ab 1990 derart nach oben geschnellt sind, dass sich Leben und Sterben in den Vereinigten Staaten einschneidend verändert haben. Wenn man allein für diese Gruppe der nicht hispanischen, weissen Bürgerinnen und Bürger zwischen 45 und 54 von 1990 bis 2017 die Todesfälle zusammenzählt, die nicht eingetreten wären, wenn die USA wie die anderen Industriestaaten auf dem Entwicklungspfad der sinkenden Sterblichkeitsraten geblieben wären, dann wären heute 600’000 Menschen mehr am Leben. 600’000 vermeidbare Tote! Das entsetzliche amerikanische Handling der Covid-Krise darf einen eigentlich gar nicht überraschen.
Doch Case und Deaton zeichnen ein noch feineres und noch schwärzeres Bild: Die ansteigenden Sterblichkeitsraten betreffen nur einen bestimmten Teil ihrer Sample-Gruppe – sind dort aber so ausgeprägt, dass sie den ganzen Durchschnitt anheben: die Weissen ohne College-Abschluss. Der Bildungsstand wird in immer stärkerem Masse zum alles entscheidenden Indikator für Einkommen, Arbeitslosigkeit, Familienverhältnisse, Gesundheitszustand und eben auch Mortalität. Die niedrig qualifizierten weissen Arbeitnehmer – immerhin 37 Prozent aller amerikanischen Arbeitskräfte – sind in spektakulärem Ausmass die Verlierer der gesellschaftlichen Transformationen seit Beginn der 90er-Jahre. Es sind die Wähler von Trump.
Was ist mit anderen Bevölkerungsgruppen? Gemäss sämtlichen Indikatoren am schlechtesten, das bestätigen Deaton und Case, geht es weiterhin den Afroamerikanerinnen. Auch hier ist bei den 45- bis 54-Jährigen die Sterblichkeitsrate nach wie vor am höchsten. Aber die Lücke zur weissen Unterschicht hat sich stark geschlossen. Für Schwarze dieser Altersgruppe ist im Gegensatz zu den Weissen die Mortalität in den 90er- und den Nullerjahren weiterhin kontinuierlich gesunken. Die weisse Unterschicht hat in den letzten dreissig Jahren in jeder Hinsicht schwindelerregende Einkommens- und Statusverluste erlitten. Die schwarze Unterschicht ist immer noch am schlechtesten gestellt. Aber ihre Situation hat sich in den letzten dreissig Jahren im Verhältnis zu früher deutlich verbessert.
Natürlich gehen Deaton und Case auch der Frage nach, wo die Gründe für die Verzweiflung liegen – und was gegen sie getan werden könnte. Zunächst, so der Vorschlag, muss der amerikanische Arbeitsmarkt anders organisiert werden. Die klassischen sozialliberalen Reformmassnahmen – höhere Bildungsinvestitionen, höhere Qualifikation für Niedrigqualifizierte – betrachten Case und Deaton als Illusion. «Wir haben gewiss nichts gegen Bildung», schreiben sie. «Aber wir akzeptieren die implizite Grundvoraussetzung nicht, dass Menschen nutzlos sind für die Wirtschaft, solange sie keinen höheren Abschluss haben. Menschen mit niedrigem Qualifikationsgrad dürfen ganz bestimmt nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt werden.»
Zweitens muss verhindert werden, dass das politische System der USA sich vollständig den wirtschaftlichen Oligopolen und den Reichtumseliten unterwirft. Warum hat man die Interessen der Pharmaindustrie geschützt – und jahrelang einfach zugesehen, wie sich eine vernichtende Opioid-Epidemie entwickelt? Warum sind so weite Bereiche der US-Wirtschaft kartellisiert, ohne dass die Behörden eingreifen? Es hat eine gigantische Umverteilung von unten nach oben eingesetzt, so Deaton und Case: «Robin Hood soll von den Reichen für die Armen gestohlen haben. Was heute in den USA geschieht, ist inverser Robin Hood, von den Armen für die Reichen. Man könnte es auch Sheriff-of-Nottingham-Umverteilung nennen.»
Schliesslich und endlich muss das amerikanische Gesundheitssystem vollkommen reformiert werden, welches das mit Abstand teuerste der Welt ist, die Volkswirtschaft schwer belastet, der breiten Bevölkerung eine grotesk miserable Versorgung bietet und eigentlich nur einen Zweck zufriedenstellend erfüllt: Ärzten, Spitalketten und der Pharma höhere Gewinne zu verschaffen als in jedem anderen Land der Welt. Die Gesundheitsversorgung ist der Kulminationspunkt aller systemischen Absurditäten der amerikanischen Gesellschaft. Und jetzt soll es Covid-19 bewältigen.
«Tode aus Verzweiflung» wurde vor der Corona-Krise verfasst. Die Autorinnen haben sicherlich nicht damit gerechnet, dass ihre rabenschwarze Bestandsaufnahme der amerikanischen Verhältnisse so schnell eine so dramatische Bestätigung bekommen würde. Sie lassen trotz allem eine optimistische Note erklingen: «Wir hoffen, dass dieses Buch dabei helfen wird, wieder die richtige Politik zu machen, um in diesem Jahrhundert wieder dieselben Fortschritte zu erzielen, die auch im letzten Jahrhundert möglich gewesen sind. Die Zukunft des Kapitalismus muss eine Zukunft der Hoffnung und nicht der Verzweiflung sein.»
Hand aufs Herz: Wer könnte dem widersprechen?
Illustration: Alex Solman