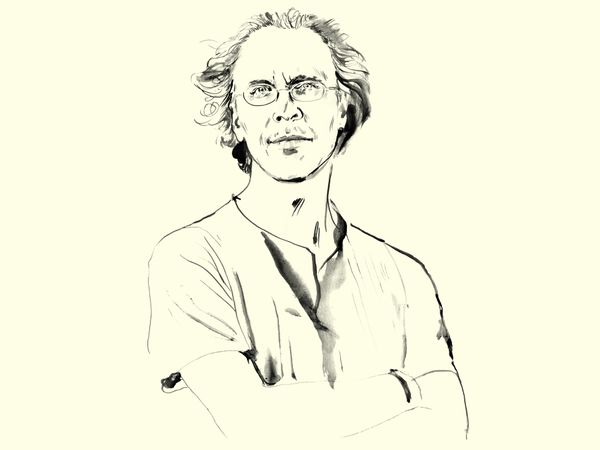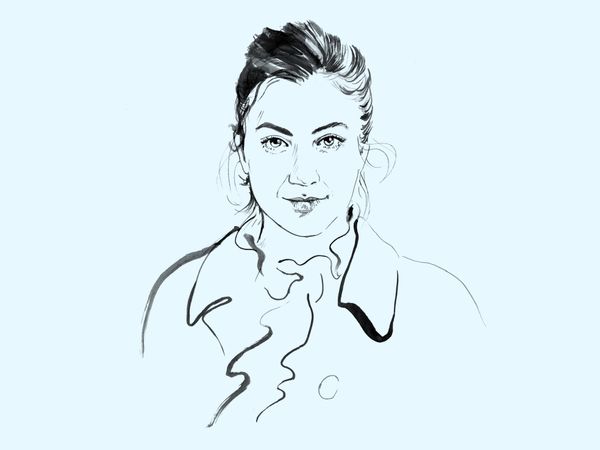Lieber Tobias, ich schreibe schon, als hielte ich eine Predigt …
Die Autorin Ruth Schweikert will in ihrem Brief an den Gefängnispfarrer Tobias Brandner die Krise nicht als Chance sehen. Aber vielleicht als Aufforderung.
Von Ruth Schweikert (Text) und Elisabeth Moch (Illustration), 11.05.2020
Lieber Tobias,
So kommen wir in dieser globalen Krise – der Republik sei Dank – über den halben Globus hinweg wieder miteinander ins Gespräch. Du lebst seit 1996 mit deiner Familie in Hongkong, ich wohne seit Jahrzehnten als Schriftstellerin und Dozentin mit meiner Familie in Zürich; ich bin Agnostikerin, du lehrst an der Chinese University Theologie, sprichst fliessend Kantonesisch und begleitest als Gefängnispfarrer Mörder und andere Schwerverbrecher, soweit sie es wünschen, soweit sie sich dir anvertrauen (und das tun nicht wenige, unabhängig von ihrer Religion, denn du hörst diesen Männern erst mal einfach zu). Was immer die Häftlinge mit dir teilen – oft Schuldgefühle, Selbsthass, innere Leere –, du nimmst es an, begreifst ihre Schwäche und Verlorenheit als Zugang zu und Zeugnis ihrer Menschlichkeit.
Das hast du so nicht gesagt, das schreibe ich dir zu, in diesen Zeiten, wo die Fragilität des Homo sapiens, seine existentielle Mitwelt-Abhängigkeit, ob einzeln oder im Verbund, sich so unmittelbar zeigt wie seit Jahrzehnten nicht, in diesen Breitengraden zumindest. Denn dort sind wir doch seit den frühen Neunzigerjahren – so scheint es mir – vornehmlich mit perpetuierten Selbstentwürfen beschäftigt. Singularität als kollektiver Selbstauftrag, die Autonomie des Individuums in allen Lebenslagen als höchstes Ziel und grösstes Freiheitsversprechen; abhängig machen wir uns bloss noch von den entsprechenden Technologien. Und dann wundern wir uns über das Auseinanderbrechen der Gesellschaft, über die Krise der Demokratie, über die Schwierigkeit, der globalen Erwärmung mit adäquaten politischen Massnahmen zu begegnen?
Was uns verbindet, ist die geografische Herkunft, das Lebensalter, mithin das Aufwachsen im Kalten Krieg, drei (halbwegs) gemeinsam verbrachte Schuljahre – von 1980 bis 83 haben wir beide die Alte Kantonsschule Aarau besucht –, Erinnerungen an persönliche Begegnungen. Auch später haben unsere Wege sich sporadisch gekreuzt, zufällig und mit Absicht; du hast meine Bücher gelesen, ich deine Zeitungsartikel und Interviews; letzten November habe ich dich zu den Aufständen in Hongkong am Radio gehört. Selten schreiben wir einander eine kurze Mail, einmal haben wir uns in Zürich Zeit genommen für ein längeres Gespräch. Wenn wir uns nun über Corona und Quarantäne austauschen, beschäftigen mich vor allem die gesellschaftlichen Dimensionen dieser Krise, wie ich sie an mir selbst und meinen Nächsten erfahre – mehr Fragen als Antworten, mehr Ungewissheit als Gewissheiten.
«There’s no such thing as society», sagte Margaret Thatcher in einem viel zitierten Interview vom 23. September 1987: «There are individual men and women and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look after themselves first. It is our duty to look after ourselves and then, also, to look after our neighbours.»
Warum fällt mir ausgerechnet Margaret Thatcher ein, die Maxime ihrer Politik, die sie formuliert hat kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, dem Ende des Kalten Kriegs? War die historische Zäsur für unsere Generation nicht 1989, die samtene Revolution? Ein ungeheures Freiheitsversprechen, das eine ebenso ungeheure Hoffnung weckte: Die existentielle Gleichheit aller Menschen im Verbund mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vermöchte die Grundlage zu schaffen für eine offene, freiheitliche und solidarische Weltgesellschaft, die sich als Wille und Vorstellung am Horizont bereits abzeichnete.
Erinnerst du dich? «Freiheit, schöner Götterfunken» sangen die vielstimmigen, aus Ost und West zusammengefügten Chöre am 25. Dezember 1989, als Leonard Bernstein in Berlin Beethovens 9. Symphonie dirigierte; die Freiheit also sollte bewerkstelligen, was Schiller noch der Freude zugemutet hatte: «Alle Menschen werden Brüder» (und Schwestern).
Davon scheinen wir rund dreissig Jahre später einigermassen weit entfernt. Die Globalisierung hat vielen vieles eröffnet, aber keine Weltgesellschaft hervorgebracht. Eher fürchte ich, dass bis heute – durch das Internet beschleunigt, aber nicht verursacht – fortwirkt, was Margaret Thatcher programmatisch formuliert und in die Wege geleitet hat: die Atomisierung der Gesellschaft.
Immer wieder, wenn wir in den Monaten vor der Covid-19-Krise in unserem Gemeinschaftsbüro im Zürcher Kreis 5 über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen diskutierten – wir, das sind Menschen, die in den Bereichen Grafik, Gestaltung, Architektur, Kommunikation und Beratung arbeiten –, fiel das (nicht sehr originelle) Stichwort von der Vereinzelung. Entwicklungen, die, siehe oben, einhergingen mit hoher Leistungsbereitschaft und hohem Leistungsstress, aber seltsamerweise nicht unbedingt mit Selbstverantwortung. Und noch weniger mit einem verantwortlichen Handeln gegenüber den Nächsten. Nachbarschaftssolidarität? Jede und jeder, jede Familie auch, so war damals unser Fazit, scheint wahnsinnig gefordert und beschäftigt – und zugleich akribisch darauf bedacht, sich in allem selber zu organisieren, und sei es mit Hilfe verschiedener Institutionen und Angestellter, von der Kinderkrippe über die Putzhilfe bis zur Spitex.
So paradox es scheint: Tragen nicht auch die Institutionalisierung und die Professionalisierung des Care-Bereichs – so vehement ich sie befürworte – dazu bei, dass dem/der Einzelnen gewisse Dimensionen gesellschaftlicher Verantwortung und solidarischen Handelns abhandenzukommen drohen? Und ist uns in dieser Corona-Krise mit dem bundesrätlichen Solidaritäts-Aufruf etwas davon bewusst geworden? Ich schreibe schon beinahe, als hielte ich eine Predigt …
Was ist deine Sicht auf diese Dinge? Wie erlebst du die gesellschaftlichen Entwicklungen in Hongkong? Ich weiss, dass ihr eine Hausangestellte beschäftigt habt, die sich auch um die Kinder kümmerte, solange sie klein waren, so hast du es 2008 im Fernsehdokfilm «Father Tobias» erzählt. Damals hast du die Verhältnisse in Hongkong als extrem kapitalistisch beschrieben; ich selber kenne die 7-Millionen-Metropole auf winzigen 1100 km2 ausschliesslich von Medienberichten. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die sogenannten Cage People, mehr als eine Million Einwohner*innen, darunter ganze Familien, die buchstäblich übereinandergestapelt in Käfigen leben. Nicht auszudenken, wenn sich das Virus, allen Vorsichtsmassnahmen zum Trotz, eines Tages unter den Cage People zu verbreiten begänne (wie in letzter Zeit etwa in Singapur unter den sogenannten Workers).
Doch die bisherige Corona-Bilanz für Hongkong ist, von einem teils schwer getroffenen Europa aus betrachtet, in jeder Hinsicht erstaunlich: 1041 Infizierte, 4 Tote, 900 Genesene weist die Statistik am 5. Mai aus. Inwiefern also tangiert dich diese Krankheit überhaupt in deinem Alltag, beruflich und persönlich, deine Familie, die Studierenden, die Häftlinge, die Bevölkerung, gedanklich, physisch, emotional?
Und schon ist Mittwoch, 6. Mai, und ich schreibe dir aus dem Gemeinschaftsbüro, das ich heute zum ersten Mal wieder nutze, um endlich weiterzukommen mit diesem Brief, an dem ich seit Tagen mehr in Gedanken sitze als realiter. Noch immer fällt es mir schwer, im Homeoffice zu schreiben (während Skype- und Zoomgespräche mit Studierenden im Allgemeinen durchaus funktionieren), eher sinniere ich vor mich hin, während Orell im Homeschooling konzentriert an seinen Lernaufträgen arbeitet, zwischendurch nachfragt, stolz seine Ergebnisse präsentiert.
Seltsam heilsam: Seit Anfang April auch Elia (vorübergehend) ausgezogen ist, ist unser dreizehnjähriger Jüngster ausgerechnet im Lockdown zum Quasi-Einzelkind mutiert. Und obwohl er sich genau davor gefürchtet hat – den ganzen Tag allein mit seinen beiden «alten» Eltern –, scheint es nun, als geniesse er diese Zeit (und wir die Zeit mit ihm), als hole er gar Versäumtes nach, eine Zusatzschlaufe Kindheit, Ausschlafen und «Hängen», Essen und Wachsen, ein letztes Auftanken, bevor die Pubertät ihn in eine hoffentlich offene Welt hinaus katapultiert.
Seltsam heilsam (wie ich neulich auch anderswo schrieb): Vielleicht ist es genau das, was mich als Mutter am meisten bekümmert und beschwert, die kumulierten Versäumnisse, das deutliche Empfinden, an meinen Kindern etwas versäumt zu haben. Wie wohl viele beruflich stark engagierte Mütter und Väter hat mich die Spannung zwischen Berufs- und Familienleben über Jahre und Jahrzehnte hinweg zuweilen erschöpft: der mental load, die ganzen Termine, die fast stündlich aktualisierte innere Landkarte, «wer ist wann wo und wie geht es ihr/ihm wohl dabei?». Aber nichts und niemand hat mich je dazu gebracht, deswegen etwas zu ändern, meine Ansprüche auch nur um ein Jota herunterzuschrauben, ob in Bezug auf mich selbst, meine Arbeit oder meine Familie; noch nicht mal meine Brustkrebserkrankung 2016 bot mir dazu Anlass, im Gegenteil: «Jetzt erst recht!», sagte ich mir.
Mit anderen Worten: Was ich mir in vierunddreissig Berufs- und Familienjahren nicht zugestanden habe, den (partiellen) Abschied vom Selbstauftrag der Superwoman, von Allmachts- und Grössenfantasien, hat mir (mit Mitte fünfzig) der staatlich verordnete Lockdown beschert. Selten war ich als Mutter so entspannt und versöhnt wie heute.
Merde alors! Verwundert reibe ich mir die Augen; wo zum Teufel bin ich schreibend gelandet?
Denn es liegt mir durchaus fern, das Virus als Chance (wofür auch?) zu sehen oder es gar als Antwort der Natur auf die Verwüstungen des Anthropozäns zu interpretieren. Aber wenn uns dieses Virus schon mal zum Innehalten zwingt, wenn es unser Selbstverständnis, gerade auch als Bürger*innen einer liberalen Demokratie, so offensichtlich herausfordert: Läge nicht eine Chance darin, das Virus und was es uns abverlangt auf seine transformatorische Kraft hin zu überprüfen?
Keine Revolution, nicht gleich die Umwertung aller Werte, aber doch eine deutliche Aufwertung jener Berufe und Tätigkeiten, die sich plötzlich als systemrelevant in Bezug auf den Menschen erweisen. Wenn ich uns als Gesellschaft etwas von Herzen wünsche (nebst einem schnell und weltweit für alle verfügbaren Impfstoff), dann vielleicht dies: dass es uns gelingen möge, eine der prägenden Erfahrungen dieser Corona-Krise – nämlich dass wir Menschen fundamental aufeinander angewiesen sind, im Austausch von Wissen und Gütern, von Sorge und Fürsorge – in ein zukunftstaugliches Selbst- und Gesellschaftsverständnis umzumünzen, das auch durch die nächsten Krisen trägt.
Ich freue mich, von dir zu lesen!
Und sei herzlichst gegrüsst
Ruth
Zürich, Anfang Mai 2020
Tobias Brandner, 1965 in Zürich geboren, studierte Evangelische Theologie an der Uni Zürich und arbeitet seit Mitte der Neunzigerjahre in Verbindung mit dem Hilfswerk Mission 21 als Seelsorger in verschiedenen Gefängnissen Hongkongs. Von den Insassen hat er den Namen «Father Tobias» erhalten. An der Chinese University von Hongkong ist er zudem Professor an der Theologischen Fakultät. 2009 veröffentlichte er das Buch «Gottesbegegnungen im Gefängnis. Eine Praktische Theologie der Gefangenenseelsorge».
Ruth Schweikert, 1965 in Lörrach geboren und in der Schweiz aufgewachsen, lebt als Schriftstellerin und Theaterautorin in Zürich. Für ihre Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Kunstpreis der Stadt Zürich (2016) und dem Solothurner Literaturpreis (2016) ausgezeichnet. Zuletzt erschien «Tage wie Hunde», ein persönliches Buch über ihre Brustkrebserkrankung, das zugleich die grossen Themen des Lebens und der Literatur verhandelt.