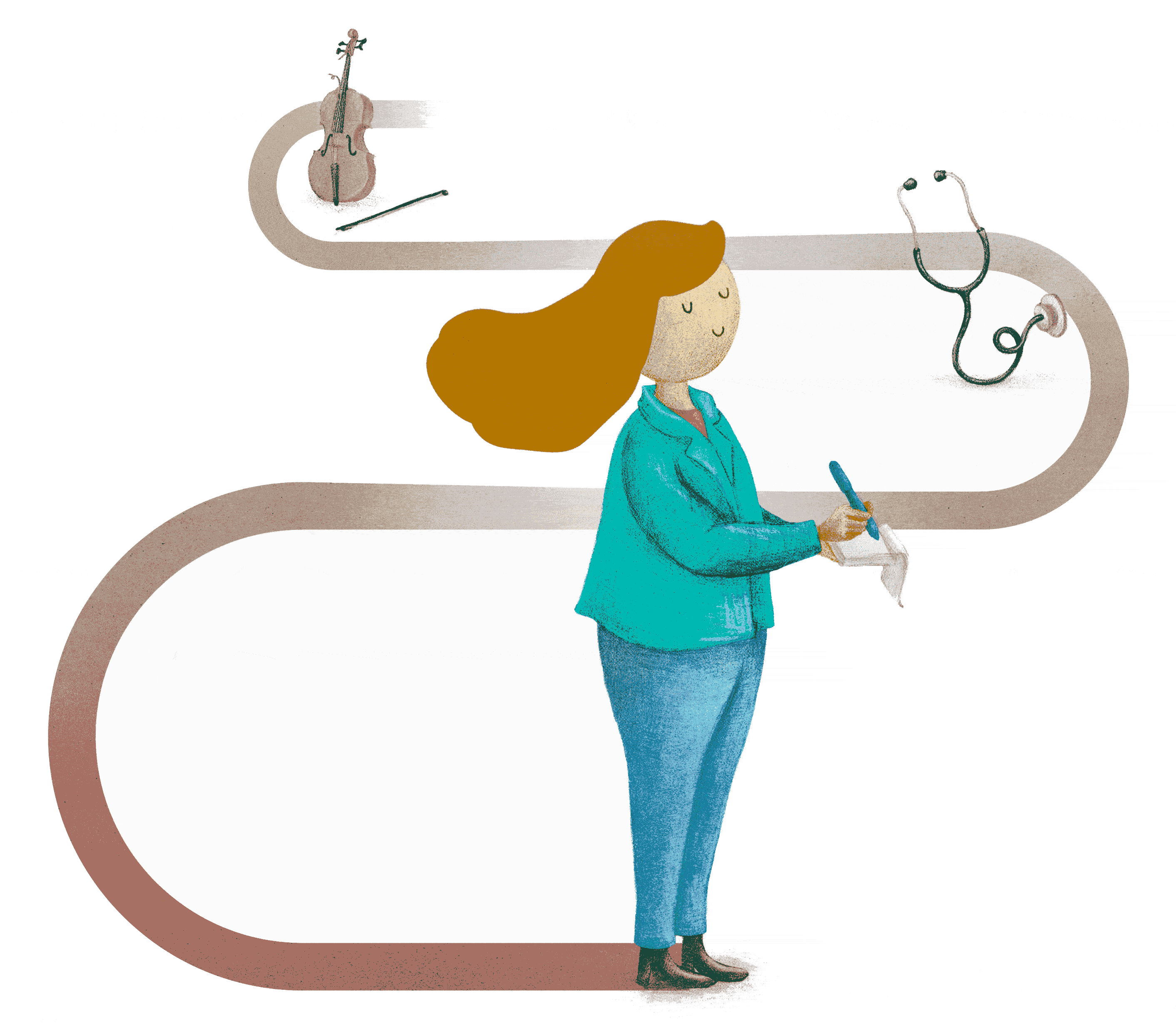
Wie ich Journalistin wurde
Idealerweise ist der Beruf eine Berufung. Doch selten verläuft ein beruflicher Werdegang direkt. Und manchmal lassen sich die Umwege erst im Nachhinein erklären. Ein Versuch.
Von Barbara Villiger Heilig (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 14.11.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
«Was willst du werden, wenn du gross bist?» Kinder antworten spontan: Zirkusakrobatin, Popstar, Schauspielerin, Polizist, Autorennfahrer, Sekretärin. Erst im Lauf des Heranwachsens kommt die Realität ins Spiel. Der Ernst des Lebens. Diese Phase der Ernüchterung setzt immer zeitiger ein.
Mittlerweile beginnt die berufliche Orientierung schon beim Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe. Entsprechend ist Berufsberatung zum eigenständigen Berufszweig angewachsen. Eine Art von overprocessing, nötig aufgrund der sich rasend verändernden Welt. Einerseits sterben Berufe aus, anderseits entstehen laufend neue. Schwierig, den Überblick zu behalten. Was sich für ihre Kinder alles anböte, wissen Eltern oft gar nicht. Deshalb werden auch sie zu Informationsveranstaltungen eingeladen.
Wo wäre ich gelandet, wenn ich eine sachlich-fachliche Beratung in Anspruch hätte nehmen können, Mitte der 1970er-Jahre, als mir die Berufswahl langsam unter den Nägeln zu brennen begann? Hätte jemand vorausgesehen, dass eine Schülerin, die sich mit ihren Deutschaufsätzen regelmässig abmühte, diese Mühe professionell institutionalisieren würde – als Journalistin? Und wenn ja, hätte ich daran geglaubt?
Solche Fragen sind falsch gestellt. Was mich betrifft, bin ich auf seltsamen Wegen ans Ziel – wenn man es so nennen will – gelangt. Auf Umwegen, die sich erst im Nachhinein aufdröseln lassen. Und die, glaube ich, unverzichtbar waren. Abnehmen konnte sie mir niemand. Abkürzungen gab es keine.
Zwänge, Zufälle, bewusste und unbewusste Wünsche: Sie beeinflussen unsere Entscheidungen. Im Fall der Berufswahl stehen die persönlichen Fähigkeiten im Vordergrund. Wofür eigne ich mich? Was mach ich gern, was gut? Kann ich mir damit dereinst den Lebensunterhalt sichern?
Angst vor dem Versagen
Bei mir war das alles ziemlich unklar. Nach der Matura, die ich problemlos hinter mich brachte, überwog paradoxerweise das Gefühl, es gerade noch einmal geschafft zu haben. Auch gute Schülerinnen und Schüler spüren den Leistungsdruck, fürchten sich vor dem Versagen. Sie akzeptieren nur Bestnoten. Was drunter ist, sehen sie als Gefahr: Hilfe, es geht abwärts! (Mein grösster Neid galt während des Gymnasiums einer Freundin, die mehrmals ins sogenannte Provisorium versetzt wurde, darob aber nie ihre Fassung verlor. Sie steigerte bloss den Einsatz, bis sie wieder im grünen Bereich war.)
Als zweischneidig erwies sich, dass mein Vater an der Schule unterrichtete, die ich besuchte. Sie wurde zu einem erweiterten Elternhaus. Ein vertrautes Terrain, auf dem ich mich zwar angstfrei bewegte, aber immer unter dem väterlichen Kontrollblick. Das Lehrerzimmer kennt keine Geheimnisse.
Meine erste Entscheidung in Sachen Berufswahl war deshalb wohl hauptsächlich vermeidungsstrategisch begründet: eine Flucht. Weg von Zürich, auf in neue Gebiete. Mit Sack und Pack beziehungsweise dem Cello reiste ich drei Tage nach Schulschluss los Richtung Deutschland. In Basel machte ich einen Zwischenstopp, um mich bei Mstislaw Rostropowitsch in den Meisterkurs zu setzen – natürlich nur als Hörerin.
Ich sehe den Künstler noch vor mir, wie er eine Orchesterpartitur am Klavier vorspielte, jeden einzelnen Ton erläuternd. Ein Vollblutmusiker. Unvergesslich ist dieser Eindruck sicher auch, weil ich in der Folgezeit zu spüren kriegte, was mir fehlte: das Selbstverständnis als Musikerin.
Nichts wie weg!
Dass ich Musik studieren würde, hatte ich zwei Jahre zuvor beschlossen, unterstützt von meinem Cellolehrer. Die Eltern winkten den eher kurzsichtigen Entschluss ohne längere Diskussionen durch. Auch dass ich unbedingt ins Ausland wollte, obwohl das Zürcher Konservatorium keinen schlechten Ruf genoss, rief erstaunlicherweise keinen Widerspruch hervor.
Aus Zürich floh ich aus zwei Gründen. Erstens wegen des akademischen Elternhauses: Die Uni wäre mir bloss wie eine Fortsetzung der Schulzeit vorgekommen. Man hätte mich weiterhin bewertet. Für ein Musikstudium hingegen galten andere Massstäbe. (Welche, zeigte sich erst nach und nach.)
Zweitens wollte ich raus aus der familiären Privatsphäre. Mit 18 Jahren hatte ich die Nase voll von den klosterähnlichen Bedingungen, die dort herrschten. Ein strenger, konservativer Vater, eine Mutter, die sich in heiklen Belangen – wie der Pubertät der drei Töchter – ihrem Ehemann unterordnete: unmöglich für uns, mit dem anderen Geschlecht, sprich Buben, in Berührung zu kommen. Zumal als Schülerinnen der Höheren Töchterschule.
Wagte es ein männliches Wesen – irgendwo hatte man sich trotz allem kennengelernt –, eine von uns anzurufen, trat der Vater in Aktion. Er bewachte das Telefon. Für allfällige Bewerber erwies er sich als abschreckendes Hindernis. Heute, im Zeitalter von Social Media, scheint so etwas nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Lage war dramatisch.
Musik und Männer
Erst das wachsende Interesse für klassische Musik öffnete mir ein Türchen zur Männerwelt. In der Tonhalle, beim Warten an der Abendkasse, lernte ich einen angehenden Geiger kennen, mit dem ich fortan Konzerte besuchte – mehrmals pro Woche. Rockkonzerte waren für meine Eltern ausgeschlossen. Gegen Klassik aber hatten sie nichts einzuwenden. Im Gegenteil.
Ob meine Musikbegeisterung echt war oder bloss ein Vorwand, mir persönliche Freiheiten zu erobern, fragte ich mich erst viel später.
Wahrscheinlich bedingte eins das andere. Jedenfalls geriet ich in einen Taumel, der Schule und Familie zur Nebensache herunterstufte. Meine Tagebücher verzeichnen eine ununterbrochene Reihe von Anlässen, bei denen Musik und Männer die Hauptrolle spielten. Wie nebenbei wuchs meine musikalische Kompetenz. Ich hörte mich durch das Repertoire, fachsimpelte über Interpretinnen und Dirigenten, erfuhr Betriebsklatsch von Orchestermusikern, auf die ich nach der Vorstellung am Künstlereingang des Opernhauses wartete. Und ich trat selbst in ein Jugendorchester ein. Jeden Samstagnachmittag probten wir, danach gingen wir aus.
Plötzlich fühlte sich das Leben wahnsinnig spannend an.
Wie eine Garantie für meine gefundene Identität trug ich das Instrument mit mir herum, von zu Hause in die Schule (wo ich Unterrichtsstunden schwänzte, um zu üben – man drückte ein Auge zu). Ein Cello ist keine Querflöte. Von Umfang und Kontur her gleicht es einer Person. Für mich wurde es zum veritablen Begleiter, an dem ich mich festhielt. Ein Alleinstellungsmerkmal.
Heimweh
Das änderte sich an der Musikhochschule in Freiburg schlagartig. Dort fiel ich nicht mehr auf. Und obwohl es Schwächere gab in der Cello-Klasse, stellten sie ihr Berufsbild keinen Moment infrage. Ich hingegen hatte gar keines, wie mir jetzt langsam dämmerte. War ich wirklich eine Musikerin?
Ausser dem Talent ist für den Musikerberuf die Überzeugung ausschlaggebend. An ihr haperte es bei mir. Eine schlechte Ausgangslage.
In der benachbarten Wohngemeinschaft, wo ich ein und aus ging, dudelte es ununterbrochen: Flöte, Oboe, Geige, Klavier, Horn. Man sprach auch vorwiegend über Musik – auf Englisch. Die Studierenden dort stammten aus Grossbritannien, den USA, Australien. Ausser musikalischen Kenntnissen erwarb ich deshalb sprachliche und interkulturelle. Oder kulinarische.
Die Freiburger McDonald’s-Filiale, eine der ersten in Deutschland, war regelmässiges Ziel gemeinsamer Expeditionen. Für die amerikanischen Mitstudierenden («Kommilitonen» genannt) verkörperte McDonald’s ein Stück Heimat in der Fremde. Und auch ich, nach dem anfänglichen Triumph schon heimwehkrank, liess mich vom Junk-Food trösten.
Ja, das Heimweh. Klar: Mangelnde Gesellschaft gab es nicht zu beklagen. Doch die alten Freundinnen fehlten mir brutal. Ich schwankte stimmungsmässig zwischen Stolz und Verlassenheit. Das Tagebuch verzeichnet hauptsächlich den Stolz. Akribisch notierte ich, wer zu meinem neuen Kreis gehörte: Mick, Greg, Marina, Thaddeus, Nancy, Christopher. Heute kommt mir diese Namenslitanei wie eine Beschwörung vor. Sie sollte die Leere füllen, die zwischen den Zeilen klafft.
Irgendwann nahm die Einsamkeit überhand. Nach zwei Semestern brach ich das Experiment ab. Direkter Auslöser dafür war eine Schulfreundin, die vorschlug, wir könnten zusammen Medizin studieren. Auch diesmal gabs keine familieninternen Auseinandersetzungen. Mein Vater war zwar grundsätzlich gegen Studienabbrüche, doch bei Medizin lenkte er ein.
Ich verschwieg wohlweislich, dass es mir gar nicht darum ging, Ärztin zu werden. Die Aussicht, auf Jahre hinaus jene Freundin an der Seite zu haben, reichte. Ganz wohl war es uns dabei allerdings beiden nicht. Jedenfalls strichen wir das Projekt schon vor dem Start. Ich schrieb mich in Zürich für Romanistik ein und suchte mir eine familienunabhängige Wohngelegenheit.
Italiensehnsucht
Die elterlichen Bedenken hinsichtlich dieser überraschenden Volte galten einzig meiner dezidierten Ablehnung des Lehrerberufs. Dieser sei, bekam ich gepredigt, für eine Literaturwissenschaftlerin die alleinige Option. Ohne Gegenbeweise liefern zu können, wehrte ich mich heftig. Dass ich dennoch bald schon Italienischkurse gab, war der finanziellen Not geschuldet. Nach diversen schlecht bezahlten Brotjobs schienen sie mir das kleinere Übel.
Was die Uni angeht, signalisiert mein Tagebuch weder Begeisterung noch Alarm: «Das Studium hat begonnen, es geht bis jetzt, d. h. ich glaube, es gefällt mir.» Im Vordergrund stand weiterhin das Cello. Wie war ich denn überhaupt darauf gekommen, Romanistik zu studieren – mit Italienisch im Hauptfach, einer Sprache, die ich erst noch richtig lernen musste?
Vermutlich genau deshalb: Sie war nicht schulisch vorbelastet. Und klang auch sonst nach einer Unbekümmertheit, die ich von früher her kannte.
Aufgrund seiner kunsthistorischen Leidenschaft hatte mein Vater uns Bildungsferien in Italien verordnet. Und obwohl er uns in Rom, Perugia, Venedig, Assisi strammen Schrittes von Kirche zu Kirche, von Museum zu Museum führte, lockerte sich seine sonst so eiserne Disziplin unter dem italienischen Einfluss. Gezwungenermassen, denn weder Museen noch Kirchen gehorchten der schweizerischen Planung: chiuso per sciopero oder chiuso per restauro signalisierten Schilder vor geschlossenen Toren. Wir, die Frauentruppe unter männlicher Leitung, atmeten auf: Unverhofft fiel die Lektion aus. Statt barocker Malerei oder Renaissancearchitektur also gelato und cappuccino an der Bar. Vielleicht ein Shopping-Bummel. Vergnügen!
Kurz: Das Unistudium sah ich als Mittel zum Zweck einer Zukunft im Paradies meiner Träume. Ein Sommer in Siena und ein Winter in Pavia italianisierten mich vollends, wobei die philologischen Studieninhalte eher Nebengeräusch blieben. Nach dem Motto: Diskothek statt Bibliothek.
In der Badeanstalt
Auch während der Uni quälte ich mich mit dem Schreiben. Trotzdem gab ich mich, als der Abschluss kam, nicht mit dem Zürcher Gymnasium zufrieden, wo ich seit geraumer Zeit als «Hilfslehrerin» unterrichtete. So kurios es klingt: Es war die Zürichsee-Badeanstalt Utoquai, die meinen beruflichen Fortgang beschleunigte. In der Badi verkehrten nebst meinen Schülern auch deren Väter, darunter Kulturschaffende und Journalisten. Mit ihnen kam ich in Kontakt. Und dank ihnen begann ich zu schreiben: Buchbesprechungen.
Fiel mir denn diese Art der Verschriftlichung von Gedanken nun endlich leichter? Keineswegs! Aber der Thrill siegte über die Widerstände, ein ums andere Mal. Das Schreiben ist Krux und Faszinosum zugleich – und wäre ein Thema für sich. Nur so viel: Schreiben kann süchtig machen. Wobei der/die Süchtige immer erst nach erfüllter Schreibaufgabe erlöst ist. Vorübergehend. Bis die nächste Herausforderung am Horizont auftaucht: lockt und droht.
Die Redaktion der Zeitung, in die ich schliesslich eintrat, liegt unweit der Badi Utoquai. Direkt verlief der Weg von da nach dort trotzdem nicht. Er führte über Verlagslektorate, Radiostudios und Italienaufenthalte.
Mahnungen von Vaterseite – die Schule, die Schule – blieben während dieser Freelance-Zeit nicht aus. Ich ignorierte sie hartnäckig. Es musste doch eine Alternative zum Lehrerberuf geben! Und siehe da, es gab sie. Eines Tages klopfte ich beim damaligen Feuilletonchef der «Neuen Zürcher Zeitung» an. Ein Jahr später stellte er mich an. Von da an hiess es learning by doing.
Mansplaining
Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt der neuen Tätigkeit: Was immer ich schrieb, erhielt Aufmerksamkeit bis in mein Elternhaus. Zum schlagenden Beweis dafür wurde ein Artikel über Lou Reed. Ja, ich schleuste Popkultur ins «NZZ»-Feuilleton ein. Und was dort gedruckt stand, nahm mein Vater ernst. Als er – der uns immer die Welt erklärt hatte! – mich um eine Lou-Reed-CD bat, war ich gleichzeitig gerührt und beschämt.
Mansplaining. Männer erklären Frauen die Welt. Der Begriff bringt auf den Punkt, was ich eine Jugend lang erlebt hatte. Und seit das Schlagwort kursiert, verstehe ich: Meine Taktik in Sachen Berufswahl zielte letztlich darauf ab, der männlichen Welterklärung nicht nur auszuweichen, sondern den Spiess umzudrehen. Selber zu erklären. Meine Welt. Den Männern – für die als Stellvertreter in unserem Frauenhaushalt der Vater figurierte.
Ist diese Erkenntnis nun erhebend oder niederschmetternd?
Im Nachhinein setzt sich ein Berufswerdegang wie der meine nahtlos zusammen, über phasenweise Entmutigung und verzweifelte Durststrecken hinweg. Es ist mir bewusst, dass ich insgesamt Glück hatte (und bereit war, es beim Schopf zu packen). Noch etwas: Heute ist die Lage komplexer. Es gibt mehr vorgeschriebene Pfade. Es werden mehr Weichen gestellt. Wäre ich jung, ich nähme sicherlich eine umfassende Berufsberatung in Anspruch.
Aber die beste Berufsberatung ersetzt nicht den wichtigsten Ratschlag: Höre auf dich! Zuallererst und immer wieder. Nur auf dieser Basis sind Konzessionen und Kurskorrekturen möglich, wie sie das Leben oft verlangt.
Das meiste von dem, was ich unterwegs gelernt habe, kam und kommt mir als Journalistin zugute. Also: no regrets. Nur das Cello blickt mich manchmal vorwurfsvoll an aus der Ecke, in der es seit längerem ungespielt steht.