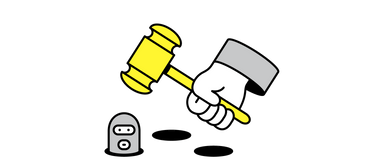
Landesverweis wegen 5334.55 Franken?
Mit der Ausschaffungsinitiative wurden Ressentiments gegen Ausländerinnen und Ausländer zum Verfassungsauftrag. Für die Gerichte bedeutet die Anwendung der neuen Regeln einen Balanceakt: Volkswille hier, Verhältnismässigkeit dort.
Von Yvonne Kunz, 30.10.2019
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Im Jahr 2010 nahmen Volk und Stände die SVP-Initiative für die «Ausschaffung krimineller Ausländer» an. Was sie verlangt, ist rechtsstaatlich heikel: Wer wegen bestimmter Straftaten verurteilt wird, wird automatisch für mindestens fünf Jahre des Landes verwiesen. Doch der Gesetzgeber hatte das Ansinnen der Initiative umzusetzen.
Gefragt war eine Lösung, die den Zweck der neuen Verfassungsbestimmungen und bestehendes Recht (namentlich den Rest der Verfassung, die Menschenrechte und das Völkerrecht) in Einklang bringt.
Der Streit war heftig, der politische Prozess für Schweizer Verhältnisse dramatisch. Die Initianten hielten selbst dann an der wortgetreuen Umsetzung fest, als das Bundesgericht 2012 in einem Leiturteil klarmachte: Die neuen Verfassungsartikel dürfen nicht über den Prinzipien der Verhältnismässigkeit und der Einzelfallprüfung stehen. Mit anderen Worten: Der Automatismus geht zu weit. Der Nationalrat brach unter dem Druck der noch harscheren Durchsetzungsinitiative 2014 trotzdem ein und beschloss die Umsetzung gemäss Initiativtext. Nicht so der Ständerat. Der pokerte, bestand auf einer Härtefallklausel – und gewann. 2015 versenkte das Volk das SVP-Anliegen, der Nationalrat lenkte ein.
Seit Oktober 2016 sind die Gesetzesänderungen in Kraft. Nun ist es an den Gerichten, die neuen Bestimmungen in der Anwendung zu konkretisieren. So ist es auch in der relevanten Literatur an verschiedenen Stellen festgehalten: «Die Gerichtspraxis wird zeigen müssen …» Liegt ein schwerer Fall vor, ein eher leichter? Wann ist eine Ausweisung verhältnismässig? Der heutige Fall zeigt, wie diese Abwägungen gemacht werden.
Ort: Obergericht Zürich
Zeit: 3. Oktober 2019, 8.30 Uhr
Fall-Nr.: SB190071
Thema: Unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung
Kaum 20 Minuten dauert der Berufungsprozess am Zürcher Obergericht. Staatsanwalt Alain Fischbacher argumentiert mit dem Volkswillen: Ausländische Personen, die unrechtmässig Sozialleistungen beziehen, müssten das Land verlassen. So weit, so einfach. Dieser Grundsatz ist seit der Annahme der Ausschaffungsinitiative in Artikel 121 der Bundesverfassung (BV) verankert.
Die dortigen Bestimmungen zu Aufenthalt und Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern wurden damit um Katalogtaten ergänzt, bei deren Begehung und rechtskräftiger Verurteilung Ausländer in jedem Fall, unabhängig von Tatschwere und Strafe, automatisch ihr Aufenthaltsrecht verlieren: In Artikel 121 Absatz 3a BV sind die schweren Anlasstaten wie Mord, Betrug oder Vergewaltigung aufgelistet – in Absatz 3b folgt: der Sozialversicherungsmissbrauch.
In Artikel 5 BV steht aber auch, dass staatliches Handeln stets verhältnismässig sein soll. Der Grundsatz durchzieht als Leitgedanke die gesamte Rechtsordnung, um die Bürgerinnen vor übermässigen Eingriffen des Staats zu schützen.
In diesem Sinne hält auch Alessandro Palombo, der Verteidiger des geständigen Sozialversicherungsschwindlers, dagegen: Der Deliktsbetrag sei zu gering, um eine Landesverweisung zu rechtfertigen. Schon gar nicht in die Dominikanische Republik. Da könne der Beschuldigte seine Tochter kaum noch sehen. Tat und Strafe stünden in keinem Verhältnis.
Natürlich, ein Beschiss bei den Sozialleistungen ist verwerflich. Doch dass jemand, der das Sozialsystem um ein paar Tausend Franken prellt, punkto Landesverweisung gleichgestellt wird wie jemand, der mordet oder vergewaltigt, verstösst nicht nur gegen Rechtsprinzipien. Sondern auch gegen den gesunden Menschenverstand.
Das dachte sich wohl auch der Gesetzgeber bei der Schaffung des Tatbestands des «unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung» in Artikel 148a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs.
Aber zuerst zu Absatz 1 der Norm. Vor der Inkraftsetzung der neuen Gesetze war der Sozialhilfemissbrauch kein eigenes Delikt, sondern wurde dem Betrug zugerechnet – ein Katalogdelikt. Doch ein Beschiss ist juristisch gesehen noch kein Betrug. Dieser setzt Arglist voraus, und eine Täuschung ist nur dann arglistig, wenn sie nicht ohne weiteres entdeckt werden kann. Das blosse Vorenthalten von Informationen reicht dafür nicht aus. Um dem Volkswillen einer verschärften Praxis Genüge zu tun, hat die Gesetzgeberin einen «Auffangtatbestand für leichtere Fälle» geschaffen. Um diesen zu erfüllen, ist keine Arglist nötig, «unwahre oder unvollständige Angaben» oder «Verschweigen von Tatsachen» genügen, so der Wortlaut von Artikel 148a Absatz 1 Strafgesetzbuch.
Absatz 2 des gleichen Artikels fügt einen einzigen Satz hinzu: In leichten Fällen sei eine Busse auszufällen. Eine bemerkenswerte Ergänzung. Sozusagen der Auffangabsatz des Auffangtatbestands. Denn in leichten Fällen greift der Ausschaffungsautomatismus in der Regel nicht; wenn lediglich eine Busse ausgesprochen wird, schon gar nicht. Alles andere würde gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen.
Genau diese Frage stellt sich beim jungen Mann aus der Dominikanischen Republik. Liegt hier ein leichter oder ein schwerer Fall vor? Aber was sind die Abgrenzungskriterien? Der Deliktsbetrag? Und falls ja: Was gilt?
Das fragte sich auch das Bezirksgericht Winterthur, das sich als erste Instanz mit diesem Fall befasst hat. Sind es die 300 Franken, die das Strafgesetzbuch als «geringfügiges Vermögensdelikt» definiert? Oder ist es der Vorschlag der Schweizerischen Staatsanwaltschaftskonferenz: 3000 Franken? Stimmt allenfalls das, was der Schweizer Jurist Matthias Jenal zu bedenken gibt: dass theoretisch auch 30’000 Franken ein leichter Fall sein können, je nach Begleitumständen? Der Autor nennt Deliktdauer, Beweggründe, kriminelle Energie.
Beim Beschuldigten geht es um exakt 5’334.55 Franken. Der Mann war beim Arbeitslosenamt gemeldet, erhielt Arbeitslosengeld. Seine finanzielle Lage: prekär. Viele offene Rechnungen. Vor allem aber befürchtete er, seine Ex-Frau würde ihm das Besuchsrecht beim gemeinsamen Kind verweigern, wenn er die Alimente nicht bezahlt, 1600 Franken monatlich. Also verschwieg er dem Amt, dass er wieder Arbeit auf dem Bau gefunden hatte. Erst nach zwei Monaten meldete er die neue Stelle.
Dem Amt entging die verspätete Meldung nicht, es erstattete Anzeige. Staatsanwalt Fischbacher klagte auf einen schweren Fall und verlangte eine Landesverweisung von fünf Jahren. Das Bezirksgericht Winterthur sah die Sache jedoch als leichten Fall – also keine Ausweisung.
Der erstinstanzliche Einzelrichter scheint allerdings wenig überzeugt. Zum Deliktsbetrag sagt er: «nicht enorm hoch», aber auch nicht «marginal». Das Verschulden: nicht erheblich, aber innerhalb des leichten Spektrums schwer.
Das Urteil räumt auch jegliche Zweifel aus, was einen allfälligen Härtefall betrifft. Der 29-jährige Dominikaner ist seit neun Jahren in der Schweiz – bei einem hier Geborenen sähe es gemäss Gerichtspraxis anders aus. Der Mann ist gesund, geniesst also nicht den Schutz eines Kranken. In der Schweiz hat er auf Baustellen, als Kurierfahrer und in der Gastronomie gejobbt, in der Heimat eine Hotelfachschule absolviert. Eine Ausschaffung, das schimmert zwischen den Zeilen des Winterthurer Urteils durch, wäre deshalb verhältnismässig. Wenn nicht gar vorteilhaft für den Mann: Ausser seiner Tochter und der Ex-Frau lebe seine gesamte Familie in der Dominikanischen Republik.
Wie auch der Beschuldigte selbst, derzeit, sagt sein Verteidiger vor dem Zürcher Obergericht. Der Staatsanwalt hatte gegen das Winterthurer Urteil Berufung eingelegt, er fordert Klarheit für künftige Fälle, ein Präjudiz. Er will wissen, was unter einem leichten oder einem schweren Fall zu verstehen ist. Wo die Grenze liegt. Und er pocht auf die vielbeschworene «pfefferscharfe» Umsetzung des Volkswillens: Vor Obergericht verlangt er eine Verurteilung wegen eines schweren Sozialhilfebetrugs – oder, anders gesagt, den Landesverweis.
Das sei jetzt eben «Rechtsfortbildung», meint der Gerichtsvorsitzende Martin Langmeier zum Ende des Prozesses: die demokratische Verantwortung der Gerichte, die Auslegung der Gesetze, deren praktische Anwendung. Das, was die bundesrätliche Botschaft bei Artikel 148a Strafgesetzbuch verlangt: «Die Grenzziehung zwischen einem leichten und nicht mehr leichten Fall wird durch die Gerichtspraxis zu entscheiden sein.»
Zum ersten Mal, sagt der Gerichtspräsident, äussere sich ein Obergericht zur Frage des Landesverweises bei Sozialhilfemissbrauch. Man werde es schriftlich tun, aus Kostengründen. Einige Tage später, in einem zweiseitigen Urteilsdispositiv: Das Obergericht bestätigt den leichten Fall, erhöht die Busse aber von 2000 auf 3000 Franken.
Staatsanwalt Alain Fischbacher übergibt das Urteilsdispositiv unverzüglich der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich: zur Prüfung eines Weiterzugs ans Bundesgericht. Doch diese verzichtet.
Illustration Till Lauer