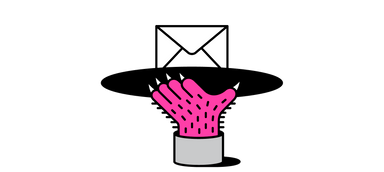
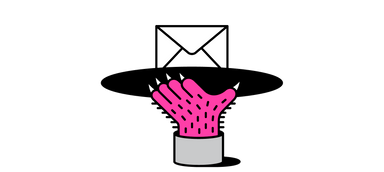
Schweizer Anwälte helfen Geldwäschern, die EU erhält die Kohäsionsmilliarde – und wie ein Rücktrittsgerücht entsteht
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (162).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 07.10.2021
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Könige, Prominente und Potentatinnen verstecken ihr Geld in Steuerparadiesen – und die Schweiz mischelt kräftig mit. Das ist unterdessen schon fast ein Klischee, doch das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten (englisch: International Consortium of Investigative Journalists) bestätigt es mit seiner aktuellen Recherche einmal mehr. Und bringt das Parlament unter Zugzwang.
Nach den «Panama Papers» 2016 und den «Paradise Papers» 2017 sorgen jetzt die sogenannten «Pandora Papers» weltweit für Aufsehen – und Unruhe in Bern. Das neue Leak öffnet, wie der Titel ankündigt, sprichwörtlich die Büchse der Pandora: Es wird unappetitlich, Donnergrollen aus dem Pantheon inklusive. Aber: Illegal sind die bisher bekannten Machenschaften nach Schweizer Recht nicht.
Laut der aufwendigen internationalen Recherche (rund 11,9 Millionen Dokumente wurden ausgewertet) nutzen Hunderte Politikerinnen und Geschäftsleute Briefkastenfirmen in Offshore-Ländern, um im eigenen Land Steuern zu sparen. Ihnen behilflich sind rund 90 Schweizer Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien und Notariate. In den meisten Fällen haben diese Unternehmungen als Mittelsleute agiert, um Briefkastenfirmen im Ausland zu eröffnen. Ein eher skurriler Fall ist dabei eine Schwyzer Atemtherapeutin, die offenbar das Offshore-Imperium der aserbeidschanischen Präsidentenfamilie betreute. Auch der jordanische König Abdullah II. erhielt Hilfe aus der Schweiz. Er erwarb über Briefkastenfirmen herrschaftliche Häuser im kalifornischen Malibu.
Und in Bern?
Keine 24 Stunden nach den ersten Enthüllungen (die Geschichten und Recherchen auf der Basis solcher Grossrecherchen werden meist gestaffelt veröffentlicht) stand die SP in einer improvisierten Medienkonferenz parat, um die Debatte über das erst im Frühling verabschiedete revidierte Geldwäschereigesetz neu zu entfachen. Mittels parlamentarischer Initiative will sie erreichen, dass künftig auch Berater dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden. Auch für Anwältinnen und andere Mittelsleute soll die Sorgfalts- und Meldepflicht gelten.
Einer, der das Pandora-Debakel hat kommen sehen, ist Finanzminister Ueli Maurer. Er wollte vergangen Herbst im Ständerat noch verhindern, dass seine Parteikollegen im Verbund mit FDP und Mitte die nun angeprangerten Treuhänderinnen vom Geldwäschereigesetz befreien: «Wenn Sie die Berater herausbrechen, (…) kommen wir wieder damit, das kann ich Ihnen jetzt schon versichern …» Denn dadurch bliebe eine Gesetzeslücke, «die wieder moniert wird, das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren». Maurers Worte halfen nichts, die vielen Anwälte im Parlament überzeugten eine Mehrheit, eine breitere Unterstellung ihrer Branche unter das Geldwäschereigesetz zu verwerfen.
Jetzt, nach den «Pandora Papers», könnte die bürgerliche Mauer bröckelig werden. Der Schweizer Geldwäschereiexperte Mark Pieth attestiert der SP und den Korruptionsjägerinnen jedenfalls gute Erfolgsaussichten: «Die Schweiz wird international gezwungen, die Anwälte, die zum Beispiel solche Gesellschaften gründen, auch unters Geldwäschereigesetz zu stellen», sagte er zu SRF.
Einige Bürgerliche fordern bereits Verschärfungen: Anwalt und FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann sagt: «Ich habe wenig Vertrauen, dass sich Anwälte und Treuhänder gut selber beaufsichtigen.»
Andere würden den Sturm gerne aussitzen. Wie ein Löwe verteidigte etwa der Walliser Anwalt und Mitte-Ständerat Beat Rieder vor einem Jahr die jetzige Gesetzeslage. Die Schweiz sei «ein Musterknabe der Geldwäschereibekämpfung», sagte der Präsident der Rechtskommission damals. Nun spricht er angesichts der «Pandora Papers» von «Einzelfällen» und findet, die bestehenden Gesetze würden ausreichen. Dabei zieht er einen eigenwilligen Vergleich: «Wir haben auch nicht durch eine ausgebaute Gesetzgebung bei der Drogenbekämpfung den Drogenhandel vernichtet.»
In der griechischen Sage machte Pandora den Deckel übrigens zu schnell wieder drauf. Während die Plagen entwischen konnten, blieb die Hoffnung in der Büchse stecken. Wir warten gespannt auf weitere Recherchen.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Kohäsionsmilliarde: Parlament erteilt Freigabe ohne Bedingungen
Worum es geht: Zum Abschluss der Herbstsession haben National- und Ständerat am vergangenen Donnerstag zugestimmt, den seit zwei Jahren ausstehenden Kohäsionsbeitrag in Höhe von 1,3 Milliarden Franken ohne neue Bedingungen an die Europäische Union auszuzahlen. Gut drei Viertel davon kommen Entwicklungsprojekten in 13 östlichen EU-Ländern zugute; 200 Millionen Franken sind für Projekte im Bereich Migration und Asyl in einzelnen EU-Staaten vorgesehen.
Warum Sie das wissen müssen: Im Grundsatz hatte das Parlament dem zweiten Schweizer Kohäsionsbeitrag bereits vor zwei Jahren zugestimmt. Allerdings wollte es ihn nur ausbezahlen, wenn die EU auf diskriminierende Massnahmen gegen die Schweiz verzichtet – gemeint war damit vor allem, dass die EU die Börsenäquivalenz wieder anerkennt, welche sie im Juni 2019 hatte auslaufen lassen. Nun stellen National- und Ständerat keine Bedingungen mehr, obwohl sich die EU in den letzten zwei Jahren nicht auf die Schweiz zubewegt hat. Mit der Freigabe der Gelder verbindet das Parlament die Hoffnung, dass die EU die Schweiz beim Forschungsprogramm Horizon Europe ab Anfang 2022 wieder als assoziierten Drittstaat einstuft. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Ein Sprecher der EU-Kommission erinnerte daran, dass der Kohäsionsbeitrag nichts anderes als eine «natürliche, logische Gegenleistung für die Schweizer Teilnahme am wichtigsten Binnenmarkt der Welt» sei. In Zukunft brauche es einen Mechanismus, der sicherstelle, dass die Schweiz einen finanziellen Beitrag leiste, der den Standards der EU und der Efta/EWR-Staaten entspreche. Angesichts dessen, dass Norwegen pro Jahr rund dreimal mehr zahlt als die Schweiz, dürfte das heissen: Es wird teurer.
Wie es weitergeht: Einen letzten Stolperstein gibt es – Bern und Brüssel müssen als Grundlage für die Zahlung der Kohäsionsmilliarde ein sogenanntes Memorandum of Understanding aushandeln. Die EU-Kommission will, dass der Schweizer Beitrag darin klar als Preis für die Teilnahme am Binnenmarkt bezeichnet wird; der Bundesrat will davon nichts wissen, weil das Geld nicht in den allgemeinen EU-Topf komme, sondern direkt an Projekte in ärmeren Mitgliedsstaaten Osteuropas gehe.
«Weil Applaus nicht reicht»: Abstimmungskampf um Pflegeinitiative eröffnet
Worum es geht: Das Komitee hinter der Pflegeinitiative hat seine Kampagne gestartet. Laut den Initiantinnen ist der Pflegenotstand keine Bedrohung mehr, sondern längst Realität. So seien derzeit 11’000 Pflegestellen in der Schweiz unbesetzt, davon 6200 Pflegefachpersonen. «Die heutige Situation ist unhaltbar, weil die Zeit für eine gute, sichere und menschliche Pflege fehlt. Die Pflegenden sind chronisch überlastet, erschöpft und frustriert», so das Komitee.
Warum Sie das wissen müssen: Die Initiative wurde vor Corona gestartet, seither hat die Pandemie die Probleme in der Pflege noch verschärft. Darauf spielt der Slogan der Initiative an: «Weil Applaus nicht reicht». Dass es Probleme gibt, sieht auch das Parlament und hat darum einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Kern davon ist eine Ausbildungsoffensive: Die Kantone sollen Beiträge an die Lebenshaltungskosten der angehenden Pflegefachleute leisten. Kosten würde dies rund eine Milliarde in den nächsten acht Jahren. Das reiche bei weitem nicht, so Marina Carobbio, Tessiner SP-Ständerätin, Ärztin und Mitglied des Initiativkomitees: «Wir wissen, dass rund ein Drittel der Pflegefachpersonen bereits kurz nach dem Abschluss im Alter zwischen 20 und 24 Jahren aus dem Beruf aussteigt. Es braucht eine frühzeitige und verbindliche Bekanntgabe der Dienstpläne, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, familienfreundliche Strukturen und Möglichkeiten zu Lohnerhöhungen.» Zudem soll eine Pflegefachperson «abhängig von ihrem Bereich nur für eine maximale Anzahl an Patientinnen zuständig sein», so Mitte-Nationalrat Christian Lohr. Dies garantiere die Qualität, die Patientensicherheit und einen effizienten Mitteleinsatz. Für den Bundesrat geht die Initiative zu weit, auch weil sie verlangt, dass Pflegefachpersonen künftig gewisse Leistungen direkt zulasten der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen können.
Wie es weitergeht: Am 28. November kommt die Initiative an die Urne. Wird sie abgelehnt (und kein Referendum ergriffen), tritt automatisch der indirekte Gegenvorschlag in Kraft. Zuletzt hat die FDP die Nein-Parole ergriffen, Ja sagen die EVP, die Grünen Schweiz und die SP Schweiz. Stimmfreigabe hat die Mitte beschlossen. Die SVP wird ihre Parole am 23. Oktober fassen.
Gerüchtekoch der Woche
Der Feierabend rückte näher, als die «Aargauer Zeitung» am letzten Donnerstag um halb sechs ein Gerücht aus dem Bundeshaus publik machte, wonach Bundesrat Ueli Maurer am nächsten Tag möglicherweise zurücktreten werde. Zurück an den Schreibtisch, hiess das für viele Journalistinnen, um die Spekulation subito weiterzuverbreiten. Dann kam der Freitag und mit ihm die Bundesratssitzung, aus der allerlei Beschlüsse vermeldet wurden, aber kein Rücktritt. Dafür meldete sich nach dem Zmittag ein Journalist des «Tages-Anzeigers» auf Twitter mit einer «Hypothese», wie es zum Rücktrittsgerücht gekommen sein könnte. Der Journalist hatte nämlich mit einem Kollegen recherchiert, wer Maurer nachfolgen könnte, wenn der dann irgendwann zurücktritt. Am Donnerstagnachmittag wollten dann plötzlich andere Journis von den Rechercheuren wissen, ob sie etwas über einen Rücktritt am Freitag gehört hätten. Hatten sie nicht, doch das hinderte die Konkurrenz nicht daran, über einen bevorstehenden Abgang Maurers zu unken. Also publizierte der «Tages-Anzeiger» umgehend den nun topaktuellen Artikel über potenzielle Nachfolgerinnen. Die Moral von der Geschichte präsentierte der Tagi-Journi gleich selbst: «Im Rückblick vermute ich, dass wir mit unseren Recherchen in der Wandelhalle die Gerüchteküche unbewusst und unabsichtlich überhaupt in Gang gesetzt haben …»
Illustration: Till Lauer