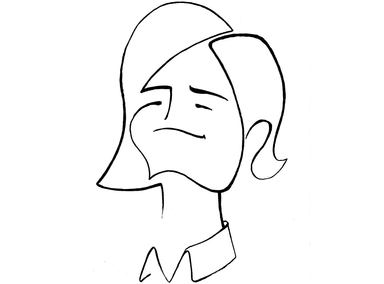
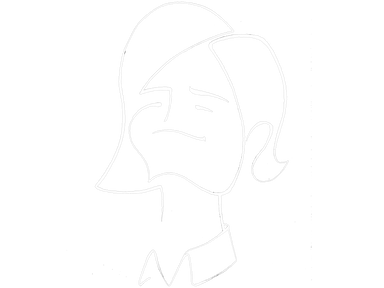
Wer legitimiert politische Gewalt?
Das Wahlkampfjahr 2023 nimmt in Stäfa eine äusserst hässliche Wendung. Ähnliche Vorfälle gab es auch schon vor den Wahlen 2019. Doch damals waren die Reaktionen vollkommen anders.
Von Daniel Binswanger, 20.05.2023
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Es ist ein unerquickliches Thema, aber es sollte ernst genommen werden: Die von SVP-Nationalrat Andreas Glarner ausgelöste Eskalation rund um den Gender-Tag an einer Schule in Stäfa im Kanton Zürich ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Gradmesser dafür, wie kurz wir davor stehen, dass Drohungen und gewalttätige Aktionen zum gängigen Modus Operandi des Schweizer Rechtspopulismus werden.
Die Schweizer Öffentlichkeit hat sich in den letzten Jahren verändert, Gewaltandrohungen haben sich banalisiert. Die sozialen Netzwerke, die Massnahmengegner, die Putin-Versteher tun ihre Wirkung. In der «Weltwoche» rief Nicolas Rimoldi letztes Jahr eben mal rasch zum Aufstand gegen die Schweizer Regierung auf: «Entweder erheben wir uns und zwingen unsere Regierung zum Rücktritt und retten die Seele der Eidgenossenschaft oder die Willensnation Schweiz ist gescheitert.» Rechtes Insurrektions-Pathos wird Courant normal. Im Herbst will sich Rimoldi in den Nationalrat wählen lassen.
Nicht nur die Aktion von Andreas Glarner belegt die Banalisierung von Gewaltandrohungen. Eine deutliche Sprache sprechen auch die Positionsbezüge, zu denen sein blödsinniger Anti-Gender-Tag-Stunt – oder wie immer man das nennen soll – geführt hat. Nicht nur die Reaktionen innerhalb der SVP sind aussagekräftig, sondern auch die Beurteilung des Vorfalls durch die Schweizer Medien.
Nationalrat Glarner hat bekanntlich einen Twitter-Mob angestachelt (der Tweet ist bis heute nicht gelöscht), um eine banale Schulveranstaltung, an der über Geschlechter-Rollenbilder diskutiert wird und die seit zehn Jahren regelmässig stattfindet, zu verhindern. Er publizierte die Telefonnummer und den Namen der verantwortlichen Sozialarbeiterin, was zu so massiven Drohungen führte, dass die Lehrveranstaltung abgesagt werden musste.
Der «Gender-Tag» gehört zum Lehrplan 21 und wird im ganzen Kanton Zürich im zweiten Sekundarschuljahr durchgeführt. Bisher war das unbestritten. Jetzt hat ein SVP-Politiker das anders gesehen. Und einen Mob von der Leine gelassen, der ohne Mühe Fakten schuf.
Trotz der Absage musste die Polizei am Montag zum Schutz der Schule intervenieren. Das ist gravierend, doch damit nicht genug. Glarners Nationalratskollege Roger Köppel, der in seinem Videoformat «Weltwoche daily» schon gegen die Sekundarschule von Stäfa mithetzte, überbot diese Aktion gleich noch mit weiteren Anti-LGBTQIA+-Gewaltdrohungen.
Diesen Samstag findet eine Ausgabe von «Drag Story Time» statt, eine Lesestunde, in der Dragqueens Kindern zwischen drei und acht Jahren Märchen erzählen. Köppel hat die «Drag Story Time» diese Woche in einem «Weltwoche daily»-Beitrag nicht nur zu einem Anschlag auf die Werte der traditionellen Familie erklärt, sondern auch noch Ort und Zeit der Veranstaltung genannt – eine Wiederholung der impliziten Aufmunterung zu Gewalttätigkeit im Stil von Glarner.
Man kann diese «Dienstleistung» von Köppel an ein bestimmtes Segment seiner Hörerschaft schon deshalb nicht als zufällig betrachten, weil bereits vor einem halben Jahr eine «Drag Story Time»-Veranstaltung von Neonazis gestört wurde. Republik-Kollege Daniel Ryser hat den Köppel-Appell an seine Neonazi-Gefolgschaft mit der gebotenen Sorgfalt rekonstruiert.
Aufschlussreich an dieser Affäre ist die Tatsache, dass Andreas Glarner nicht zum ersten Mal die Telefonnummer einer Verantwortungsträgerin aus dem Bildungswesen öffentlich macht, um ihm missliebige Personen zu bedrohen und in Gefahr zu bringen. Er tat dies bereits im Jahr 2019, als er die private Handynummer und die Wirkungsstätte einer Zürcher Lehrerin ins Netz stellte. Die Lehrerin wies in einem Brief an die Eltern ihrer Klasse darauf hin, dass muslimische Schülerinnen während des Ramadan vom Unterricht dispensiert werden können, ohne dass dafür Joker-Tage eingesetzt werden müssen – genau so, wie es in der Volksschulverordnung mit Bezug auf hohe religiöse Feiertage festgehalten wird.
Die Unbelehrbarkeit des SVP-Politikers schafft so etwas wie eine Versuchsanordnung, an der Veränderungen der Funktionsweise von öffentlichen Auseinandersetzungen abgelesen werden können: Was unterscheidet Glarner 2023 von Glarner 2019?
Im Wahljahr 2019 hat der Aargauer Nationalrat die Lehrerin auf Facebook dem Mob preisgegeben – und musste sich bereits fünf Tage danach entschuldigen. Die Empörung über Andreas Glarner war einhellig, er kam sofort unter massiven Druck. Im Wahljahr 2023 ist alles ganz anders: Es ist nun elf Tage her, dass die Sozialarbeiterin in Stäfa in Gefahr gebracht worden ist, aber eine Entschuldigung ist nicht in Sicht. Was vor vier Jahren sofort unausweichlich wurde, ist heute nicht mehr nötig. Ganz im Gegenteil.
2019 hat sich die SVP sofort mit weitestgehender Geschlossenheit gegen ihren Irrläufer gestellt. Christoph Blocher sagte in einem Interview: «Das ist nicht in Ordnung.» SVP-Wahlkampfchef Adrian Amstutz sagte, ein «solches Theater» könne die Partei in einem Wahljahr nicht gebrauchen. Heute ist das sehr viel unklarer: Gerade in einem Wahljahr ist diese Art der Machtdemonstration vielleicht ja gar nicht unwillkommen.
Als einsamer Rufer in der Wüste hat wenigstens Lukas Bubb, der Präsident der SVP-Ortssektion in Stäfa, öffentlich bedauert, dass es zu Gewaltandrohungen und persönlichen Beleidigungen gekommen sei. Bubb ist der lokale SVP-Präsident, scheiterte aber sowohl als Gemeinderats- als auch als Kantonsratskandidat. 2019 war es das nationale SVP-Schwergewicht Adrian Amstutz, das Glarner in den Senkel stellte. 2023 ist es ein politischer Fusssoldat. Ansonsten kommt aus den Reihen der Volkspartei bisher wenig öffentliche Kritik – mit der löblichen Ausnahme der Zürcher Kantonsrätin Susanne Brunner. Die parteiinterne Haltung zu Politik per Gewaltandrohung hat offensichtlich einen Entwicklungsprozess durchgemacht.
Im Wahljahr 2019 versuchte sich Roger Köppel nach dem Glarner-Fauxpas sofort in Schadensbegrenzung und publizierte in der «Weltwoche» ein exklusives Interview mit dem SVP-Hardliner. In dem wurde einerseits herausgestrichen, was für eine herzensgute, patriotische Seele Glarner doch ist, andererseits stand im Zentrum, dass der Nationalrat sich entschuldigt hat, seinen Fehler bedauert und nicht auf die leichte Schulter nimmt.
Im Wahljahr 2023 ist diese Strategie in ihr Gegenteil umgeschlagen: Nicht nur war Köppel an der Aufhetzung gegen den Gender-Tag beteiligt und legte mit dem Aufruf gegen die «Drag Story Time» noch einmal nach, auch publizistisch geht die «Weltwoche» heute mit der Angelegenheit in diametral entgegengesetzter Weise um.
Jetzt geht es nicht mehr um Schadensbegrenzung, sondern darum, den Vorfall so offensiv wie möglich auszuschlachten. Die Kritiker von Glarner werden als Ideologen, Hysterikerinnen, Antidemokratinnen, absolutistische Obrigkeiten mit «gepuderten Perücken» abgetan. Köppel und andere «Weltwoche»-Autoren wie Christoph Mörgeli werfen den Kritikerinnen der Anti-Gender-Tag-Aktion – und insbesondere dem bürgerlichen Gemeinderat von Stäfa – eine Ancien-Régime-Attitüde vor. In ihrem Narrativ ist es eine basisdemokratische Volksbewegung, die sich gegen den Gender-Tag mobilisierte. Einerseits soll es einen Internet-Mob trotz massivsten Drohungen gegen die Schule gar nicht gegeben haben, und andererseits soll Glarner bei seiner Aufpeitschung – so es ihn denn doch gegeben hätte – nicht die geringste Rolle gespielt haben.
Wer sind die wahren Demokraten? Die Männer, die für Morddrohungen sorgen. Wer sind die Antidemokraten? Bürgerinnen, die das nicht gut finden. Die stattdessen eine «absolutistische, intolerante, unwissenschaftliche und linke Gender-Ideologie» (O-Ton Mörgeli) durchsetzen wollen. Innerhalb von nur einer Legislaturperiode hat sich der Status der Gewaltdrohung innerhalb dieses SVP-Diskurses in sein Gegenteil verkehrt: Von einem anerkannten Verstoss gegen die demokratische Grundordnung ist sie zum Tatbeweis demokratischer Gesinnung geworden. Wer glaubt allen Ernstes, dass solche Verschiebungen keine Folgen haben werden?
Dass Roger Köppel eine solche Entwicklung mit aller Kraft befeuert, kann im Übrigen nicht erstaunen. Vor drei Wochen hat er ein Interview mit Marija Lwowa-Belowa veröffentlicht, der in Den Haag wegen schwerer Kriegsverbrechen und der Verschleppung von Tausenden ukrainischen Kindern angeklagten «Kinder-Ombudsfrau» von Wladimir Putin. Er stellt Fragen wie: «Wie würden Sie Präsident Putin charakterisieren?» Er bekommt Antworten wie: «Er ist für mich ein echter Vater Russlands.»
Aus welchem Grund soll ein Mann, der diese Art von Propaganda betreibt, nicht die Russifizierung der Schweizer Politik anstreben? Die «Weltwoche» ist weit vorangeschritten mit dem Versuch, faschistische Gewaltakte als volksverbundene Basisdemokratie zu codieren. Sollte es in Zukunft zu ernsthaften Zwischenfällen kommen, dürften in diesem Diskurs die Schuldigen bereits zweifelsfrei feststehen: nicht die Täter, sondern ihre politischen Gegner.
Illustration: Alex Solman