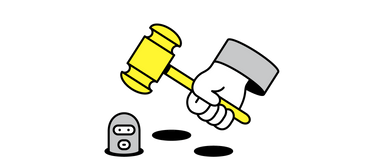
Die schwarze Mütze
Eine Massenschlägerei unter Männern in der Luzerner Altstadt am helllichten Tag führt zu einem Strafbefehl wegen Landfriedensbruchs. Mangels Beweisen für andere Straftaten?
Von William Stern, 26.04.2023
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Der Straftatbestand des Landfriedensbruchs ist mit einer langen und unrühmlichen Geschichte ausgestattet. Als historischer Weggefährte von Massendemonstrationen hat er vom Globuskrawall 1968 über die Jugendunruhen in den 1980er-Jahren, die Central-Krawalle 2011, zahllose 1.-Mai-Nachdemonstrationen bis hin zu den Basel-nazifrei-Protesten alle kleineren und grösseren Kundgebungen begleitet, die an irgendeinem Punkt in Gewalt umschlugen: Stets flatterten den Leuten im Nachgang Landfriedensbruch-Vorwürfe in die Briefkästen. Oft unabhängig davon, ob sich die Beschuldigten selber an Gewalttätigkeiten beteiligt, sich einfach in der Menge befanden oder nur als Beobachter danebengestanden hatten.
Auch Journalistinnen, Fotografen oder unbeteiligte Zuschauerinnen kann es treffen. Begründet wird dies nicht zuletzt mit einer angeblichen massenpsychologischen Wirkung: Die blosse Anwesenheit kann in dieser Lesart die Dynamik der Masse negativ beeinflussen.
Im Basler Kommentar, einem Nachschlagewerk zum Strafgesetzbuch, heisst es zum Landfriedensbruch: «Die Bestimmung wird nicht konsequent, sondern selektiv, primär gegen ‹Aktivisten› angewendet, die mit vermindertem beweisrechtlichem Aufwand verfolgt werden können, und ist so Teil einer prozessualen Entlastungsstrategie zur Bewältigung von Massendelikten.»
Neben diesen vornehmlich politischen Einsatzfällen kommt der Landfriedensbruch bei einem zweiten grossen Themenfeld zur Anwendung: Ausschreitungen unter Fussballfans, Ultras, Hooligans oder wie man die Menschen auch immer nennen mag, für die der öffentliche Raum die Erweiterung ihres Boxrings darzustellen scheint.
Ort: Bezirksgericht Luzern
Zeit: 13. April 2023, 14 Uhr
Fall-Nr.: 2Q1 22 113
Thema: Landfriedensbruch
Der Luzerner Rathausquai liegt zwischen der weltberühmten Kapellbrücke und dem Rathaus, Sitz der Regierung. «Sehen und gesehen werden ist hier das Motto», schreibt Schweiz Tourismus auf seiner Website. Für die 20 bis 30 Personen, die hier am 28. November 2021 Faustschläge und Fusstritte austeilen, als befänden sie sich in einem Mixed-Martial-Arts-Werbevideo, dürfte dieses Motto nur bedingt gelten. Die Männer, ausgewaschene enge Bluejeans, schwarze Kapuzenpullover oder Jacken, so ist es auf Handyaufnahmen zu sehen, sind allesamt vermummt. Ihre Identität, das ist zu vermuten, würden sie lieber nicht preisgeben.
Nach gerade einmal 45 Sekunden ist der Spuk vorbei, noch bevor die Polizei eintrifft, machen sich die Männer aus dem Staub. Die eine Fraktion via Rathaustreppe, die andere via Badergässli. Wie die Luzerner Polizei später in einer Medienmitteilung schreibt, handelte es sich bei den Vermummten mutmasslich um Fans des FC Luzern und des FC Basel, deren Teams später an diesem Sonntag auf dem Rasen aufeinandertrafen.
Eineinhalb Jahre später steht der 29-jährige Raphael Koller vor dem Bezirksgericht Luzern. Koller, der in Wirklichkeit anders heisst, hatte einen Strafbefehl wegen Landfriedensbruchs angefochten. Die Staatsanwaltschaft fordert darin eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 140 Franken – bedingt. Ein sogenannter Cold Hit hat die Ermittlungsbehörden zu Koller geführt: eine schwarze Mütze, die am Tatort gefunden wurde und deren DNA mit derjenigen Kollers übereinstimmte.
Im Gerichtssaal 2 des Bezirksgerichts ist es an diesem Donnerstagnachmittag eng. So eng, dass die beiden Pressevertreter auf gleicher Höhe sitzen wie der Beschuldigte und Kollers Verteidiger, Markus Husmann. Eine ungewohnte Perspektive für die Medienvertreterinnen. Wäre auch noch die Staatsanwaltschaft gekommen, irgendjemand hätte wohl mit einem Platz auf dem Boden vorliebnehmen müssen.
Für Verteidiger Husmann stellt das Fehlen der Staatsanwaltschaft ein Problem dar: «Bei dieser Ausgangslage», sagt Husmann, «befremdet die Abwesenheit der Staatsanwaltschaft.» Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass in solchen Fällen das Gericht – bewusst oder unbewusst – die Rolle der Anklagebehörde übernähme.
Was meint Verteidiger Husmann mit «dieser Ausgangslage»?
Fakt ist: Die Strafverfolgungsbehörden haben allem Anschein nach nicht allzu viel stichhaltiges Material.
Genau besehen haben sie fast gar nichts: bloss eine schwarze Mütze, auf der DNA-Spuren des Beschuldigten gefunden wurden. Kein Videomaterial, das verwertbar wäre, keine Zeugenaussagen, abgesehen von der Person, die die Meldung an die Polizei gemacht hatte. Die Mütze aber, da ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, gehört Koller. Im Strafbefehl steht: «Am Tatort am Rathausquai konnte u.a. eine schwarze Wollmütze sichergestellt werden, an welcher die DNA des Beschuldigten nachgewiesen wurde. Damit ist erstellt, dass der Beschuldigte an vorgenannter öffentlicher Zusammenrottung teilnahm, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen Gewalttätigkeiten begangen wurden.»
Für Kollers Verteidiger ist jedoch klar: Die Mütze ist als Beweismittel gar nicht verwertbar. «Bis zum heutigen Tag wurde die Mütze dem Beschuldigten nie vorgelegt, nicht einmal Fotos davon. Auch wurde sie nicht rechtmässig beschlagnahmt. In den Akten gibt es keine Hinweise auf den Fundort oder den Zeitpunkt. Keine Hinweise auf Marke, Form, gar nichts.» Hätte es sich um eine zur Vermummung geeignete Mütze gehandelt, ist Husmann überzeugt, wäre die Mütze seinem Mandanten vorgelegt worden.
Ein DNA-Hit ermögliche aber für sich alleine keine örtliche und zeitliche Rekonstruktion, so der Verteidiger weiter.
Koller hört sich diese Ausführungen mit unbewegter Miene an. Unterhielt er sich vor der Verhandlung in der Lobby des Bezirksgerichts noch angeregt mit seinem Verteidiger, sitzt er nun mit zusammengefalteten Händen und konzentriertem Blick im Gerichtssaal. Mit den schwarzen On-Schuhen, dem millimeterkurzen Kopfhaar, dem schwarzen Rollkragenpullover und der Sporttasche neben sich könnte er auch ein Jus-Student in einer Strafrechtsvorlesung sein.
Mehrere Verfahren
Koller ist nicht der Einzige, der sich für die Schlägerei vom 28. November 2021 verantworten muss. Ende März standen zwei Männer ebenfalls vor dem Luzerner Bezirksgericht, wie das Onlineportal «Zentralplus» berichtet. Die beiden, heute 22- und 28-jährig, waren rund eine halbe Stunde nach der Schlägerei am Rathausquai von der Polizei kontrolliert worden. Gemäss Strafbefehl hatten Beamte beim 28-Jährigen einen Zahnschutz sichergestellt, wie er etwa beim Boxen oder beim Eishockey getragen wird. Beim Jüngeren hatten sie eine Sturmhaube gefunden, mit Blutspuren auf Mundhöhe.
Und zwei Tage vor Kollers Verhandlung musste ein weiterer junger Mann vor Gericht antraben: Der 26-Jährige war ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten, weil seine DNA auf einer Hygienemaske festgestellt wurde, die am Tatort gefunden wurde.
Ihnen allen wirft die Staatsanwaltschaft Landfriedensbruch vor. Dass diese Verfahren getrennt geführt wurden, kritisiert Verteidiger Husmann. Aus seiner Sicht verletze dies den Anklagegrundsatz. Trotzdem scheinen die Beschuldigten und ihre Verteidiger eine ähnliche Strategie verfolgt zu haben. Sowohl der 22-Jährige als auch der 28-Jährige machten vor Gericht – wie jetzt Koller – vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Knackpunkt «öffentliche Zusammenrottung»
Der Landfriedensbruch ist eine Anomalie im Schweizer Strafrecht. Geschaffen, um den öffentlichen Frieden – ein diffuses Rechtsgut – zu schützen, ist er faktischer Auffangtatbestand, wenn die Beweislage dünn ist.
Bestraft wird, «wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden (...)», wie es im Strafgesetzbuch heisst. Zur Anwendung kommt der Landfriedensbruch etwa, wenn aus einer Menge heraus Sachbeschädigungen (Sprayereien, eingeschlagene Scheiben) oder Gewalt gegen Menschen (etwa Flaschen- oder Petardenwürfe) begangen werden, die Strafverfolgungsbehörden aber Schwierigkeiten haben, die Urheber zu identifizieren. Beim Landfriedensbruch muss die einzelne Person keine Gewalttätigkeit verübt haben; sie muss sie gemäss neuerer Rechtsprechung nicht einmal gutheissen. Es reicht, dass sie sich im Zeitpunkt der Gewaltverübung in der Menge (einer «Zusammenrottung») befunden hat. Dafür drohen im Maximalfall drei Jahre Gefängnis.
Die schwammige Formulierung hat dem Landfriedensbruch einige unschöne Beinamen verliehen, Gummiparagraf ist noch einer der harmloseren. Für Wolfgang Wohlers, Strafrechtsprofessor an der Universität Basel, zeigt die Praxis, dass der Tatbestand «sehr schlankweg» angewendet wird. Ja, mehr noch: «Der Landfriedensbruch wird in meinen Augen missbraucht», sagt Wohlers. «Man sagt sich, wenn wir schon nicht nachweisen können, wer nun die konkreten Verletzungen oder Sachbeschädigungen verursacht hat, dann können wir die Leute wenigstens wegen Landfriedensbruchs verurteilen. Letztlich handelt es sich aber um ein Beweisproblem.»
Landfriedensbruch oder Raufhandel?
Knackpunkt in vielen Landfriedensbruch-Fällen ist der Begriff der «öffentlichen Zusammenrottung». Verteidiger Husmann weist vor dem Bezirksgericht Luzern darauf hin, dass es im Fall der Rathausquai-Schlägerei an einer solchen öffentlichen Zusammenrottung gefehlt habe: «Öffentlich ist es nur dann, wenn sich eine unbestimmte Anzahl an Personen anschliessen könnte. Dazu äussert sich die Anklage aber nicht.»
Auch sei denkbar, dass sich beide Fanlager vor der Schlägerei friedlich verhalten hätten, es also an der «friedensstörenden Grundstimmung» gefehlt habe. Und schliesslich, so Husmann, sei auch der subjektive Tatbestand im Strafbefehl «in keiner Weise» umschrieben. Möglicherweise habe sich sein Mandant vor dem Ausbruch der Gewalttätigkeiten entfernt und dabei die Mütze auf dem Rathausquai zurückgelassen.
Wer rechtzeitig die Menge verlässt, bleibt straffrei.
Auch sonst lässt Husmann kein gutes Haar an der Arbeit der Staatsanwaltschaft: Bereits formell genüge der Strafbefehl dem Bundesrecht nicht. «Tatbestand sei zwar Landfriedensbruch, in der Anklage wird aber nicht ein solcher beschrieben, sondern der Raufhandel.»
Keine Beweise
Schaut man sich die Videos der Rathausquai-Schlägerei an, sieht man, wie einer der Männer nach einigen Treffern benommen auf dem Strassenpflaster liegen bleibt. Erst gegen Ende der Aufnahme scheint es ihm zu gelingen, sich wieder aufzurappeln. Und ganz offensichtlich konnte er sich rechtzeitig vor der bald darauf eintreffenden Polizei vom Tatort entfernen.
In den Strafbefehlen, die alle ähnlich lauten, heisst es dazu an einer Stelle: «Verletzungen, welche der Schlägerei zugeordnet werden könnten, sind weder der Polizei noch dem Rettungsdienst gemeldet worden.» Aus diesem Grund ist auch kein anderer Straftatbestand denkbar: Für Raufhandel, die naheliegendste Alternative, fehlt es eben gerade an der objektiven Strafbarkeitsbedingung: einer Verletzung.
Zwei der insgesamt vier Fälle am Bezirksgericht wurden bereits entschieden. Richter Roland Huber, der auch im Fall von Koller die Verhandlung führt, hat den 22-Jährigen und den 28-Jährigen freigesprochen. Es wäre keine grosse Überraschung, wenn Richter Huber in den zwei weiteren Fällen gleich entscheiden würde.
Es ist einigermassen erstaunlich: Da wird ein Straftatbestand herangezogen, der es den Strafverfolgungsbehörden erleichtern soll, Beteiligte zu identifizieren, und dann wischt der Einzelrichter all diese Fälle vom Tisch mit der Begründung: «Den Beschuldigten kann nicht in rechtsgenüglicher Weise nachgewiesen werden, an der Schlägerei am Rathausquai 6 in Luzern teilgenommen zu haben.» Oder anders gesagt: Es fehlt an Beweisen.
Das mussten Staats- und Jugendanwaltschaft bereits im Vorfeld
feststellen. Von insgesamt 17 eröffneten Verfahren wurden 13 wieder
eingestellt. «Die Identifikation», schreibt der Mediensprecher der
Staatsanwaltschaft, «war kaum möglich.»
Nun kann man sich fragen, warum die Strafverfolgungsbehörden überhaupt aktiv werden, wenn sich eine Gruppe von jungen Männern in engen Beinkleidern und mit Strümpfen vor der Nase zur – mutmasslich verabredeten – Schlägerei trifft. Sachbeschädigungen gab es keine, Verletzungen sind, wie erwähnt, auch keine bekannt. Werfen wir nochmals einen Blick in den Basler Kommentar: Der Landfriedensbruch-Artikel scheine eine Art «Prototyp der Delikte gegen den öffentlichen Frieden» zu sein. «Das Sicherheitsgefühl des Bürgers wird durch Gewalttätigkeiten begehende öffentliche Zusammenrottungen in besonderem Masse tangiert.»
In der Hooligan-Reportage des Republik-Autors Daniel Ryser «Feld-Wald-Wiese» wird eine Szene von männlichen Gewaltfanatikern beschrieben, die sich fernab der Öffentlichkeit – in Industriegebieten, an Autobahnraststätten, auf Waldstücken – trifft, um sich möglichst ungestört gegenseitig die Nase platthauen zu können.
Der Autor stellt die Frage: «Kann man Leute, die sich gegenseitig prügeln wollen, davon abhalten?»
Im vorliegenden Fall ist die Sache etwas anders gelagert. Tatort ist nicht ein abgelegenes Waldstück, sondern eine Flaniermeile mitten in der Tourismushochburg der Schweiz. Es geht wohl nicht zuletzt darum, nicht den Eindruck zu erwecken, dass in den Innenstädten dieses Landes ungestraft und nach Lust und Laune gekeilt werden könnte. Und wer weiss: Vielleicht ging es ja auch den Prüglern trotz Vermummung ums Sehen und Gesehenwerden …
Das Urteil im Fall Raphael Koller war bis Redaktionsschluss noch nicht
bekannt.
Illustration: Till Lauer