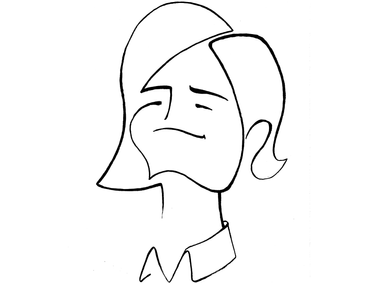
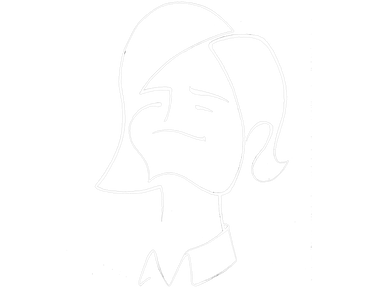
Die Machtlosigkeit wird sich rächen
Das Schweizer Parlament hätte über die Notkredite zur Grossbankenrettung befinden sollen. Geschehen ist etwas anderes: Es hat sich ad absurdum geführt.
Von Daniel Binswanger, 15.04.2023
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Am Ende dieser denkwürdigen CS-Sondersessionswoche kann eine Frage nicht mehr abgewiesen werden: Wie irreversibel ist der Schaden, den die Schweizer Demokratie jetzt nehmen wird?
Natürlich kann man beschwichtigen, darin haben wir inzwischen Übung. Die Mega-UBS wird sich stabilisieren, die Kosten für die öffentliche Hand werden mit viel Glück vielleicht gar nicht hoch werden, der Reputationsschaden für den Finanzplatz Schweiz wird sich vielleicht trotz allem in Grenzen halten. Das könnte alles sogar zutreffen. Dennoch demonstrierte die ausserordentliche Session des Parlaments auf dramatische Weise, wie machtlos, hilflos und eigentlich schon beinahe überflüssig geworden unsere sogenannten Volksvertreterinnen den Grossinstitutionen des globalen Finanzkapitals inzwischen ausgeliefert sind. Dieser Eindruck wird nachwirken.
Im Prinzip hätte die ausserordentliche Session zum Moment der Aufarbeitung, des In-die-Pflicht-Nehmens der Verantwortungsträger, des Aufgleisens gesetzlicher Gegenmassnahmen werden sollen. Stattdessen wurde sie zu einem Schaulaufen der Abnickerinnen, einem Festival der Absichtserklärungen, einer Tribüne für vollkommen irrelevante Moral- beziehungsweise Busspredigten. Zu glauben, das werde nicht massive politische Folgen haben, wäre von sträflicher Naivität.
In historisch einmaligem Mass hat das Parlament der Schweizer Bevölkerung seine Machtlosigkeit vor Augen geführt. Zu guter Letzt konnte weder die Forderung nach einem Trennbankensystem noch eine Regulierung der Boni für die Kader von systemrelevanten Banken noch eine weitere Verschärfung der Eigenkapitalquote beschlossen oder wenigstens vorangebracht werden. Das Einzige, was schliesslich gelang, war die Ablehnung der Notfallkredite von 109 Milliarden durch den Nationalrat.
Es handelt sich um eine spektakuläre Widerstandsgeste, die allerdings nicht mehr ist als genau das: Spektakel. Und die die politische Impotenz der Schweizer Legislative eigentlich erst so richtig ins Scheinwerferlicht rückt. De facto sind die Notkredite schliesslich bereits rechtsgültig gesprochen. Die Ablehnung bleibt rein symbolisch.
Natürlich hatte die unheilige Allianz aus Grünen, Sozialdemokraten und SVP vollkommen recht damit, die Notfallkredite nur unter der Bedingung absegnen zu wollen, dass mit stark verschärfter Regulierung Massnahmen getroffen werden, um weitere Bail-outs – oder staatlich gesponserte «privatwirtschaftliche» Übernahmen – zu verhindern. Aber letztlich, auch dieser Tatsache sollte man ins Auge sehen, hat nicht nur die doch eigentlich sehr bankennahe SVP, sondern auch die SP in diesem Politikfeld keine Glaubwürdigkeit. Gemeinsam hätten die SVP- und SP-Bundesräte den Notkredit verhindern können. Sie haben es nicht getan, aus völlig nachvollziehbaren Gründen: Der volkswirtschaftliche Schaden für die Schweiz wäre zu gross gewesen.
Der Realismus der Schweizer Regierung ist lobenswert. Allerdings verbannt er die Ablehnung der Kredite durch linke und rechte Parlamentarierinnen in den Bereich der reinen Symbolpolitik: Man hat nicht abgelehnt, obschon, sondern weil man wusste, dass es keinerlei Folgen haben würde.
Natürlich ist es dennoch albern, die Polparteien für ihren Widerstand zu geisseln, sie zu beschuldigen, blossen Wahlkampf zu betreiben und es an staatstragendem Pflichtbewusstsein fehlen zu lassen. Diese Vorwürfe, die nun unisono von FDP, Mitte und GLP erhoben werden, sind ihrerseits nichts als Wahlkampf: Angriff ist die beste Verteidigung. Es wäre falsch gewesen, die Notkredite anstandslos durchzuwinken, und symbolischer Widerstand ist vielleicht ein bisschen besser als gar nichts.
Die Botschaft, die das Schweizer Parlament dem Publikum parteiübergreifend vermittelt hat, ist dennoch eine andere: dass der Finanzplatz weiterhin machen wird, was ihm passt. Dass der Schweizer Staat weiterhin geradestehen wird für die Verlustrisiken der systemrelevanten Banken. Dass die Politik weiterhin davor zurückschrecken wird, die «Sozialisierung» der Verluste ein für alle Mal zu beenden.
Unter den zahlreichen Erklärungsansätzen, wie es kommen konnte, dass sich Mitte der Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts vielerorts ein aggressiver Rechtspopulismus durchsetzen konnte (ausser in Südeuropa, wo auch der Linkspopulismus gewisse Erfolge feierte), spielt die Finanzkrise von 2008 zu Recht eine entscheidende Rolle. Diese zerstörte die Glaubwürdigkeit der wirtschaftsliberalen Gesellschaftsordnung, in der sich Leistung lohnen sollte und in der die märchenhaften Einkommen der Wirtschaftselite auf realer Wertschöpfung und nicht auf staatlichen Bail-out-Garantien beruhen müssten.
Dass die moralischen Grundlagen dieser Gesellschaftsordnung durch die Finanzkrise als blosse Illusion ausgewiesen wurden, hat in den Jahren 2008 bis 2016 ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir an Ressentiment geschaffen und einem aggressiven Rechtspopulismus wie etwa der Maga-Bewegung von Donald Trump zum Durchbruch verholfen. Auch in der Schweiz erreichte die SVP 2015 den bisherigen Gipfelpunkt ihrer Wähleranteile. Heute wiederholt sich die Bankenkrise. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Populismus-Dynamik, die kaum je wirklich abgeflaut ist, nicht ebenfalls eine mächtige Renaissance erleben wird.
In der Schweiz dürften die politischen Verwerfungen mittelfristig sogar noch viel stärker sein als nach der Finanzkrise. Damals handelte es sich um eine globale Systemkrise – weshalb auch das helvetische Politikversagen weniger dramatisch erschien als heute. Jetzt ist das Politikversagen hausgemacht. Der Vertrauensverlust gegenüber der politischen Schweiz dürfte entsprechend grösser sein.
Es ist in der Geschichte der Eidgenossenschaft noch nicht so häufig vorgekommen, dass das Parlament separat stattfindende ausserordentliche Sessionen einberufen hat. Seit dem Jahr 2000 gab es lediglich deren drei, eine nach dem Swissair-Grounding, eine zu Beschlüssen über Covid-Notmassnahmen – und jetzt die ausserordentliche Session zur CS-Rettung.
Bei der Covid-Session befand sich das ganze Land in einer offensichtlichen Notlage, und es wurden auch echte parlamentarische Entscheidungen getroffen. Bei der Swissair-Rettung ging es um aus heutiger Perspektive vollkommen lächerliche Beträge – schlappe 2 Milliarden –, und auch wenn das Parlament unter Druck stand, die nationale Airline zu erhalten: Es hätte ablehnen können, ohne eine sofortige, schwere Wirtschaftskrise zu provozieren. Dennoch waren die politischen Nachwirkungen des Swissair-Entscheides historisch: Er besiegelte definitiv den Abstieg der FDP und die neue Führungsrolle der SVP. Welche Folgen wird die jetzige ausserordentliche Session haben, in der sich das Schweizer Parlament nur noch selber ad absurdum führte?
Kurzfristig dürften die linken Parteien aus dem Zorn gegen die Banken elektoralen Nutzen ziehen. Mit viel Geschick werden sie gewonnene Sympathien vielleicht verstetigen können. Mittelfristig würde es aber überraschen, wenn das CS-Desaster nicht zu einer rechtspopulistischen Dynamik führte. Sie könnte über alles hinausgehen, was dieses Land je gesehen hat.
Die CS-Führung war der Inbegriff der Schweizer Elite, und Ressentiment gegen die Elite ist der Brennstoff des Populismus. Die Schweizer Bevölkerung wird drei Lehren aus der CS-Pleite mitnehmen. Erstens: Die Top-Manager der Grossbanken verdienen Milliarden an Boni, die letztlich mit Staatsgarantien und somit von der Normalbürgerin finanziert werden. Zweitens: Sie richten mit ihrem Risikoappetit ihre eigenen Institutionen zugrunde und gefährden die Schweizer Volkswirtschaft. Drittens: Sie sind so mächtig und unantastbar, dass die Schweizer Regierung auch nach Garantieleistungen von 109 Milliarden Franken – deutlich mehr als der gesamte Bundeshaushalt – weder beim Eigenkapital noch bei künftigen Bonusregelungen noch bei der definitiven Festschreibung des Sitzlandes noch sonst in irgendeiner Hinsicht einschneidende regulatorische Vorgaben macht.
Natürlich hätte rein theoretisch für das Parlament auch die Möglichkeit bestanden, aus seiner Impotenz auszubrechen und strikte Regulierungen durchzusetzen. Dass dies aber tatsächlich geschehen wird, scheint äusserst unwahrscheinlich.
Höhere Eigenmittelforderungen? Man weiss schon seit langen Jahren, dass die Leverage Ratio von rund 5 Prozent, die im Rahmen der internationalen Basel-III-Vorschriften für systemrelevante Banken empfohlen wird, nicht ausreichend ist. Momentan werden die Arbeiten der Stanforder Bankenexpertin Anat Admati und des Ökonomieprofessors Martin Hellwig, die eine Leverage Ratio von 20 bis 30 Prozent als eigentlich zwingend ausweisen, in der Schweizer Presse breit diskutiert, nachdem die «Wochenzeitung» dazu den dankenswerten Anstoss gegeben hat.
Die Debatte hat allerdings auch etwas völlig Surreales: Hellwig und Admati haben ihren internationalen Bestseller «Des Bankers neue Kleider» 2013, im Nachgang zur Finanzkrise, veröffentlicht. Die «Financial Times» nannte das Werk damals «das wichtigste Buch, das aus der Krise hervorgegangen ist». Dass man die dort präsentierten Thesen heute in der Schweiz zu entdecken scheint, wirft ein ernüchterndes Licht auf die allgemeine Informiertheit. Hinter welchen sieben Monden lebt unser politisches Personal?
Die Aussichten, heute durchzusetzen, was im Nachgang zur Finanzkrise nicht durchgesetzt werden konnte, dürften jedoch aus einem viel einfacheren Grund gleich null sein: Die CS-Krise ist primär eine Schweizer Krise. Bei uns offenbart sich nun Regulierungsbedarf, aber man wird ausschliessen dürfen, dass die Eidgenossenschaft mit ihren Vorschriften über die internationalen Standards – also über Basel III – signifikant hinausgehen wird. So weit werden wir es nicht treiben mit dem «Swiss Finish».
Dies geht schon aus Karin Keller-Sutters Manövern hervor, mit denen sie der SP-Forderung nach höheren Eigenmittelquoten für Grossbanken scheinbar entgegenkommt, de facto aber lediglich eine Anpassung an den neuen Basel-III-Standard anvisiert. Was im Nachgang zu 2008 nicht möglich war, wird 2023 ganz gewiss nicht umgesetzt werden. Nicht in einem helvetischen Alleingang.
Alles wird also beim Alten bleiben, auch wenn die neue UBS-CS einzelne Geschäftseinheiten vermutlich abstossen dürfte. Die Standortkonkurrenz lässt der Schweizer Regierung bei der Regulierung nur sehr begrenzten Spielraum – es sei denn, sie wäre bereit, einen Bedeutungsverlust des Finanzplatzes in Kauf zu nehmen. Dagegen wird sie sich weiterhin mit allen Mitteln wehren.
Der Schock über den CS-Ruin und der Zorn über die Abzocker werden dennoch verarbeitet werden müssen. Ein Parlament, das nicht handlungsfähig ist, wird zur blossen Echokammer des Ressentiments. Das sind keine guten Nachrichten für die Schweizer Demokratie. Aber es ist leider, wo wir heute stehen.
Illustration: Alex Solman