
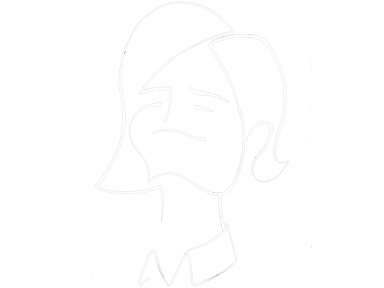
Der Untergang der Standort-Neutralität
Die Dramen auf dem Schweizer Finanzplatz gehören in einen viel weiteren Kontext der internationalen Entwicklung. Dem müssen wir uns stellen.
Von Daniel Binswanger, 25.03.2023
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Es ist weder erstaunlich noch neu, dass der Untergang von Schweizer Prestigefirmen zusammenfällt mit weltpolitischen Epochenbrüchen. So war es beim Grounding der Swissair, das durch zahlreiche strategische Fehlentscheide über Jahre angebahnt wurde, sich schliesslich aber blitzschnell vollzog. Als 2001 im Nachgang zum Anschlag auf das World Trade Center die Welt ganz plötzlich eine andere wurde, geriet der internationale Luftverkehr in eine Krise, der die angeschlagene Fluggesellschaft nur noch hilflos ausgeliefert war.
Wenn globale Kräfteverhältnisse sich neu ordnen, können auch identitätsstiftende Unternehmen, die für die Ewigkeit gebaut scheinen, auf einmal mit dem falschen Geschäftsmodell dastehen. Das führt uns zur Kernfrage des Credit-Suisse-Debakels: Wie steht es heute um das Geschäftsmodell der Schweiz?
Im Vergleich zur Credit-Suisse-Notrettung war der Swissair-Untergang nur Peanuts. Magere 450 Millionen betrug damals der Überbrückungskredit der Landesregierung, mit dem die Swissair-Flotte provisorisch wieder flugfähig gemacht wurde, zu einem späteren Zeitpunkt schossen Bund und Kantone noch eine Milliarde ein. Der Swissair-Untergang erschien dennoch als nationale Tragödie. Im Vergleich mit den 209 Milliarden Nationalbank- und Staatsgarantien zur Rettung der CS waren die Swissair-Kosten jedoch ein besseres Trinkgeld. Gemessen am Absturz einer Grossbank ist das Ende der nationalen Fluggesellschaft beziehungsweise ihre schliessliche Übernahme durch die Lufthansa (für lächerliche 339 Millionen Franken) eine fast vernachlässigbare Episode der Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
Dennoch ist eine Parallele offensichtlich: Auch das CS-Debakel ereignet sich im Kontext eines Epochenbruchs. Auch hier ist es zwar das liederliche Geschäftsgebaren eines Einzelkonzerns, das die Katastrophe vorbereitet, aber ein verändertes internationales Umfeld, das zum definitiven Zusammenbruch den Anstoss gibt. Die Kausalitäten sind im CS-Fall nicht ganz so unmittelbar und evident. Doch der Zusammenhang ist klar. Und stellt die Frage, wie der Schweizer Standort sich wohl oder übel wird ausrichten müssen.
Der Hintergrund des CS-Debakels ist der Krieg in der Ukraine und die Krise der Schweizer Neutralitätspolitik. Seien es die im Zusammenhang mit den Oligarchengeldern wieder akut gewordenen Fragen zum Schweizer Offshore-Banking, der russische Rohstoffhandel über Genf und Zug, die Frage der Waffenexporte und das Mass der Distanz zu den Nato-Staaten: Die Schweiz muss sich neu orientieren. Es ist belegt, dass die CS die wichtigste Schweizer Akteurin ist im Offshore-Banking für russische Kundinnen. Und genau jetzt, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Geschäft unter massiven Druck gerät, bricht sie zusammen. Auch wenn es sicherlich nicht primär der Abfluss oder die Blockierung russischer Gelder waren, welche die CS in die Knie gezwungen haben: Ein Zufall ist das nicht.
Man muss daran erinnern, dass das Schweizer Offshore-Banking weltweit weiterhin führend ist. Im amerikanischen Investmentbanking sind die Schweizer Grossbanken letztlich immer glücklos geblieben. Mehr als dass es ihren Vorständen regelrechte Märchenboni verschaffte und zudem die Illusion vermittelte, bei den big boys mitzuspielen, wurde gar nie erreicht. In der Vermögensverwaltung und im Assetmanagement ist der helvetische Finanzplatz bis heute aber führend geblieben.
Zwar dürfte die Schweiz gemäss dem «Global Wealth Report» der Boston Consulting Group dieses Jahr zum ersten Mal von Hongkong auf den zweiten Rang der Offshore-Finanzplätze verwiesen werden, aber die grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen bleiben ein Geschäftsfeld von ungebrochener Wichtigkeit. Zu erwarten ist das nicht unbedingt gewesen.
Schliesslich wurde der wichtigste kompetitive Vorteil der Schweizer Banken – das Bankgeheimnis – mit dem automatischen Informationsaustausch, den die OECD zum internationalen Standard erhob und der ab 2017 auch der Schweiz aufgezwungen worden ist, definitiv abgeschafft. Jedenfalls gilt das im Verhältnis zu den EU-Staaten, die traditionellerweise die Ursprungsländer des grössten Anteils ausländischer Einlagen in Schweizer Banken sind. Ein Rückgang des Offshore-Geschäfts wäre zu erwarten gewesen – und wurde von den Verteidigern des Bankgeheimnisses auch immer beschworen. Die Statistik zeigt jedoch: Das Volumen ausländischer Gelder in der Schweiz hat nach dem Fall des Bankgeheimnisses kaum abgenommen. Bisher jedenfalls nicht.
2021 verwalteten die Schweizer Banken knapp 2,4 Billionen Franken an Privatvermögen ausländischer Kunden. Das ist noch etwas mehr als in den Jahren vor der Einführung des Informationsaustausches. Die Einlagen aus Europa mögen zwar abgenommen haben – aber das wird kompensiert durch Kapital, das aus Russland, Asien und dem arabischen Raum in die Schweiz fliesst. Das bedeutet allerdings auch: Mehr denn je ist die Neutralität beziehungsweise bevorzugte Beziehungen mit Schurkenstaaten und politisch problematischen Ländern eine Voraussetzung für das Schweizer Offshore-Banking.
In früheren Zeiten pflegte man zu den umliegenden europäischen Ländern zwar nachbarschaftliche Verbundenheit, entzog ihnen mit dem Bankgeheimnis aber einen Teil des Steuersubstrats. Inzwischen ist das Geschäft jedoch viel stärker globalisiert. Die Neutralität wird zu einer umso wichtigeren Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung.
Um es etwas überspitzt zu sagen: Das alte Schweizer Geschäftsmodell beruhte auf dem Steuerhinterziehungsbedürfnis der europäischen Eliten. Das neue Schweizer Geschäftsmodell beruht auf dem Kapitalexportbedarf von Schurkenstaaten. Für das alte Modell war die Neutralität eher sekundär. Für das neue ist sie zentral.
Und so geschehen nun zwei Dinge simultan: Die Neutralitätspolitik gerät in eine völlige Sackgasse – und eine der beiden führenden Offshore-Vermögensverwalterinnen geht unter. Natürlich versucht man jetzt in Bern mit hilflosen Kompromissen noch etwas rumzuwursteln. Man schliesst sich brav den Sanktionen gegen Russland und dem Einfrieren der Oligarchengelder an – weigert sich bisher aber, nach diesen Geldern auch aktiv zu suchen beziehungsweise die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie nicht versteckt werden können. Soll das die neue Basis sein für die Schweizer Glaubwürdigkeit? Glaubt irgendjemand allen Ernstes, dass wir längerfristig damit durchkommen? Unsere westlichen Partnerländer dürften das etwas anders sehen.
Vergleichbares geschieht im Rohstoffgeschäft. Dieses ist in den letzten Jahren in völlig neue Dimensionen vorgestossen – sehr wesentlich aufgrund des russischen Öl- und Gashandels. Auch hier ist der Aufstieg zur führenden globalen Handelsplattform eher jüngeren Datums. Inzwischen erreicht der Saldo des Rohstofftransithandels unglaubliche 8,5 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Auch hier beruht das Geschäftsmodell auf der «Neutralität» des Schweizer Standortes. Und auch hier wird immer deutlicher: Das Ende der Fahnenstange ist jetzt erreicht.
Wir sollten diesen Tatsachen ins Auge sehen und uns mit Umsicht neu aufstellen. Die Schweiz hat eine breit diversifizierte Volkswirtschaft. Maschinenbau, Hochtechnologie und Tourismus sind stark, Pharma ist erfolgreicher denn je. Mehr und mehr wird Zürich von Basel als Wirtschaftshauptstadt abgelöst. Hier liegt die Schweizer Zukunft, nicht in den zweifelhaften Geschäften mit schmutzigem Kapital und schon gar nicht im Handel mit Gas- und Ölreserven, die ohnehin besser im Boden bleiben.
Es sollte nicht so schwierig sein, die Realitäten nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. Alles, was es dazu bräuchte, ist etwas moralische Klarheit, etwas Zuversicht und etwas Selbstbewusstsein. Davon ist in Bern gerade nicht sehr viel zu spüren. Es ist der Moment, wo sich das ändern muss.
Illustration: Alex Solman
In einer früheren Version hiess es an einer Stelle, dass die Schweizer Banken 2,4 Milliarden Franken Privatvermögen von ausländischen Kunden verwalten, korrekt ist: 2,4 Billionen. Wir haben den Betrag korrigiert, bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft – und entschuldigen uns bei Daniel Binswanger, der Fehler ist uns in der Produktion unterlaufen.