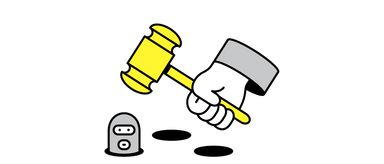
Ryanair gegen alle – alle gegen Ryanair
«Mallorca ab 24,99 Euro» steht derzeit auf der Homepage des irischen Billigfliegers. Verlockend. Doch sein gesamtes Geschäftsmodell ist in vielerlei Hinsicht illegal.
Von Yvonne Kunz, 01.03.2023
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Willkommen im Rüpel-Kapitalismus! Willkommen in der Welt der Marktradikalen!
Oder, im Wording der BBC: Zu einer «Fallstudie von disruptivem Geschäftsgebaren, aggressivem Pricing – und stratosphärischem Wachstum». Was 2017 stimmte, aus dem Jahr stammt das Zitat, ist heute so wahr wie damals: Die Corona-Flaute hat Ryanair hinter sich gelassen, seit letztem Jahr fliegt die nach Beförderungszahlen viertgrösste Airline der Welt wieder von Rekord zu Rekord. Und das mit Tickets, die oft weniger kosten als die Bahnfahrt zum Flughafen.
Wie machen die das? Diese Frage schwingt immer mit, wenn es um den Billigflieger geht. Klar, Kosten senken, das ist das Konzept einer Low-Cost-Fluggesellschaft. Und ja, für zwei, drei Stunden geht es auch ohne Gratis-Bordverpflegung oder verstellbaren Sitz.
Aber Ryanair knausert sogar beim Kaffee für die Piloten. Den müssen sie an Bord selbst bezahlen, 3 Euro den Becher, wie die Passagiere. Oder beim Sprit: Maschinen des Billigfliegers mussten nach Umleitungen auch schon notlanden, weil sie keine Reserve getankt hatten.
Nur für Anwältinnen scheint Ryanair grenzenlos Mittel zu haben. Offenbar rechnet es sich, jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten um Arbeitsrechte, Fluggastrechtverordnungen, Sozialabgaben, Flugrechtsportale oder staatliche Corona-Hilfen auszufechten. Anders ist nicht zu erklären, weshalb das Unternehmen nicht einfach seine Geschäftspraxis gemäss geltendem Recht gestaltet.
Lauter und legal ist das Businessmodell von Ryanair nämlich nicht. Ein Blick in den reichhaltigen Prozessfundus der Airline offenbart das Bild eines Players, der vorsätzlich in Graubereichen operiert; dort, wo Recht nach der Liberalisierung des europäischen Flugmarktes 1997 erst entwickelt werden musste.
Seit Jahrzehnten pfeifen Gerichte die Airline zurück – und immer wird trotzdem durch alle Instanzen prozessiert. Doch die Luft wird dünn für den Billigflieger. In den vergangenen Jahren hat Ryanair wiederholt empfindliche juristische Schlappen erlitten, die das Geschäftsmodell als Ganzes ins Wanken bringen. Und voilà: Nun verkündet CEO Michael O’Leary: Die Ära des 10-Euro-Flugs ist vorbei.
Ein paar Müsterchen gefällig?
1. Mallorca hat genug
Ort: Dirección General de Consumo in Palma, Tribunal Superior de Justícia Illes Balears, Palma
Zeit: 2019 bis 2022
Thema: Fluggastrechte
Administration? Check-in-Schalter? Brauchts nicht. Das erledigen die Passagiere bei Ryanair selbst. Geht in Ordnung, billig fliegen soll verdient sein.
Doch unterläuft der Kundschaft ein Fehler, wie einem Fluggast letztes Jahr in Mallorca, der bei der Online-Buchung seinen Namen falsch schrieb, muss sie teuer büssen: 180 Euro verlangte Ryanair für die Korrektur der Bordkarte. Und es kam noch bunter: Der zuständige Mitarbeiter der Airline vertippte sich bei der Namensänderung ebenfalls – weshalb der Passagier seinen Flug letztlich mit der ersten falschen Version seines Namens antrat. Das Geld für die gar nicht erfolgte Korrektur wollte ihm die Airline trotzdem nicht erstatten.
Das liess der Passagier nicht auf sich sitzen und schaltete die Dirección General de Consumo in Palma ein. Die Konsumentenschutzbehörde gibt ihm recht – und verhängt eine Busse von 24’000 Euro.
Dies wiederum wollte Ryanair nicht schlucken und gelangte an den Tribunal Superior de Justicia Illes Balears. Das Gericht befand die Gebühr für die Namenskorrektur für völlig unverhältnismässig. Es sei erstens für Ryanair kein Problem, den Namen zu ändern, zweitens habe die Airline nicht darlegen können, wie hoch die firmeninternen Kosten für den Aufwand einer simplen Namenskorrektur sind.
Auch die hohe Busse bestätigte das Gericht: Strafverschärfung im Wiederholungsfall. Ständig missachte Ryanair Passagierrechte – 2021 brummte dasselbe Gericht der Airline eine Busse in derselben Höhe auf, weil sie sich weigerte, eine fluguntaugliche Schwerstkranke umzubuchen. Von diesem Treiben haben die Mallorquinerinnen schon länger genug – die Behörden ermutigen Passagiere seit 2019 aktiv, juristisch gegen den Billigflieger vorzugehen.
2. Wien zeigt das System der Abzocke
Ort: Handelsgericht Wien, Oberlandesgericht Wien
Zeit: 23. Juli 2020 und 30. November 2021
Fall-Nrn.: 17 Cg 32/19 und 1 R 131/20
Thema: Allgemeine Beförderungsbestimmungen (ABB)
Ryanair-CEO Michael O’Leary behauptet von sich gerne, die Fliegerei demokratisiert zu haben. Entgegen der hehren Worte zockt die selbst ernannte Arme-Leute-Airline ihre Kundschaft aber ziemlich unverfroren ab.
Nicht, dass Ryanair das einzige Unternehmen mit zweifelhaften allgemeinen Geschäfts- oder Beförderungsbedingungen wäre, die den gesetzlichen Grundsatz verletzen, dass Konsumentinnen verlässliche Auskunft über ihre Rechte erhalten sollen. Doch das Ausmass der Tricksereien bei Ryanair ist haarsträubend, wie Urteile von zwei Gerichten in Wien zeigen.
Das dortige Handelsgericht und das zweitinstanzlich zuständige Oberlandesgericht hiessen eine Klage der Arbeiterkammer grösstenteils gut. Die Konsumentenschutzorganisation hatte 35 Klauseln wegen ihrer Kundenfeindlichkeit beanstandet – und in 32 Fällen recht erhalten.
So erklärten die Gerichte verschiedene Gebühren für unrechtmässig: Der Preis für einen Check-in am Flughafen in der Höhe von 55 Euro etwa, bei dem der Hinweis auf die happige Gebühr moniert wurde, der erst während des Buchungsvorgangs erfolgt. Oder die 20 Euro für das Ausdrucken einer Bordkarte am Flughafen, wenn man sie zu Hause vergisst.
Auch das komplizierte, langwierige Prozedere von Ryanair, wenn Fluggäste Ansprüche wegen krass verspäteter oder gestrichener Flüge geltend machen wollen, stuften die Wiener Gerichte als rechtswidrig ein.
Gleich dutzendweise kippten die Wiener Gerichte Klauseln, weil sie für Rechtsunkundige schlicht unverständlich sind. Mit unklaren Formulierungen und kaskadenartigen Verweisen schaffe das Unternehmen gezielt Intransparenz.
Zum Beispiel: Beim unbestimmten Hinweis auf «das Übereinkommen» könne eine Konsumentin zwar anhand der in den AGB enthaltenen Begriffsbestimmungen noch eruieren, dass es sich um das Montrealer Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr handeln muss. Welches aber die ebenfalls erwähnten «einschlägigen Gesetze» sein sollen, werde nirgends definiert.
Wenn Ryanair weiter schreibe, dies oder jenes treffe zu, «sofern das Übereinkommen oder einschlägige Gesetze nichts anderes vorsehen», müssten die meist juristisch ungebildeten Fluggäste von Ryanair beurteilen können, ob nun irisches Recht anzuwenden ist oder ein anderes Recht und allenfalls welches. Danach müssten sie auch noch wissen, ob bestimmte Gesetze eines Landes einschlägig sind oder nicht. Das sei schon für Juristinnen äusserst aufwendig.
3. Belgien via Luxemburg: Der Arbeitskampf
Ort: Europäischer Gerichtshof (EuGH), Luxemburg
Zeit: 14. September 2017
Fall-Nrn.: C-168/16 und C-169/16
Thema: Gerichtsstandsklausel
Ryanair ist berüchtigt für schlechte Arbeitsbedingungen – und für unverhohlene Drohungen gegen Mitarbeitende, die sich wehren: Wer streikt, fliegt. Oder eben nicht mehr.
Eher würde die Hölle zufrieren, als dass er sich mit Gewerkschaften einige, sagte CEO O’Leary.
Das überrascht nicht – ist doch das Personal die grösste unternehmerische Stellschraube für Kosteneffizienz. Und seit Ryanair 1997 europaweit aktiv wurde, gilt die Airline als zentraler Treiber bei der Bildung eines neuen Prekariats der Lüfte.
Bei den Löhnen: ein race to the bottom. 16’000 bis 19’000 Euro verdiente das Kabinenpersonal 2017 im Durchschnitt – ein Drittel weniger als beim Erzrivalen Easyjet. Dazu kommt eine schamlose Missachtung grundlegender Arbeitsrechte: kein garantiertes Mindestpensum, keine Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, dafür Zwang zum unbezahlten Urlaub bei Buchungsflaute.
Möglich machten dies atypische Jobverhältnisse. Ryanair hat über Jahrzehnte ein ausgefeiltes System aufgezogen, mit dem nationale Arbeitsrechtsnormen an den Einsatzorten ausgehebelt wurden. Piloten heuern als Selbstständige über Agenturen an – jederzeit verfügbar und jederzeit kündbar. Beim Kabinenpersonal ist mindestens die Hälfte nicht direkt bei Ryanair unter Vertrag, sondern bei irischen Personalverleiherinnen wie Crewlink und Workforce International.
Funktioniert hat das auch, weil während der Eurokrise Tausende – vorab sehr junge – Mitarbeiter aus Italien, Spanien und Portugal und später aus Ost- und Südosteuropa bereit waren, das repressive Betriebsklima, die hohe Arbeitsbelastung und die prekäre Arbeits- und Lebenssituation zu Dumpinglöhnen hinzunehmen.
Wobei: Anstrengungen, gegen die ausbeuterischen Praktiken vorzugehen, gab es früh – schon 1997 streikte das Bodenpersonal in Dublin. Doch insgesamt blieben die Versuche von Gewerkschaften, Ryanair-Mitarbeitende zu organisieren, erfolglos.
Die Wende kam mit einem Fall aus Belgien. 2005 hatten sechs am Flughafen Charleroi stationierte Flugbegleiterinnen bei einem Arbeitsgericht Klage eingereicht, um die Auszahlung von Sozialleistungen zu erwirken. Ryanair hatte sich wie immer stur auf den Standpunkt gestellt, die Sache müsse in Irland verhandelt werden. Auch wenn vertraglich die «Homebase» der Mitarbeitenden in Belgien liege.
Zwölf Jahre dauerte der Gang durch die Instanzen für die Flugbegleiterinnen, unterstützt von der belgischen Gewerkschaft Centrale nationale des employés (CNE).
Im September 2017 fällte der Gerichtshof der Europäischen Union einen Grundsatzentscheid, der das bisherige Beschäftigungsmodell von Ryanair infrage stellt: Die Airline dürfe nicht durch Gerichtsstandsklauseln verhindern, dass Angestellte ihre Rechte ausüben. Auch transnationale Arbeitgeber müssten zulassen, dass ihre Angestellten an einem für sie gut erreichbaren Gericht klagen dürfen; am Ort, wo sie gewöhnlich ihre Arbeit verrichten.
Bei Luftfahrtgesellschaften ist das eben an der Homebase. Dort, wo die Flugzeuge stationiert sind, auf denen die Crew arbeitet, wo der Arbeitstag beginnt – und wo er endet. Schliesslich würden sie von ihrem Arbeitgeber auch verpflichtet, in der Nähe zu wohnen.
Damit war die hohe Hürde gefallen, die Ryanair bewusst gesetzt hatte, um Klagen zu erschweren. Nun kann die Airline ihre Mitarbeitenden nicht mehr für arbeitsrechtliche Prozesse nach Irland zwingen – was für sie kompliziert und mit hohen Kosten verbunden war.
Seither hatten die Ryanair-Beschäftigten und die Gewerkschaften mehr Wind in den Segeln: Der Arbeitskampf begann.
4. Frankfurt via Luxemburg: Streik!
Ort: Landgericht Frankfurt am Main; Europäischer Gerichtshof, Luxemburg
Zeit: 30. Januar 2020 und 23. März 2021
Fall-Nrn.: 2-24 O 117/18 und C-28/20
Thema: EU-Fluggastrechteverordnung
Seit dem Homebase-Entscheid des EuGH 2017 wird Ryanair in ganz Europa regelmässig bestreikt – wogegen die Airline sich immer wehrt, indem sie beispielsweise in Holland eine einstweilige Verfügung beantragte, die den Angestellten während der Sommermonate das Streiken verbietet. Ohne Erfolg: 2018 wird zum Streikjahr. Zu Hunderten blieben die Maschinen am Boden, zu Tausenden strandeten die Passagiere.
Zwar zahlte die Airline den Gestrandeten das Geld fürs Ticket zurück oder buchte sie um. Doch eine Entschädigung gemäss EU-Fluggastrechteverordnung verweigerte sie. Nach dem Personal organisierten sich nun auch die Passagiere. Mithilfe von Flugrechtsportalen wie Flightright oder Aviclaim rückten sie Ryanair auf die Pelle. Auch dagegen ging Ryanair juristisch vor – die Airline versuchte unverzüglich, das Vorgehen über solche Portale zu unterbinden.
Sie erraten es: Vergeblich.
Zum Glück – denn bis heute hat die Airline in keinem einzigen Fall eine Entschädigung bezahlt, ohne von einem Gericht dazu gezwungen worden zu sein.
Seither schlagen sich Gerichte auf dem ganzen Kontinent mit den Forderungen von Fluggästen herum, die aufgrund von Streiks nicht oder Stunden verspätet ans Ziel gelangen. Wie andere Airlines auch behauptet Ryanair stur, nicht zahlen zu müssen, weil es sich bei einem Streik um «aussergewöhnliche Umstände» wie ein Unwetter handle. In solchen Fällen sind Fluggesellschaften nach EU-Recht von einer Entschädigungspflicht ausgenommen.
Stimmt so nicht, widersprechen die Gerichte einhellig, zum Beispiel das Landgericht in Frankfurt.
Wenn Flüge im Streikfall ausfallen, müsse die Fluglinie erstens nachweisbar alles Zumutbare unternehmen, um die Streichung des Flugs zu verhindern. Im vorliegenden Fall habe Ryanair gar nicht erst versucht, Flugzeuge anderer Anbieter (inklusive Crew) zu chartern, um den ursprünglichen Flugplan einzuhalten. Deshalb stehe den Passagieren die Entschädigung zu. Bei einem Streik seien zweitens ohnehin nicht automatisch «besondere Umstände» anzunehmen.
Auch in dieser Sache hat der Europäische Gerichtshof inzwischen einen Grundsatzentscheid gefällt: 2021 hielt er fest, dass Streiks keine Unwetter sind, sondern zum normalen, internen Betriebsgeschehen gehören – insbesondere dann, wenn Gewerkschaften höhere Gehälter oder bessere Arbeitszeiten durchsetzen wollen.
Man war sich einig: Ryanair hat durch jahrelanges Lohndumping und Salamitaktik in Gewerkschaftsverhandlungen die Streikaktionen selbst heraufbeschworen.
Sie dauern bis heute an.
5. Luxemburg: Kampf gegen «Zombie-Airlines»
Ort: Europäischer Gerichtshof, Luxemburg
Zeit: 2020
Fall-Nrn.: T-238/20, T-465/20 und T-628/20, T-379/20, T-388/20
Thema: Staatliche Corona-Hilfszahlungen
Was genau Ryanair mit den nach eigenen Angaben insgesamt 16 Klagen gegen die EU-Kommission im Zusammenhang mit den Corona-Beihilfen für staatliche Airlines bezweckt, ist nicht ganz klar. CEO O’Leary ist stolz, dass sein privates Unternehmen ohne Rettungspakete durch die Krise flog; mit den Hilfszahlungen hielten verschiedene europäische Länder ihre sogenannten Flagcarrier künstlich am Leben. Das sei nicht rechtens, weil wettbewerbsverzerrend.
Geht es also ums Ausschalten der Konkurrenz? Um noch mehr Marktanteile?
Vielleicht dienen die Klagen vor allem als PR-Plattform, als Lautsprecher für Michael O’Learys heiligen Kampf für die freie Marktwirtschaft.
Die Beihilfen, unter anderem für Lufthansa, Air France-KLM, Austrian Airlines oder Finnair, mussten vorab durch die EU-Kommission genehmigt werden. Deshalb richtet sich der Zorn von Ryanair vor allem gegen das «rückgratlose» Vorgehen der Kommission, die anlässlich der Pandemie Mitgliedstaaten erlaubt habe, «zur Wahrung ihres Nationalprestiges ihren ineffizienten Zombie-Airlines einen Blankoscheck auszustellen».
Ryanair stützt sich bei den Klagen auf verschiedene Argumente: Bezüglich der Staatshilfen in Portugal, Deutschland und Holland monieren die Iren mangelhafte Begründungen der Anträge. Betreffend Österreich wittert der Billigflieger Marktdiskriminierung.
Im Grundsatz stellen sich die Rechtsvertreterinnen der Airline aber bei allen Klagen durchwegs auf den gleichen Standpunkt: Die Staatsgelder, nach Berechnungen des Billigfliegers insgesamt rund 30 Milliarden Euro, verletzen das Binnenmarkt-Prinzip der EU. Solche «illegalen Subventionen» laufen der Liberalisierung des Luftverkehrs zuwider.
Zum Teil durften die Iren in diesen Fällen nun Teilerfolge feiern. Die Luxemburger Richterinnen verfügten zum Beispiel, dass die EU-Kommission ihre Zustimmung zur staatlichen Beihilfe Deutschlands an Condor (550 Millionen Euro) besser begründen muss. Dasselbe entschied der EuGH bezüglich der Staatshilfen an KLM und an die portugiesische TAP.
Mit den anderen Klagen ist Ryanair bislang gescheitert. Der Europäische Gerichtshof sah nichts Unrechtes in den gewährten Hilfen für die SAS und für Finnair – gerade bei Letzterer habe tatsächlich eine Zahlungsunfähigkeit gedroht, die weitreichende Folgen für die Volkswirtschaft gehabt hätte. Auch die Hilfszahlungen, die Frankreich ausschüttete, hiess das Gericht gut.
Klein beigeben wird Ryanair nicht – selbstverständlich werden auch diese Streitigkeiten weitergezogen. Im Interesse des Wettbewerbs und der Kunden, wie ein Ryanair-Sprecher sagte.
6. Irland: Die millionste Passagierin
Ort: High Court of Ireland
Zeit: 19. Juni 2002
Fall-Nr.: [2002] IEHC 154
Thema: Vertragsbruch
Ja, die Kunden, die gehen der Airline über alles.
Als Jane O’Keeffe 1988 nach der Beerdigung ihrer Grossmutter von Dublin zurück nach London fliegen wollte, wartete Ryanair mit einer Überraschung auf: Gratulation! Sie sind die millionste Passagierin! Wenn Sie ein bisschen Promo machen für uns, schenken wir Ihnen Freiflüge auf Lebzeiten.
Deal?
Die 21-jährige O’Keeffe ging darauf ein. Und schon liefen die Kameras der vorab informierten Medien, im Duty-free-Bereich gab es ein Glas Champagner mit dem damaligen CEO P. J. McGoldrick, eine Band spielte auf, dann ein hübsches Foto auf dem Rollfeld. Ein paar Wochen später war die Sache auch vertraglich unter Dach und Fach.
Lange gings gut. Manche Jahre flog die millionste Passagierin fünf- oder sechsmal, andere Jahre bloss einmal. Bis ihr 1997 mitgeteilt wurde, sie habe nur noch einen Freiflug pro Jahr zugute – und dann wurden ihr die Freiflüge ganz verweigert.
Schliesslich hatte sie CEO Michael O’Leary persönlich am Telefon: Sie solle sich zum Teufel scheren.
O’Keeffe verklagte Ryanair wegen Vertragsbruchs.
Das zuständige Gericht in Dublin stellte fest: Alles sowieso nur ein PR-Stunt, O’Keeffe sei auch gar nicht die millionste Passagierin. Vielmehr habe die Airline gewusst, dass sie an jenem Wochenende den millionsten Passagier befördern würde – doch es war pässlicher, die Sache an einem ruhigen Wochentag zu inszenieren.
Ryanair verteidigte sich mit dem Hinweis, der Preis sei ausgelost worden. Man habe sich deshalb der Durchführung einer illegalen Lotterie schuldig gemacht. Der Gewinn sei rechtswidrig – und die einst strahlende Gewinnerin könne keinen Anspruch gegen Ryanair geltend machen.
Von dieser gedanklichen Akrobatik liess sich der High Court in Dublin nicht ablenken. Er verdonnerte die Airline dazu, den Vertrag einzuhalten – und zu einer Entschädigungszahlung von 67’500 Euro an Jane O’Keeffe.
Illustration: Till Lauer