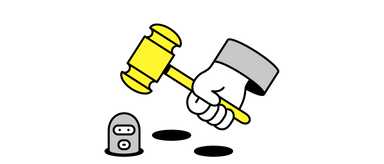
Eine Lektion für die Staatsanwaltschaft
Zwei Männer haben einer älteren Frau für viel Geld ein Bett und Malerarbeiten angedreht. Dafür werden sie per Strafbefehl wegen Wuchers schuldig gesprochen. Aber wie viel ist dieser «Urteilsvorschlag» vor Gericht wert?
Von Daria Wild, 15.02.2023
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Seit der Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung 2011 erledigt die Staatsanwaltschaft praktisch alle Straffälle per Strafbefehl – meistens ohne die Beschuldigten auch nur ein Mal gesehen zu haben: Denn geht es um Freiheitsstrafen bis sechs Monate Gefängnis oder um Geldstrafen bis 180 Tagessätze, muss die Staatsanwaltschaft die Beschuldigten nicht zwingend einvernehmen.
Eine Studie der Universität Zürich hat das Strafbefehlsverfahren stichprobenartig untersucht: Nur in 8 Prozent der Fälle macht die Staatsanwaltschaft eine Einvernahme, bevor sie den Strafbefehl erlässt. Auch deshalb ist das zehntägige Einspracherecht von zentraler Bedeutung.
Die gleiche Studie hat zudem untersucht, was nach einer Einsprache passiert. Das Ergebnis: Mehr als 37 Prozent der Einsprachen werden von den Beschuldigten zurückgezogen. In fast einem Viertel der Fälle hält die Staatsanwaltschaft am Strafbefehl fest, in einem Fünftel der Fälle erlässt sie einen neuen. Sehr selten erhebt sie Anklage an einem erstinstanzlichen Gericht.
Und, besonders problematisch: Gut jedes zehnte Verfahren stellt die Staatsanwaltschaft nach einer Einsprache sang- und klanglos ein. Offenbar erachtet sie in diesen Fällen ihren früheren Schuldspruch plötzlich als derart wenig überzeugend, dass sie die Angelegenheit beendet (vermutlich, weil sie sie gar nie untersucht hat, sondern sich lediglich auf die Polizeiakten stützt).
Was hingegen passiert, wenn sich die Staatsanwaltschaft anders entscheidet und den Fall nach einer Einsprache vor Gericht bringt – darüber gibt es keine Untersuchungen. Es ist nicht bekannt, wie oft und warum es zu Freisprüchen und wie oft zu Verurteilungen kommt. Klar ist: Manchmal lohnt sich eine Einsprache für die Beschuldigten. Und manchmal halt nicht.
Ort: Bezirksgericht Aarau
Zeit: 19. Januar 2023, 9 Uhr
Fall-Nr.: ST.2021.5861
Thema: Mehrfacher Wucher, Einsprache gegen Strafbefehl
Es müsste doch aufgezeigt werden, sagt Strafverteidiger Andreas Miescher in seinem Plädoyer eindringlich, warum man die Frau «über s Näscht abgschrisse het».
Der Berner Mundartausdruck umschreibt, weswegen zwei Männer an einem kalten Januarmorgen vor dem Aargauer Bezirksgericht stehen: Malik Solecki und Tarik Krasniqi, die in Wirklichkeit anders heissen, sollen Frau Huber, die ebenfalls anders heisst, übers Ohr gehauen haben, indem sie ihr im Dezember 2020 ein Bett und im Juli 2021 Malerarbeiten zu überrissenen Preisen verkauften.
Das sei mehrfacher Wucher, entschied die Staatsanwaltschaft und verschickte am 6. September 2022 je einen Strafbefehl an die beiden Männer.
Gegen Solecki, 43 Jahre alt, verhängte sie eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 140 Franken. Gegen den zehn Jahre jüngeren Krasniqi eine unbedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 150 Franken. Das macht mit Gebühren etwas über 3300 im ersten beziehungsweise über 14’500 Franken im zweiten Strafbefehl. Beide Männer erhoben Einsprache.
Der Strafbefehl mutierte zur Anklageschrift.
Würde das Gericht der Staatsanwaltschaft folgen, hätte ein Schuldspruch besonders für Krasniqi weitreichende Konsequenzen. Der 33-Jährige, das geht aus dem Strafbefehl hervor, war auf Bewährung. Er war im Kanton Neuenburg wegen eines Vermögensdelikts per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt worden.
Krasniqi hätte sich, würde er nun schuldig gesprochen, also nicht bewährt. Er müsste die 14’500 Franken bezahlen oder ins Gefängnis. Und seine Probezeit würde um ein Jahr verlängert. Es geht für ihn um einiges.
Ein sauteures Bett
Trotzdem ist das Strafmass zu tief, als dass die Staatsanwaltschaft die Männer zwingend hätte einvernehmen müssen. Sie stützte sich im vorliegenden Fall lediglich auf die Einvernahme der Geschädigten (Frau Huber) durch die Polizei, auf polizeiliche Fotos der Malerarbeiten sowie auf den Kaufvertrag für das Bett.
Daraus schmiedete die Staatsanwaltschaft zwei identische Strafbefehle: Im Dezember 2020 seien Solecki und Krasniqi bei der 76-jährigen Frau Huber «erschienen», hätten vorgegeben, ihre Matratze kontrollieren zu wollen, um ihr dann mitzuteilen, dass ihre Matratze nicht mehr in Ordnung sei und ausgetauscht werden müsse. Die Seniorin unterschrieb einen Kaufvertrag für ein komplett neues Bett mit Zubehör. Kostenpunkt: 19’200 Franken.
Ein halbes Jahr später seien die zwei Männer erneut bei Frau Huber erschienen und hätten ihr angeboten, Malerarbeiten im Vorraum ihres Hauses auszuführen. Huber habe den beiden den Auftrag erteilt, ohne einen Preis zu vereinbaren. Die Männer hätten zunächst 8000 Franken, dann «in mehreren Tranchen immer wieder Zahlungen» gefordert. Schliesslich habe die Frau den Überblick verloren und insgesamt 30’000 Franken für die Malerarbeiten bezahlt.
Der Staatsanwalt wirft den Männern vor, die Frau überfordert und ihre «Unerfahrenheit und Schwäche im Urteilsvermögen» ausgenützt zu haben. Letztlich hätten die beiden sich um 49’200 Franken bereichert.
Mit anderen Worten: Frau Huber über s Näscht abgschrisse.
Mehr als das gibt der zur Anklageschrift mutierte Strafbefehl nicht preis. Und mehr geben auch die Beschuldigten nicht preis. Stoisch sitzen sie auf ihren Stühlen, Solecki in weisser Fleecejacke, Krasniqi in dunklem Mantel, beide in Jeans und tadellos sauberen Schuhen. Sie verzichten auf eine Aussage, sowohl zum Fall als auch zu ihrer Person.
Und weder die Geschädigte Huber noch die Staatsanwaltschaft sind am Prozess anwesend.
Eine richterliche Lektion
Vielleicht auch deshalb hat Gerichtspräsident Reto Leiser die Verhandlung auf gerade mal drei Stunden angesetzt – und sie wird sogar noch weniger Zeit in Anspruch nehmen. Die Effizienz passt zum kargen Gerichtssaal: schwarze Tische, schwarze Stühle, dunkelgrauer Spannteppich, weisse Wände und weisse Vorhänge, dazu jeden Winkel perfekt ausleuchtende Deckenlampen. Ein ausdrucksloser, man könnte auch sagen: ganz auf das Geschehen reduzierter Raum.
Dass in diesen vier Wänden durchaus etwas passiert, liegt an Richter Leiser und den beiden Anwälten. Sowohl Miescher, der Verteidiger von Solecki, als auch Fabian Brunner, Krasniqis Rechtsbeistand, fordern zu Beginn der Verhandlung energisch, die polizeiliche Einvernahme von Frau Huber aus den Akten zu weisen. Es sei, argumentieren beide, das Recht auf Teilnahme und Konfrontation verletzt worden.
Man spricht in diesem Zusammenhang von Parteiöffentlichkeit. Artikel 147 der Strafprozessordnung hält fest, dass die Parteien das Recht haben, bei Einvernahmen dabei zu sein. Das gilt sowohl für Einvernahmen durch die Staatsanwaltschaft als auch für solche, die die Staatsanwaltschaft an die Polizei delegiert.
Gerichtspräsident Leiser, der um einen gewissen Unterhaltungswert ebenso bemüht scheint wie um Effizienz, lehnt den Antrag nach einer kurzen Pause ab. Er habe diese Rüge erwartet, aber «man muss nicht wahnsinnig lange Jus studiert haben», um den Unterschied zwischen verwertbar und aus den Akten weisen zu sehen. So ein Antrag würde in einem Vorverfahren Sinn ergeben, wenn die Einvernahmeprotokolle dann tatsächlich vor der Verhandlung aus den Akten entfernt, in ein Couvert gesteckt und zugeklebt würden.
Die Frage sei hier, ob er die Einvernahme von Frau Huber für das Urteil verwende: «Gelesen habe ich sie sowieso schon.»
Von dieser kurzen Lektion unbeirrt, setzt Miescher in seinem Plädoyer die Kritik an der Staatsanwaltschaft fort und zerpflückt Stück für Stück den knapp vierseitigen Strafbefehl gegen seinen Klienten. Es würden etliche Kriterien für eine genügende Anklage fehlen, sagt Miescher. Frau Huber habe selber zu Protokoll gegeben, bereits vor sieben bis acht Jahren ein Bett gekauft zu haben, das sie als teuer empfunden habe. «Sie beginnt also nicht bei null.»
Im Strafbefehl werde auch nicht klar, wie Huber Kontakt zu den Männern aufgenommen habe, fährt Miescher fort. «Das ist eine Lücke.»
Der Kaufvertrag ist die Pièce de Résistance
In diesem Moment nickt Krasniqi, eigentlich Brunners Klient, aber schliesslich plädieren die Anwälte gegen identische Strafbefehle. Es ist die einzige von den Besucherbänken aus erkennbare Regung eines der Beschuldigten. Das Schicksal der beiden Männer bleibt bis auf ein paar biografische Eckdaten aus dem Strafbefehl unbekannt.
Vermerkt ist hingegen die Bettenfirma, in deren Auftrag die beiden Männer mutmasslich unterwegs waren. Sie wurde im Februar 2020 ins Handelsregister eingetragen und ist seit Juni 2022 in Liquidation. Auf der Website wirbt die Firma für «hochkarätigen» Schlaf und spart ansonsten mit Informationen. Ausser Telefonnummer und Mailadresse verrät sie nichts.
Doch Frau Huber hatte einen Kaufvertrag für das Bett, und der ist aktenkundig. «Pièce de Résistance» nennt Miescher das Papier. Und benennt weitere Lücken im Strafbefehl. Es finde sich kein Hinweis darauf, wieso Preis und Leistung in einem Missverhältnis stünden. Einer der Polizisten habe sogar selbst zu Protokoll gegeben, er könne nicht beurteilen, wie teuer so ein Bett sei. Auch über die Malerarbeiten, die die beiden Männer für Frau Huber erledigten, wisse man nichts. «Es gibt keine Zahlungen, Quittungen, nichts in den Akten», sagt Miescher.
Huber habe selber gesagt, sie habe den Überblick verloren. Das könne gut sein, unklar bleibe aber, warum das zu einem strafbaren Verhalten führen sollte. Die Anklage begründe den Betrag von knapp 50’000 Franken Deliktsumme nicht. Und die Fotos der Malerarbeiten würden keine Mängel zeigen, die nicht mit einer Nachbesserung behoben werden könnten.
Letztlich, argumentiert Miescher, kläre der Strafbefehl nicht, ob es seitens der Seniorin Unerfahrenheit und Abhängigkeit gegeben habe. «Das wäre die Basis für eine Verurteilung.»
Fabian Brunner, Verteidiger des vorbestraften Krasniqi, spart ebenfalls nicht mit Kritik an der Arbeit des Staatsanwalts: «Mit keinem Wort wird umschrieben, was passiert sein soll.» Welche Vorgänge und welcher Sachverhalt den Straftatbestand erfüllen würden, sei unklar. Nicht mal der genaue Tatzeitpunkt sei erwähnt. Zwar werde von der Unerfahrenheit und Schwäche Frau Hubers geredet, aber ohne darzulegen, wie diese ausgenützt worden seien.
Brunner weist darüber hinaus darauf hin, dass die beiden Männer womöglich auch eine andere Rolle gehabt haben könnten, von einer Mittäterschaft werde aber nicht gesprochen.
Das Fazit des Verteidigers: «Hätte man gemacht, wie man das hätte machen müssen, wären wir heute nicht hier.»
Nicht schuldig und doch selber schuld
Gerichtspräsident Leiser braucht nicht lange, um den Fall mit der Gerichtsschreiberin zu besprechen. Dafür nimmt er sich Zeit für die mündliche Urteilsverkündung – und wäre die Staatsanwaltschaft anwesend, gälte die nun anstehende Lektion ihr.
Es sei «äusserst klar», eröffnet Leiser die Urteilsverkündung, dass die Einvernahme von Frau Huber nicht zulasten der Beschuldigten verwertet werden könne, sonst hätte sie parteiöffentlich sein müssen.
Die Staatsanwaltschaft habe sich entschieden, nicht weiter zu untersuchen. Ein Versäumnis: «Sie hätte das mehr an die Hand nehmen müssen.» Es bleiben also: die Fotos der Malerarbeiten und der Vertrag fürs Bett. «Das ist das Einzige, was wir haben», sagt Leiser. Man wisse nicht, wie viel tatsächlich bezahlt worden sei. Dabei wäre auch eine Barzahlung relativ einfach nachzuweisen gewesen. Bei Wucher müsse eine Zwangslage ausgenützt werden, eine Abhängigkeit, Unerfahrenheit oder Schwäche. Das sei hier nicht der Fall.
Dann holt Leiser zu einem kleinen Exkurs aus, in dem man ihn fast zu verlieren glaubt: Man könne grundsätzlich für gelieferte Güter den Preis verlangen, den man wolle. «Ein Skikleid in Gstaad kostet 15-mal mehr als ein Skikleid im Internet», sagt Leiser. Und ein Lacoste-Poloshirt mehr als eins von Coop Fairtrade, obwohl es gleich aussehe, «abgesehen vom Krokodil». In Aarau zahle man 25 Rappen pro Kilowattstunde Strom, beim EWZ in Zürich 15 Rappen – und hier könne man sogar von einer Zwangslage sprechen, aber auch das bedeute nicht, dass es Wucher sei.
Dann kehrt der Einzelrichter in einer steilen Kurve zurück zum Fall: Man könne nicht einfach sagen, schlechte Malerarbeiten oder ein teures Bett seien Wucher. «Bei Wucher braucht es etwas mehr Aufwände seitens der Strafverfolgungsbehörden.»
Mit anderen Worten: Hier hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Trotzdem, sagt der Richter, und dieses Mal gelten seine Worte den Beschuldigten, könne er nachvollziehen, dass «mit solchem Geschäftsgebaren» ein Strafverfahren eingeleitet werde. Dass sie hier sässen, hätten sie vor allem sich selber zuzuschreiben.
Das Gericht spricht die beiden vom Vorwurf des Wuchers frei. Die beiden können aufatmen, zumindest vorerst: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft könnte es weiterziehen.
Illustration: Till Lauer