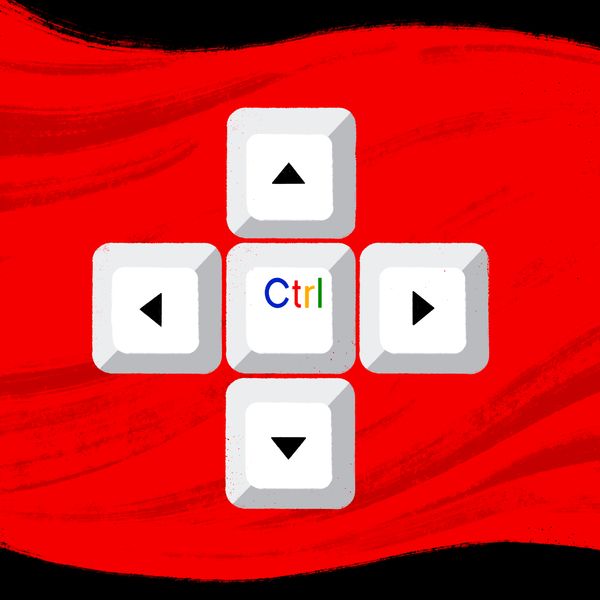Google im rot-grünen Steuerparadies
Wer mit der Bahn in Zürich ankommt, fährt entlang der Europaallee fast ununterbrochen an Google-Büros vorbei. Was macht die Dominanz des Tech-Giganten mit der Stadt? «Do not feed the Google», Folge 9.
Von Lorenz Naegeli, Balz Oertli (Text), Adrià Fruitós (Illustration) und Goran Basic (Bilder), 07.02.2023
Vergangenen Juni eröffnete Google seine neusten Büros an der Zürcher Europaallee. «Google gehört zu Zürich», sagte SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch, als der Konzern 2014 seinen Einzug an dieser prestigeträchtigen Adresse ankündigte. Diese Aussage gilt heute erst recht: Die Zahl der Google-Mitarbeiterinnen in der Stadt hat sich seither vervierfacht, auf mehr als 5000.
Im Zuge dieser Ansiedlung, die vor 20 Jahren bei einem Mittagessen im Nobelrestaurant Kronenhalle begann, entwickelte sich Google Schweiz zu einer der grössten Firmen in der Stadt Zürich und zum grössten Google-Standort ausserhalb der USA. Die «Zooglers», wie die Mitarbeiterinnen hier genannt werden, arbeiten über das ganze Stadtgebiet verteilt: entlang der Europaallee, auf einem Campus auf dem Hürlimann-Areal, im Du-Nord-Gebäude – einer Immobilie mit der imposanten Adresse Bahnhofplatz 1 –, an der Bärengasse, im Herzen des Bankenplatzes, wo sich auch der Hauptsitz der Grossbank Credit Suisse befindet. Und bald schon im Kreis 4 an der Müllerstrasse.
Zürich und Google: Das ist die Geschichte einer beispiellosen Firmenansiedlung, mit der sich sowohl das Unternehmen selbst als auch Politikerinnen aller Parteien schmücken. Die Partnerschaft offenbart aber auch kaum thematisierte Gegensätze zwischen einer liberalen Standortvision und den linken stadtpolitischen Idealen der rot-grünen Regierung. Wird Zürich Opfer seines eigenen Erfolgs? Und von der eigenen Standortpolitik aufgefressen?
Wer Googles Ansiedlung und rasantes Wachstum in Zürich genauer unter die Lupe nimmt, stösst auf die Hofierung eines globalen Konzerns, der anderswo wegen dystopischer Stadtentwicklungspläne, Wettbewerbsverstössen und Steuervermeidung längst harscher Kritik ausgesetzt ist. Über die Beziehung zwischen Google Schweiz und den Behörden von Stadt und Kanton Zürich weiss man wenig, kritische Fragen sind unerwünscht.
Serie «Do not feed the Google»
Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.
Folge 2
Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol
Folge 3
Die Entzauberung von Google
Folge 4
Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind
Folge 5
Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?
Folge 6
Auf dem Roboterpferd in die Schlacht
Folge 7
Gewinne maximieren, bis sie weg sind
Folge 8
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Sie lesen: Folge 9
Google im rot-grünen Steuerparadies
Folge 10
Inside Google Schweiz
Bonus-Folge
Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?
Dokumente, die für diese Recherche via Öffentlichkeitsgesetz eingesehen werden konnten, machen deutlich, wie weit die Behörden dem Unternehmen entgegengekommen sind, damit Zürich zum Google-Standort wird. In einem Brief des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit aus dem Jahr 2002 – zwei Jahre bevor Google sich in Zürich ansiedelte – war von einem «fast track» für das Top-Management die Rede, von «pragmatischen Lösungen» und von einem eigenen Google-Desk in der Verwaltung. Versprochen wurden ein rascher und unkomplizierter Familiennachzug und in Einzelfällen «zusätzliche Arbeitsgenehmigungen für unverheiratete Partner».
Mauer des Schweigens
Wir wollen uns ein genaueres Bild machen von der Beziehung zwischen der Zürcher Verwaltung und Google, reichen Dokumentanfragen ein, fragen nach. Doch der Versuch, Informationen von öffentlichem Interesse zu sammeln, stösst auf eine Mauer des Schweigens.
Fabian Streiff, der Leiter Standortförderung des Kantons Zürich, und Edgar Spieler, stellvertretender Chef des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit, lehnen beide ein Gespräch auch auf mehrmalige Nachfrage ab. Dasselbe im Präsidialdepartement der Stadt Zürich: Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung, sagt zuerst ein Gespräch zu, verschiebt es und sagt es dann ab. Als Begründung erfindet ihr Büro die Regel, dass während ausstehender Anfragen unter Berufung auf das Öffentlichkeitsgesetz keine Interviews gegeben werden. Als sich diese Regel als inexistent herausstellt, heisst es, die Rechtsabteilung habe empfohlen, nur schriftlich Auskunft zu geben. Dort weiss man auf telefonische Nachfrage aber nichts davon.
Als wir beim Amt für Wirtschaft und Arbeit als Reaktion auf die Absagen Einsicht in Akten beantragen, reagiert man irritiert. Die auf das Öffentlichkeitsgesetz abgestützten Anträge würden viel Arbeit verursachen. Zu den Gesprächsanfragen heisst es, das Amt sehe es nicht als seine Aufgabe, «über Fragestellungen zu sprechen, die zum grossen Teil eigentlich mit dem Unternehmen Google besprochen werden müssten». Nach mehreren Interventionen wird uns angeboten, einen Fragenkatalog einzureichen, der schriftlich beantwortet werde. Für die Bereitstellung von Dokumenten via Öffentlichkeitsgesetz berechnete das Amt der Republik 3000 Franken.
Die Dokumente geben Einblick in die Kommunikation zwischen Google und der Verwaltung, die sonst im Verborgenen stattfindet. Es ist eine Sammlung von E-Mails, Powerpoint-Präsentationen, Gesprächsprotokollen und Briefen. Sie zeigen, dass die Behörden gegenüber Google weit weniger Berührungsängste haben als gegenüber Journalistinnen. Edgar Spieler, stellvertretender Amtschef, wird mit lobenden Worten in der Google-Broschüre #GrüeziGoogle zitiert und bezeichnet die Firma dort als «starken, innovativen Partner». Aus internen E-Mails geht hervor, dass das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf Empfehlung von Spieler auch zu gemeinsamen Interviews mit Google bereit ist. Standortförderer Streiff korrespondiert mit den Zürcher Google-Ansprechpartnerinnen in einem freundschaftlichen «Du».
Als «Google-Effekt» bezeichnen Gesprächspartnerinnen der Republik diese Vorgänge: Für Google würden in der Verwaltung von Stadt und Kanton Zürich alle Hebel in Bewegung gesetzt.
Nach Googles Ansiedlung in Zürich 2004 sagte Stephan Kux, damals Leiter der kantonalen Wirtschaftsförderung, in der Wirtschaftszeitung «Cash», man habe Google überzeugen können, dass Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen kein Problem seien: «Innert drei Sekunden» sei ein Antrag online möglich. Dieser öffentlich ausgerollte rote Teppich für Google stiess selbst verwaltungsintern auf Kritik: Urs Gürtler, der Chef des kantonalen Migrationsamts, das geht aus den Dokumenten hervor, die der Republik vorliegen, beschwerte sich schriftlich über die Aussage des Wirtschaftsförderers und verlangte eine Klärung. Insbesondere die prahlerischen Aussagen über den einfachen Bewilligungsprozess für nicht verheiratete Partner von Google-Mitarbeitenden scheinen beim Migrationsamt Ärger ausgelöst zu haben.
Damit konfrontiert, will das Amt für Wirtschaft und Arbeit von Verschwiegenheit, Google-Effekten oder roten Teppichen nichts wissen. Man sei seiner Informationspflicht stets nachgekommen. Und der Ansiedlungsprozess blieb unkommentiert: Schliesslich liege der 20 Jahre zurück.
Google und Zürich: Das sind 30 Jahre Standortpolitik und ihre Folgen.
Im März 1990 hatte Rot-Grün mit dem Wahlsieg von Josef Estermann die Macht in der grössten Stadt der Schweiz übernommen – und damit bis dato 33 Jahre rot-grüne Hegemonie eingeläutet. Die Probleme nach der historischen Wahl waren gross: Rezession, offene Drogenszene, Abwanderung. Ende November 1998 gründete die Stadt Zürich dann zusammen mit dem Kanton und Winterthur die Stiftung «Greater Zurich Area Standortmarketing» (GZA). Sie ist Chefsache und im Präsidialdepartement des Zürcher Stadtpräsidenten angesiedelt.
In den ersten beiden Legislaturen wurden zwar Reformen angestossen, doch die rot-grüne Regierung musste auch in den «Programmschwerpunkten des Stadtrats für die Legislaturperiode 1998 bis 2002» konstatieren: «Die Stadt Zürich hat in den vergangenen Jahren (…) viele Betriebe verloren und rund 40’000 Arbeitsplätze eingebüsst.» Der Stadtrat wollte deshalb einen Gang höher schalten: Er setzte sich einen Kulturwandel in der Verwaltung und schlanke Bewilligungsverfahren zum Ziel.
Die Stärkung der Wirtschaftsförderung war ein Baustein des angestrebten Wandels, der bald einsetzen sollte. Diesen Wandel bilanzierte der Stadtpräsident unter dem Titel «Spürbare Aufbruchstimmung» im Jahr 2000 in der «Neuen Luzerner Zeitung». Estermann sprach von einem «kulturellen Wandel», von «introvertierten Ämtern», die zu «kundenorientierten, transparenten Dienstleistungsorganisationen» werden sollten. Aufgabe der «Greater Zurich Area»: ausländische Firmen ansiedeln, um Arbeitsplätze und Steuern zu vermehren.
Zürcher Noblesse
In dieser Zeit betrat Google erstmals die Schweizer Bühne. 2002 suchte das aufstrebende US-Technologieunternehmen ein europäisches Hauptquartier. Zürich war in der engeren Auswahl und empfing eine Google-Delegation aus dem Silicon Valley. Der Programmablauf des Besuchs und Präsentationen, welche die Republik einsehen konnte, belegen: Die Stadt und der Kanton Zürich scheuten keine Mühen, um die Vertreter von Google zu beeindrucken.
Die Google-Mitarbeiter residierten im 5-Sterne-Hotel Widder, wo sie von Sonja Wollkopf Walt, der heutigen Geschäftsführerin der «Greater Zurich Area» (GZA), am Morgen des 4. September abgeholt wurden, um einen Tag Zürcher Noblesse zu erleben.
Zunächst standen Gespräche mit Vertretern der «Greater Zurich Area» und der kantonalen Verwaltung zu Mitarbeiterrekrutierung und Steuerfragen auf dem Programm. Danach folgte ein Mittagessen im Restaurant Kronenhalle, anschliessend ein Treffen zum Kaffee mit den Steueranwälten von Altenburger & Partners. Am Nachmittag trafen die Google-Vertreter schliesslich den Zürcher Stadtpräsidenten. Der Sozialdemokrat Elmar Ledergerber, der kurz zuvor die Nachfolge von Josef Estermann als Stadtpräsident angetreten hatte, war als langjähriger Nationalrat und Mitglied der Kommission für Verkehr- und Fernmeldewesen sowie der WAK, der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, mit den Anliegen der Technologiebranche vertraut. Zum Abendessen wurde die Google-Delegation schliesslich ins stadtbekannte Restaurant Storchen gelotst, in der Nähe des Stadthauses gelegen und mit Blick auf die Limmat.
Das alles wurde, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit auf Nachfrage bestätigt, von der Stadt und dem Kanton Zürich sowie teilweise der GZA organisiert und bezahlt.
In den Präsentationen, die an diesem Tag den Besuchern aus den USA gezeigt wurden, pries sich Zürich als moderner Standort, der alles hatte, was Google brauchte: gute Schulen, ausserordentliche Infrastruktur, perfekte Lage und ein kulturell diverses Umfeld. Dazu kamen attraktive Steuerbedingungen, die damals noch junge Personenfreizügigkeit mit der EU und eine Verwaltung, die zur vollen Unterstützung bereit war. Ein erstes Mal gab Zürich alles, um zu beweisen, wie kurz die Wege zwischen Wirtschaft und Behörden sind, wie «kundenorientiert» die «Dienstleistungsorganisation» Verwaltung ist. Trotz der beworbenen Vorteile entschied sich Google damals vorerst gegen Zürich.
Etwa zur gleichen Zeit ist Standortförderer James Heim in San Francisco, einem Aussenposten der «Greater Zurich Area», auf Werbemission im Silicon Valley. Schon damals, sagt Heim im Gespräch mit der Republik, konnte man «das Silicon Valley nicht ignorieren, wenn es darum ging, expansionsinteressierte Unternehmen ins eigene Land zu bringen». Viele Tech-Firmen hätten nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Standorte ausserhalb der USA gesucht. In Amerika sei es damals plötzlich schwierig geworden, die nötigen Arbeitsvisa zu erhalten. «Google wollte in Europa einen Forschungs- und Entwicklungsstandort aufbauen», sagt Heim. Drei, vier Länder seien in der engeren Auswahl gewesen, darunter die Schweiz. Das Konsulat habe das Google-Projektteam an die «Greater Zurich Area» verwiesen. So sei er ins Spiel gekommen. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass die Anfrage wichtig sei, denn die Suchmaschine habe sich im Senkrechtstart befunden, «fadegrad mit coolem Design».
Heute steht Heim der rasant wachsenden Tech-Branche und insbesondere ihren Grossunternehmen, aber auch dieser Form des Standortwettbewerbs kritisch gegenüber. Er hat der Standortpolitik vor mehr als zehn Jahren den Rücken gekehrt und arbeitet in der Landwirtschaft.
Das Prinzip der kurzen Wege
Zwei Jahre nach dem ersten Besuch folgte im September 2004 eine weitere Google-Visite in Zürich. Diesmal also nicht für ein Hauptquartier, sondern für den Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungsstandorts. Wie Heim war damals auch Robert Blancpain an der Ansiedlung von Google in Zürich beteiligt. Blancpain, heute pensioniert, arbeitete von 1997 bis 2008 als städtischer Wirtschaftsförderer und baute das Standortmarketing mit auf. Die Googlers hätten Büros für sechs bis zwölf Personen gesucht, sagt er, und dafür Immobilien in der ganzen Stadt besichtigen wollen. «Als ich zufällig erfuhr, dass die Stadt für offizielle Gäste über eine Limousine mit Chauffeur verfügt, war die ideale Lösung gefunden», erzählt Blancpain. Die Google-Delegation wurde in der städtischen Limousine von Büro zu Büro gefahren.
Der einfache Zugang zur Verwaltung ist in den Augen von Blancpain einer der grossen Vorteile von Zürich: «Die Leute waren immer sehr erstaunt, wie einfach sich hier der Kontakt mit den zuständigen Behörden gestaltete. Wir nannten dies das ‹Prinzip der kurzen Wege›.»
Wie kurz sie tatsächlich sind, stellte Blancpain für Google unter Beweis: «Nach Rücksprache mit dem Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber konnte ich dem Teamleiter von Google kurzfristig ein Treffen mit ihm anbieten. Das Treffen fand an einem Mittwoch statt, direkt nach der Gemeinderatssitzung, in einer ruhigen Ecke der Kronenhalle-Bar.» Ledergerber habe dabei nicht nur in seiner repräsentativen Funktion als «Bürgermeister», sondern auch mit seiner Kompetenz in Energiefragen punkten können, sagt Blancpain. Die Angebote des städtischen Elektrizitätswerks (EWZ) und insbesondere die Strompreise seien für Google von grösster Bedeutung gewesen. Schon damals wie auch noch heute, erzählen Mitarbeiter des EWZ, werde alles stehen und liegen gelassen, wenn Google ein Anliegen habe.
Und diesmal trugen die Bemühungen Früchte: Zürich erhielt den Zuschlag für den Forschungs- und Entwicklungsstandort. «Dass sich Google für Zürich entschied, war eine Riesensache», sagt James Heim – der grösste Coup in der Geschichte von Zürichs Standortmarketing. Beat Rhyner, der stellvertretende Chef der Wirtschaftsförderung, sagte damals in der NZZ: «Das ist eine Bombe.»
Ein Swiss-Direktflug für Google
Zum rasanten Aufstieg von Google in Zürich trugen nicht nur kurze Wege in Politik und Verwaltung bei. Auch die Wirtschaft diente sich bei Google an.
Davon erzählt Randy Knaflic, ehemaliger und langjähriger Personalchef von Google Zürich, im Gespräch mit der Republik: «Ich habe zum Beispiel Rolf Jetzer, den ehemaligen VR-Präsidenten der Swiss, wiederholt getroffen, um unsere Anliegen zu vertreten. Das waren viele Meetings im Interesse von Zürich und Google. Für uns war es wichtig, eine direkte Flugverbindung zwischen Zürich und San Francisco zu haben. Wir haben sie schliesslich geschaffen. Ich war Passagier des ersten Direktfluges auf dieser Strecke.»
Während des Videoanrufs steht Knaflic auf, verschwindet kurz und kommt mit einem Swiss-Flugzeugmodell zurück. Ein Erinnerungsstück. Die Maschine wurde extra für die Flüge nach San Francisco im Flower-Power-Design bemalt.
Knaflic, der in der Anfangszeit Googles Gesicht in Zürich war, lebt heute in Milwaukee, er ist in der Start-up-Beratung tätig und angel investor, das heisst, er berät und finanziert auch Unternehmen in deren Gründerzeit. Mit Blick auf die Entwicklung von Google in Zürich unterstreicht er das «unternehmensfreundliche Klima» als wichtigen Faktor: «Die Schweiz bietet neben allen anderen Vorteilen ein attraktives Arbeitsrecht. Die kurzen Anstellungs- und Entlassungsfristen sind ein oft übersehener Aspekt, der für Zürich sprach. Märkte mit langwierigen Kündigungsfristen wirken sich negativ auf innovative Unternehmen aus. In diesem Sinne ist das Arbeitsrecht in der Schweiz sehr innovationsfreundlich.»
Für Zürich und sein Standortmarketing sind der Aufstieg von Google und der Ausbau in der Stadt eine Bestätigung ihrer Strategien. Im Mai 2006 zog der Gemeinderat Bilanz über die Ansiedlungserfolge der «Greater Zurich Area»: Unter ihrer Mitwirkung gab es 280 Ansiedlungen innert dreier Jahre, davon 63 in der Stadt. Die Ansiedlung von Google und der Ausbau des sogenannten ICT-Clusters, also des sich formenden Standorts für Informations- und Kommunikationstechnologie, wurden explizit gelobt, wie auch die ETH als «prägende Institution».
Google selbst, aber auch viele Gesprächspartnerinnen betonen, wie wichtig die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich und die École polytechnique fédérale (EPFL) in Lausanne als weltbekannte Hochschulen beim Ansiedlungsentscheid waren. Für den Konzern bedeutet der Standort Zürich auch Zugang zu einer wichtigen Bildungsinstitution und damit zu begehrten Arbeitskräften.
Inzwischen gilt Google als «Staubsauger» für ETH-Absolventinnen und ist eng mit der ETH und der EPFL verbandelt. Seit 2016 schloss die ETH mit Google 51 Forschungsverträge ab, im Umfang von 6,6 Millionen Franken. Konkrete Resultate dieser Verträge sind über 70 gemeinsam verfasste wissenschaftliche Artikel, die Google und die ETH allein seit 2020 publizierten.
Die EPFL weist seit 2018 41 Zusammenarbeiten mit Google aus, die sich der Konzern 3,7 Millionen Franken kosten liess, zusätzlich spendete Google 2 Millionen ohne Auflagen an die EPFL. Der Ende 2022 nach Osteuropa beförderte Schweizer Google-Chef Patrick Warnking sitzt zudem seit 2017 im Global Advisory Board der ETH.
«Pretty awesome»
Für ein erfolgreiches Standortmarketing sei besonders die Zeit nach der Ansiedlung relevant, sagt Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin der «Greater Zurich Area» und seit über 20 Jahren im Standortmarketing tätig. Sie sagt auf eine Gesprächsanfrage der Republik sofort zu. Wir treffen Wollkopf Walt am Limmatquai 122, einem ehemaligen Google-Standort. Doch ihre Aussagen aus dem Gespräch zieht sie alle wieder zurück. Ein Ex-Tamedia-Journalist, der heute Sprecher der «Greater Zurich Area» ist, versucht danach bei einem Republik-Mitarbeiter herauszufinden, was in dieser Recherche stehen könnte. Anstelle der vorgeschlagenen Zitate von Wollkopf Walt gibt es geschliffene, aber wenig aussagende PR-Antworten über den «Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb», von der «nachhaltigen Ansiedlung qualitativ attraktiver Unternehmen» und der Verbesserung der «wirtschaftlichen Wertschöpfung».
Fakt ist: Bereits nach drei Jahren wurde am ursprünglichen Zürcher Standort der Platz für Google zu knapp. Fündig wurde man auf dem Gelände der ehemaligen Bierbrauerei Hürlimann. Google zog ab 2007 schrittweise auf das Areal. Bald galt es als Googles Vorzeigeprojekt. Die Büros boten Rutschbahnen, Massageplätze, Billardtische und Seilbahngondeln für Sitzungen oder Telefongespräche.
«Pretty awesome» habe sich Google in Zürich entwickelt, sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch 2013 in einer Laudatio, als auf dem Areal ein weiteres Google-Gebäude eröffnet wurde. Mit dem Ausbau gehöre Google nun zu den 50 grössten Arbeitgebern in der Stadt. Heute liegt der Konzern in dieser Rangliste noch weiter oben, beispielsweise vor Unternehmen wie Swiss Re, Zurich oder Swiss Life. «Wenn die Ansiedlung damals wie eine kleine Sensation anmutete, dann empfinde ich dieses enorme Wachstum als die wahre Erfolgsgeschichte», sagte Mauch. Zur Beziehung von Google mit der Stadt sagte sie: «Die Firma pflegte einen guten Dialog mit Politik und Verwaltung.» Dann posierte sie lachend für gemeinsame Fotos mit dem damaligen Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking.
Steuergeheimnis für Steuervermeider
Verschlossener geben sich Google und die Zürcher Politik, wenn es um die Details ihrer innigen Beziehung geht. Zum Beispiel um die Frage, was Google in Zürich an Steuern zahlt. Ganze zehn Jahre lang schwiegen Stadt, Kanton und Google erfolgreich dazu. An den Feierlichkeiten auf dem Hürlimann-Areal sagte Mauch 2013 dann, Google gehöre inzwischen zu den 100 grössten Steuerzahlern in der Stadt. Die Aussage war eine Reaktion auf zunehmende Kritik aus Medien und Politik – auch aus den eigenen Reihen. Damals begannen erstmals Misstöne die harmonische Beziehung zwischen Stadt und Google zu stören, nachdem Googles internationale Steuertricks bekannt geworden waren: Google zahle auch in Zürich kaum Steuern, so der Vorwurf.
Vereinzelte Stimmen aus der regierenden Zürcher Sozialdemokratie, wie zum Beispiel Nationalrätin Jacqueline Badran, prangerten diese Steuerpolitik an. Darauf folgten Nachverhandlungen zwischen dem kantonalen Steueramt und Google, bei denen man sich offenbar einigte. Über den konkreten Inhalt der Verhandlungen oder gar der Einigung schwiegen sich die Parteien aus.
Dass Google weitherum umstrittene Steuervermeidungsstrategien nutzt, war damals längst bekannt. Mit Blick auf die 2012 publik gewordenen Tricks wie etwa die Verlegung des Geschäftssitzes nach Irland, dank denen Google in Grossbritannien trotz fünf Milliarden Umsatz praktisch keine Steuern zahlte, sagt Margaret Hodge, ehemalige Vorsteherin des Komitees für öffentliche Ausgaben in Grossbritannien, in Teil 7 dieser Serie: «Google manipuliert absichtlich die Realität seiner Geschäfte, um nicht seinen gerechten Anteil an Steuern für das Gemeinwohl zahlen zu müssen.»
Und in der Schweiz?
Bis heute sind zu den hiesigen Steuerpflichten des Konzerns keine Details bekannt. Nachfragen bei Stadt, Kanton und Google bleiben allesamt unbeantwortet. Das kantonale Steueramt verweigerte gar ein Telefongespräch mit dem Verweis auf den umfassenden Geltungsbereich des Steuergeheimnisses.
Steuerexpertinnen kommen im Gespräch mit der Republik zur Einschätzung, dass es sich bei der Google Switzerland GmbH um eine Konzernhilfsgesellschaft handeln könnte, die mit dem Kanton ein sogenanntes «Cost-plus-Steuerruling» vereinbart hat. In einem solchen Setting meldet der Konzern den Steuerbehörden seinen Aufwand (cost). Von diesem gilt dann ein fix abgemachter, verhältnismässig niedriger Prozentsatz als Gewinn (plus), und dieser wird besteuert. Mit anderen Worten: Die Steuerbehörden besteuern nicht die Einnahmen (in Form der Gewinnsteuer), sondern die Ausgaben (in Form eines fixen Prozentsatzes des Aufwands).
Für den Kanton hat das den Vorteil, dass die jährlichen Steuereinnahmen sehr berechenbar sind. Und Google zahlt damit deutlich tiefere Steuern, als wenn das Unternehmen auf den eigentlichen Gewinn besteuert würde. Den Umsatz in der Schweiz schätzt das Branchenmagazin «Computerworld» für 2021 auf ungefähr 3,6 Milliarden Franken. Offiziell jedoch verdient Google hier wohl kaum etwas. Denn ein Blick in Googles allgemeine Geschäftsbedingungen zeigt: Wer in der Schweiz Google-Services benutzt, nutzt juristisch betrachtet einen irischen Dienst. Der Umsatz dieser Dienste fällt also weiterhin in Irland an. Diese Praxis wäre demnach eine Fortführung der altbekannten Gewinnverschiebungsstrategie.
Aus politischer Sicht stellt sich die Frage, warum Stadt und Kanton einen Konzern umgarnen, der die Schweiz für seine öffentliche Infrastruktur liebt, der Milliardengewinne erzielt und einige Teilhaber wie die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page oder den Schweizer Urs Hölzle zu Milliardären machte, während er gleichzeitig Dutzende Milliarden am Fiskus vorbeitransferiert. Zürich zeichnet sich nicht nur durch kurze Wege in Politik und Verwaltung aus, sondern auch als steuerlich attraktiver Standort mit äusserst verschwiegenen Behörden. Da sind die linke Stadt und der bürgerliche Kanton geeint.
Hat sich Zürich verzockt?
Es sind die perfekten Bedingungen für Googles Wachstum in Zürich. Im Sommer 2022 wurden weitere Gebäude an der Europaallee eröffnet, direkt im Zentrum der Stadt, zwischen dem Hauptbahnhof und der Langstrasse. An der Müllerstrasse beim Stauffacher werden für Google an allerbester Lage zwei Gebäude mit einer Nutzungsfläche von 15’000 Quadratmetern umgebaut. Geplante Eröffnung: Frühjahr 2023. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass Google im Kreis 2 die früheren IBM-Büros am General-Guisan-Quai übernimmt. Die Frage, ob Google in Zürich bald 10’000 Mitarbeiter habe, beantwortet Chefentwickler Urs Hölzle im «Blick»-Interview mit «Vielleicht».
Zürich spielt vorne mit im globalen Standortwettbewerb und will sich zu einem Top-Standort für ICT-Dienstleistungen entwickeln. Dafür braucht es laut einem Positionspapier der Stadt unter anderem «gut qualifizierte Arbeitskräfte, eine lebendige Start-up-Szene, eine zweckmässige Infrastruktur sowie eine aktiv gepflegte Zusammenarbeit zwischen Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft». Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen: Das funktioniert, zahlreiche wichtige Akteure der Branche siedeln in und rund um Zürich an.
Diese Richtung gibt der Stadtrat in seinem Strategiepapier «Zürich 2035» vor. Weg von den Banken, hin zu Tech. Für dieses Szenario wirbt neben der «Greater Zurich Area» auch Dorian Selz, IT-Unternehmer und GLP-Gemeinderat in Zollikon.
Die Tech-Branche sei die grosse Chance für die Schweiz und insbesondere den Raum Zürich, den Wohlstand zu sichern: «Zehn Prozent vom hiesigen Bruttosozialprodukt kommen vom Finanzplatz. Ein Teil davon muss ersetzt werden, und gerade deshalb sollten wir dieses Modell offensiver bewerben.» Selz sagt, die Transformation in Richtung Tech-Standort sei in vollem Gang, und spricht gleichzeitig von «unerwünschten Nebeneffekten» in einer Stadt, in der sich neben Google inzwischen auch Meta, Disney und etliche weitere US-Tech-Konzerne angesiedelt haben.
«Zürich hat die Sogwirkung von Google und die kollateralen Auswirkungen der Ansiedlung unterschätzt», sagt Selz. «Wenn eine Branche, in der die Anfangssaläre bei über 100’000 Franken liegen, sich an einem neuen Ort ansiedelt und dann in diesem Ausmass wächst, hat das einen Effekt nicht nur auf den Wohnungsmarkt, sondern auch auf die allgemeine Infrastruktur, auf die Strassen, das S-Bahn-Netz.» Und da spiele eben auch eine Rolle, dass Konzerne wie Google aufgrund ihrer Optimierungspraktiken kaum steuerpflichtig seien: «Was ist der Beitrag von Google an den nötigen Ausbau der öffentlichen Infrastruktur? Das Steuersubstrat der Mitarbeitenden ist zwar erheblich, aber das Unternehmen Google zahlt vergleichsweise wenig Steuern hier in Zürich. Ist das richtig und vor allem fair?» Das gelte übrigens auch für andere grosse Player wie Facebook oder Microsoft.
Zürich habe sich blenden lassen von der Aussicht auf das Steuersubstrat der Google-Mitarbeiterinnen und eine Standortpolitik betrieben, die nicht nur das beispiellose Wachstum von Google in Zürich befördere, sondern auch Dutzende weitere Firmen mit Tausenden weiteren Expats angelockt habe, lautet der Tenor von Stimmen aus den unterschiedlichsten Ecken. Auch in Teilen der SP wird diese Kritik inzwischen geteilt. Der Stadtzürcher SP-Co-Präsident Oliver Heimgartner beispielsweise äusserte sich in den letzten Monaten wiederholt auffällig kritisch zur Standortpolitik der letzten Jahre. Es dürfe nicht sein, dass Expats von Google und Co. die Stadt übernehmen. Der Stadtrat soll deshalb sofort seine Zahlungen an die «Greater Zurich Area» kürzen.
Als Folge der Ansiedlungspolitik sind Wohnungen in der Stadt Zürich nicht nur knapp, sie werden auch immer teurer: Die Mieten sind im 20-Jahr-Vergleich um 40 Prozent gestiegen, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt. Der stärkste Mietanstieg fand dabei im Kreis 4 statt. Im früheren Arbeiterquartier – in dem sich auch die Google-Standorte Europaallee und Müllerstrasse befinden – stieg der Quadratmeterpreis um bis zu 60 Prozent an.
Die Verdrängung geschieht oft nach demselben Muster: Bestehende Mieterinnen erhalten die Kündigung mit dem Verweis auf Totalsanierung, können sich die sanierten Wohnungen nach dem Umbau aber nicht mehr leisten und sind gezwungen, auf dem überhitzten Wohnungsmarkt nach bezahlbaren Alternativen zu suchen.
Der Google-Effekt: Kurz nachdem bekannt wurde, dass an der Müllerstrasse im Kreis 4 zwei Gebäude für Google umgebaut werden, erhielten alle Bewohner im Haus nebenan die Kündigung. Die Begründung: Renovation. An der Ecke Müllerstrasse/Ankerstrasse ist zudem ein Wohnprojekt mit Lofts im Luxussegment geplant. Zweieinhalb- bis Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen ab 3400 Franken bis 5800 Franken im Monat.
Google sei ein treibender Faktor für diese Eskalation auf dem Wohnungsmarkt, sagt Walter Angst, Politiker der Alternativen Liste und Co-Geschäftsleiter des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbands. Altbauwohnungen mit drei oder vier Zimmern würden heute bis zu 6000 Franken auf dem Markt kosten, sagt er. Viele einzelne Häuser würden umgebaut und luxussaniert. Das sei die Folge davon, so Angst, dass die rot-grüne Mehrheit bei der Stadtentwicklung und der Standortpolitik zu einseitig die Steuern im Blick gehabt habe: «Für die war wichtig, dass die Steuern fliessen – von den Banken, den Versicherungen und auch den Tech-Firmen. Nun konzentrieren die sich alle auf den Standort Zürich. Wie Google. Und damit hat man Zürich als Hochlohnstandort gefestigt.»
FDP-Politiker und IT-Unternehmer Marc Bourgeois sagt, wie der Grünliberale Selz begrüsse er die Entwicklung, in der sich die Stadt befinde. Aber er stimmt Selz zu, dass die «Transformationsphase» eine Herausforderung darstelle. Sie führe nämlich bei kleinen IT-Unternehmen zu Personalmangel und es entstünden gesamtgesellschaftliche Nebeneffekte: Grosse Konkurrentinnen wie die Swisscom, aber insbesondere auch kleine IT-Firmen oder auch die ETH hätten im Rennen um Talente gegenüber Google oft das Nachsehen. Auch er selbst spüre – etwa wegen der sehr hohen Löhne, die Big Tech bezahle – mit seinem IT-KMU den Druck und die Marktmacht von Google, sagt FDP-Politiker Bourgeois. Er habe Mühe, Personal zu finden: «Obwohl ich gut bezahle, finde ich kaum neue Leute auf dem Markt.»
Es bleibt still in der Stadt
Bei der SVP hingegen freut man sich über die zahlungskräftige Zuwanderung: 2015 bezeichnete der heutige Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), damals Volkswirtschaftsdirektor und in dieser Funktion Vorsteher der «Greater Zurich Area», den Google-Ausbau in Zürich als Beispiel für das Funktionieren der Masseneinwanderungsinitiative. Kontingente für die Topleute, die die Wirtschaft braucht, für alle anderen bleiben die Türen zu. Die Klassenfrage schafft umgekehrte Vorzeichen bei Migrationsthemen: Linke Kräfte argumentieren dafür, die Migration von Expats zu beschränken, bürgerliche Stimmen setzen sich für die gut verdienenden Arbeitskräfte ein.
Der Konflikt zwischen liberaler Standortpolitik und linker Stadtpolitik dreht sich allerdings um mehr als zugezogene Arbeitskräfte. Es geht dabei um die Frage nach dem Geschäftsmodell, das in Zürich dominieren soll, um die Infrastruktur, das Steuermodell, den Verdrängungswettbewerb. Letztlich dreht sich Standortpolitik aber auch um die Firmen selber.
In Berlin wurde Google 2018 regelrecht aus der Stadt gejagt, als der Konzern in Kreuzberg einen Campus eröffnen wollte. In Toronto versenkte ein breites Protestbündnis Googles dystopisches, milliardenschweres Smart-City-Projekt. Die EU verhängte 2022 eine Rekordstrafe gegen Google wegen seiner Geschäftspraktiken. Und die US-Behörden wollen die Big-Tech-Monopole gar zerschlagen.
In Zürich hingegen bleibt es auffällig still, wenn es um das Geschäftsmodell von Google geht, um den Überwachungskapitalismus, den die EU wenn nicht verbieten, dann massiv regulieren will. Oder um das Marktmonopol. Schon kritische Fragen zu Google stören hier.
«Die Kritik fehlt in der Tat», sagt Grünen-Präsident Balthasar Glättli, Stadtbewohner und früher selber IT-Unternehmer. «Das linke, rot-grüne Zürich hat immer gut gelebt mit Banken und Versicherungen, aber da gab es klare, kritische Forderungen nach einem sauberen Finanz- und Versicherungsplatz.» Das Gleiche müsse auch für Google, Microsoft, IBM gelten. Das beziehe sich nicht nur auf die Standortfaktoren, sondern auch auf das grundsätzliche Geschäftsmodell: «Die Tendenz zum Monopol ist eine Grundgefahr, ja fast schon ein zwingender Mechanismus der Plattformökonomie: Da, wo alles ist, ist es attraktiv.» Mit Blick auf Google in Zürich sei es «angezeigt», sagt Glättli, dass der Unternehmensstandort diese und andere kritische Punkte klar thematisiere: «Da haben wir als urbane Gesellschaft auch eine moralische Verantwortung.»
Die Geschichte von Google in Zürich ist die Geschichte einer Stadt und eines Kantons, die an Konzerne aus aller Welt das Signal aussenden, sich hier niederzulassen. Die Wege sind kurz, Diskretion ist garantiert. Die Firmen werden umgarnt, es existiert eine fast schon kollegiale Nähe zu Behörden und Verwaltung. Kritische Fragen? Lieber nicht. Über negative Effekte oder die globalen Aktivitäten der angesiedelten Konzerne wird nicht oder nur sehr ungern gesprochen. Auch für dieses Schweigen steht Googles Erfolg in Zürich. Wie lange noch?
Zur Serie «Do not feed the Google» und zu den Autoren
Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem Dezentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv.
Lorenz Naegeli arbeitet als freier Journalist und als Teil des Recherchekollektivs WAV an unterschiedlichen Rechercheprojekten, insbesondere im Bereich Rüstungsindustrie, Sicherheit und Überwachung oder Militarisierung und Migration. Balz Oertli arbeitete in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen als Journalist beim SRF. Seit diesem Jahr arbeitet er vollständig beim WAV. Diese Recherche wurde von der Republik finanziert. Zusätzliche Unterstützung erhielten die WAV-Autoren von Investigativ.ch und Journafonds.