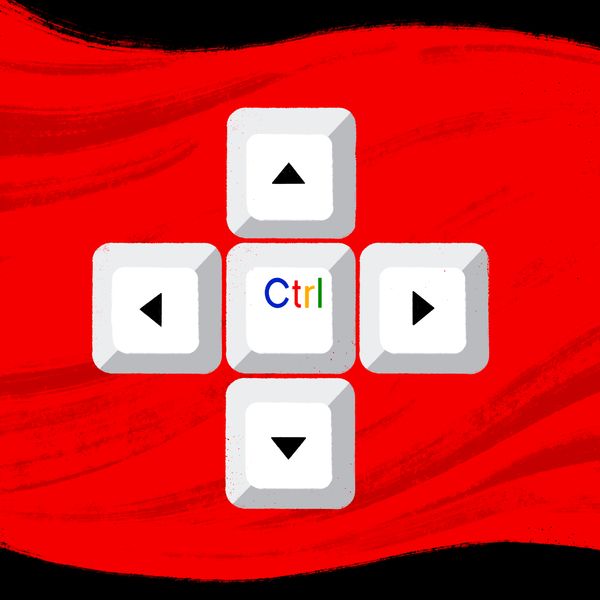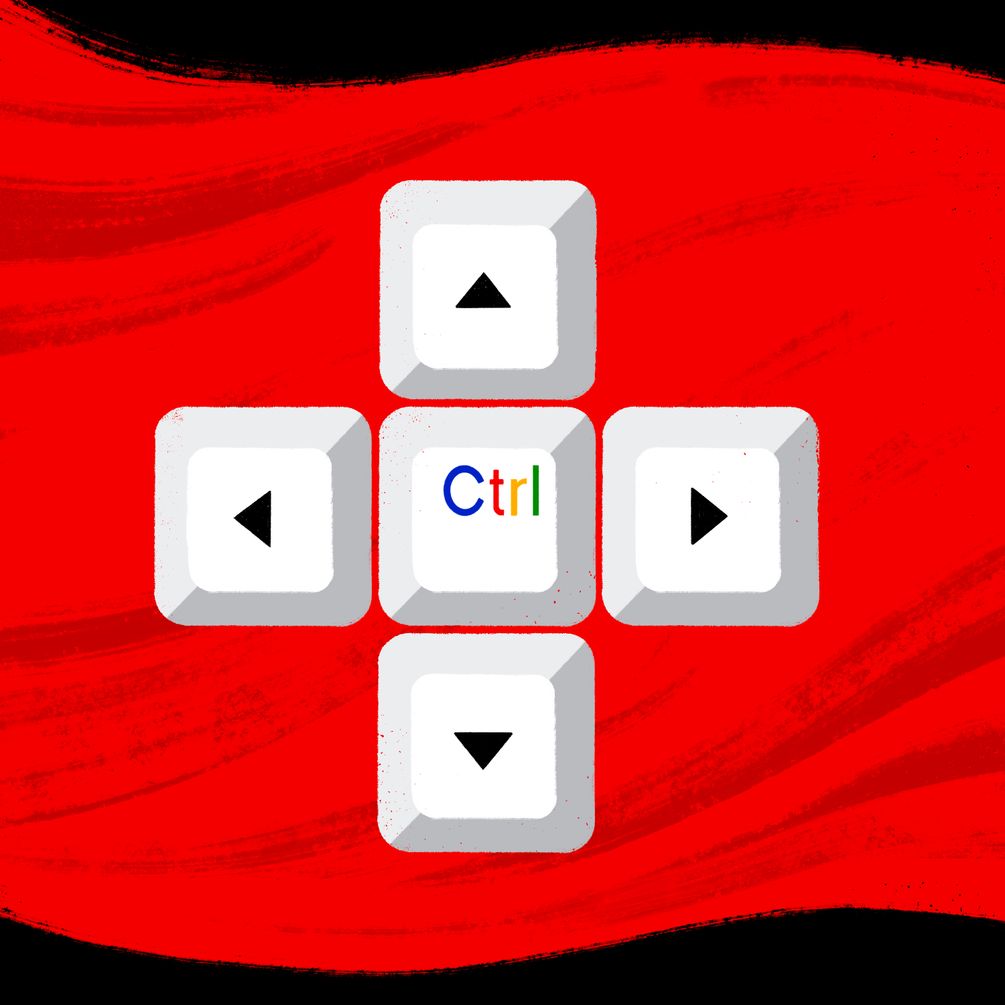
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Wie sich Google in der Schweizer Politik eingenistet hat und auf der Klaviatur des Lobbyings spielt, damit der Konzern bekommt, was der Konzern will. «Do not feed the Google», Folge 8.
Von Reto Naegeli, Balz Oertli (Text) und Adrià Fruitós (Illustration), 02.02.2023
«Dear Eric»: Johann Schneider-Ammann begrüsste zuerst den anwesenden Eric Schmidt, Verwaltungsratspräsident von Alphabet, dem Google-Mutterkonzern. Erst danach wendete sich der Bundesrat und Wirtschaftsminister an die anwesenden Schweizer Politikgrössen und Journalistinnen: «Meine Damen und Herren, Zürich und Google: Das ist eine Liebesgeschichte.»
Seit 2004 ist Google in Zürich beheimatet, Mitte Januar 2017 feierte der Konzern die Eröffnung der ersten Büros an der Europaallee, im ehemaligen Sihlpostgebäude. Top-Büros an Top-Lage. Schneider-Ammann war extra für diesen Anlass vom Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos angereist. Er schwärmte von der langjährigen Beziehung zwischen Google und der Schweiz und bedankte sich beim Internetkonzern für die Investitionen und das Vertrauen.
Die Ansiedlung des Konzerns in der Schweiz gilt bis heute als grösster Coup des Zürcher Standortmarketings. Wer heute mit der Bahn in der Stadt Zürich ankommt, fährt ab Höhe der Langstrasse bis zum Hauptbahnhof ununterbrochen an Google-Büros vorbei. Mehr als 5000 Zooglers, wie die Mitarbeiter in den beiden Bürokomplexen in Zürich genannt werden, arbeiten inzwischen in der Schweiz am weltweit grössten Standort ausserhalb der USA.
Google und die Schweiz, Google und Zürich – diese «Liebesgeschichte» wirft Fragen auf. Während anderswo, in Toronto oder Berlin, dem US-Tech-Konzern ein rauer Wind entgegenschlägt und auf EU-Ebene an seiner Zerschlagung gearbeitet wird, scheint die Beziehung zur Eidgenossenschaft ungetrübt und innig.
Basiert diese Liebe darauf, dass hierzulande kaum jemand kritische Fragen stellt? Wie mächtig ist Google nach zwei Jahrzehnten Präsenz in der Schweiz? Wie vernetzt in Politik, Wirtschaft und Verwaltung? Und wie nützlich ist für Google eigentlich, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist?
Serie «Do not feed the Google»
Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.
Folge 2
Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol
Folge 3
Die Entzauberung von Google
Folge 4
Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind
Folge 5
Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?
Folge 6
Auf dem Roboterpferd in die Schlacht
Folge 7
Gewinne maximieren, bis sie weg sind
Sie lesen: Folge 8
Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte
Folge 9
Google im rot-grünen Steuerparadies
Folge 10
Inside Google Schweiz
Bonus-Folge
Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?
Zu Beginn stossen wir bei den Behörden und in politischen Kreisen mit unseren Fragen auf Unverständnis. Google wolle in der Schweiz einfach in Ruhe gelassen werden. Googles Interessen würden anderswo liegen, in Brüssel oder Washington. Die Schweiz sei zu klein, zu unbedeutend. Doch wir bohren weiter. Wir fragen uns durch die Schweizer Politik, telefonieren Behörden ab, stellen Gesuche via Öffentlichkeitsgesetz.
Dabei wird immer klarer: Google ist überall in der Schweizer Politik. Je tiefer wir schürfen, desto deutlicher wird das ausgeklügelte Lobbying des Tech-Konzerns sichtbar. Es steht demjenigen anderer Lobbygrössen – den Banken, den Versicherungen, der Pharma – in nichts nach. Es operiert mit Botschaften, die verfangen. Und stellt sicher, dass Google Schweiz bekommt, was Google will.
Botschaft Nr. 1: Google ist gutschweizerisch
Vorangetrieben haben Googles Schweizer Lobbyingstrategie in den letzten Jahren vor allem zwei Personen: Anton Aschwanden im Hintergrund und Patrick Warnking in der Öffentlichkeit.
Anton Aschwanden studierte Politikwissenschaften in Genf. Auf Fotos ist der 42-Jährige stets adrett gekleidet, trägt Hornbrille und Seitenscheitel. Er verdiente seine Lobbyingsporen bei der Alpeninitiative ab, wo er verantwortlich war für internationale Verkehrspolitik. 2011 stiess er zu Google, heute ist er gemäss eigenen Angaben «Head of Government Affairs and Public Policy, Switzerland & Austria».
Im Bundeshaus geniesst Aschwanden einen ausgezeichneten Ruf von links bis rechts. Viele kennen ihn und finden ausschliesslich lobende Worte. Er gilt als unaufdringlich, professionell und respektvoll. Ganz im Gegensatz zu den Lobbyisten der anderen grossen ausländischen Tech-Firmen, die als schlecht informiert, wenig bis nicht engagiert und schwer zu erreichen wahrgenommen werden.
Google, der gute Tech-Konzern unter den Bösen, der sich in das politische System der Schweiz eingefügt hat und seine Verantwortung wahrnimmt: Diese Erzählung zieht sich wie ein roter Faden durch das Google-Lobbying von Anton Aschwanden. Man spüre im Umgang mit dem Konzern immer wieder, wie sehr Google bemüht sei, zu vermitteln, sagt SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, bis 2019 Präsidentin der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen: «Wir sind nicht nur die grossen Bösen.»
Doch Lobbyist Anton Aschwanden schaffte sogar mehr: Google hat in der Schweiz nicht nur keinen schlechten Ruf wie andere Tech-Konzerne, sondern gilt nahbar, gar als Firma made in Switzerland.
Diesen Eindruck teilt auch Hannes Gassert, Zürcher IT-Unternehmer und SP-Politiker: «Früher hat sich Google nicht dafür interessiert, wie die Schweiz funktioniert. Google war unsichtbar. Heute merkt man: Google lobbyiert, geht raus und bringt sich ein. Sie geben sich richtig schweizerisch.»
Wie gut das verfängt, zeigt sich im Gespräch mit Parlamentariern. Viele erzählen die Google-Erfolgsgeschichte so wie GLP-Nationalrätin Judith Bellaiche, die im Wirtschaftsverband Swico der ICT- und Online-Branche als Geschäftsführerin tätig ist: Google sei schon sehr lange hier, habe klein begonnen und sei gemeinsam mit der Schweiz gewachsen. Googles Wachstum in der Schweiz sei ein grosses Kompliment und habe wesentlich zur Entwicklung der Schweiz als Digitalisierungsstandort beigetragen.
Wie hat Aschwanden das bloss geschafft, einen weltweit umstrittenen und längst als viel zu mächtig geltenden globalen Konzern in eine sympathische Schweizer Firma zu verwandeln?
Gerne hätten wir mit Anton Aschwanden darüber gesprochen. Persönlich und wiederholt via Medienstelle kontaktierten wir ihn. Doch nach einigem Hin und Her teilte uns Google-Sprecher Samuel Leiser mit, Aschwanden sehe es nicht als seine Aufgabe, Interviews zu geben, und habe kein Interesse an einem Gespräch. Er bleibe lieber im Hintergrund.
Sowieso ändert sich der Ton von Google im Verlauf dieser Recherche abrupt, als dem PR-Team von Google nach einem freundlichen Kennenlernkaffee klar wird, dass wir nicht nur mit Google, sondern auch mit Politikerinnen und Behördenvertretern sprechen und via Öffentlichkeitsgesetz Anfragen stellen. Kurz darauf teilt man uns mit, «dass Google über die öffentlich verfügbaren Informationen hinaus nicht für ein Gespräch zur Verfügung steht.» Darum hat Google Schweiz auch nicht Stellung genommen zu den Fragen, die wir vor der Veröffentlichung vorgelegt haben.
Google, das bekommen wir immer wieder zu spüren, hat kein Interesse an kritischer Öffentlichkeit. Vielleicht erklärt auch das die Liebe zur Schweiz.
Botschaft Nr. 2: Google ist ein Vermittler unter vielen
Wie umtriebig Aschwanden im Bundeshaus für Google lobbyiert, zeigt allein der Blick ins vergangene Jahr. Noch bevor die Schweizer Stimmbevölkerung im Februar 2022 das Medienpaket bachab schickte, lud die nationalrätliche Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen im Januar zu einer Anhörung. Thema: das Leistungsschutzrecht. Damit wollen sich Schweizer Verlage Links von Google auf ihre Medieninhalte vergüten lassen. An der Anhörung nahm auch Google-Cheflobbyist Aschwanden teil, wie mehrere Anwesende bestätigen. Er machte dabei die Position von Google klar: Google sei nur technischer Vermittler von Links und nicht von Inhalten, ein Leistungsschutzrecht daher der falsche Weg. Es ist Googles Kernargument in dieser Debatte, und Aschwanden platziert es, wo er kann.
Nur gerade einen Monat nach der Anhörung zum Leistungsschutzrecht erschien Anton Aschwanden erneut im Bundeshaus, dieses Mal auf Einladung der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats. Dort stand er Rede und Antwort zum Thema «Einfluss von Digitalplattformen auf die Demokratie».
Aschwanden argumentierte erneut, Google sei nur Vermittler von Inhalten. Er geht noch weiter und fordert gar amerikanisches Recht in der Schweiz. Es brauche ein Haftungsprivileg, frei nach amerikanischem Vorbild, wo Plattformen – wie Google – per se nicht wie Verleger für die Inhalte ihrer Plattformen haften. Er gab sich diskussionsbereit, plädierte für globale Lösungen und wiederholte sein Mantra: Das Problem sei nicht Google, das Problem seien die anderen.
Im Protokoll der Anhörung ist dieses Argument gleich doppelt zu lesen: Zuerst wies Aschwanden darauf hin, problematischer als Google seien Plattformen wie Telegram. Deren Vertreter hätten sich ja nicht einmal die Mühe gemacht, an der Anhörung vor der Staatspolitischen Kommission zu erscheinen. Als er von CVP-Präsident Gerhard Pfister auf das Leistungsschutzrecht angesprochen wurde, sagte Aschwanden, nicht nur Google verdiene im Internet mit Werbung sein Geld, sondern auch die grossen Schweizer Verlage. «Die Kleinanzeigen haben sich vom gedruckten Printbereich auf Homegate, Jobs.ch oder Autoscout24 verschoben. Diese Portale gehören den grössten schweizerischen Verlagen. Das Geld hat sich innerhalb der Verlage umverteilt. Dies stellt einen weiteren Grund dar, weshalb ein Leistungsschutzrecht der falsche Ansatz wäre.»
Will heissen: Wenn die Verlage ihr verdientes Geld im Internet nicht in ihre Medien und Journalismus investieren, warum sollte Google dafür bezahlen?
Anton Aschwanden platziert seine Botschaft nicht nur im Parlament. Er stellt sicher, dass alle relevanten Akteurinnen Googles Sicht der Dinge kennen. Die beiden erwähnten Anhörungen vor Parlamentskommissionen stehen im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren. Für das Leistungsschutzrecht (Anhörung eins) ist das Institut für geistiges Eigentum verantwortlich, für die Regulierung von sozialen Netzwerken (Anhörung zwei) das Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Wir fragen bei beiden Verwaltungsbehörden nach und beide bestätigen, es gab Treffen mit Google – initiiert von Google.
Im Gegensatz zu anderen grossen Tech-Firmen bringt sich Google auch direkt in Verbände und Gremien ein. Aschwanden sitzt im Beirat der Stiftung «Fondation CH2048», einer wirtschaftspolitischen Lobbyorganisation. Er ist im Ausschuss «Doing Business in Switzerland» der Swiss-American Chamber of Commerce. Und er sitzt in der Gruppe «Infrastruktur» und «Bildung und Forschung» des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. Dort ist Google Schweiz seit Sommer 2012 Mitglied.
Google Schweiz gehört auch zu den Gründungsmitgliedern von Digital Switzerland, der «relevantesten Dachorganisation der digitalen Schweiz» – und ist gleich mit drei Personen im Vorstand vertreten. Zudem ist Google Mitglied des ICT-Branchenverbands Swico. Dort sitzt Aschwanden im Fachgremium «Regulatory Affairs». Und bei Asut, dem Telekommunikationsverband, vertritt Manuel Altermatt (Enterprise Sales Manager, Google Cloud) die Interessen von Google in der Schweiz.
Die dritte Botschaft, mit der Anton Aschwanden für Google lobbyiert, ist ein kleiner Spagat: Er kann nicht immer verbergen, dass der Google-Konzern gross und mächtig ist. Dann aber wird er nicht müde, zu erwähnen, wie sehr Google seiner gesellschaftlichen Verpflichtung nachkomme.
Botschaft Nr. 3: Google übernimmt Verantwortung
Beispielhaft dafür steht ein Treffen zwischen der Sektion Politische Rechte der Bundeskanzlei und Google im Mai 2019. Die Bundeskanzlei initiierte einen Informationsaustausch «mit Blick auf die Nationalratswahlen 2019». Grund: Wahlkämpfe finden zusehends online statt, was der Bundeskanzlei im Hinblick auf Manipulationen Sorgen bereitet. Anton Aschwanden empfing die Leiterin der Sektion für politische Rechte und ihren Stellvertreter in Zürich.
Aschwanden stellte den Vertretern der Bundeskanzlei mehrere Projekte vor, die aufzeigen sollten, wie stark sich Google bereits gegen Falschinformationen und Wahlbeeinflussung engagierte. Nebenbei erwähnte er, Google unterstütze auch die Arbeit von Pro Juventute im Bereich Medienkompetenz finanziell.
Die Vermarktung von Googles sozialem Engagement hat einen festen Platz in Aschwandens Lobbying. Das zeigen auch Dokumente, die wir vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich einsehen konnten. Eine E-Mail vom April 2021 sticht besonders hervor. Anton Aschwanden meldete sich bei FDP-Politiker Mario Senn, damals stellvertretender Chef und Leiter Stab des Amts für Wirtschaft und Arbeit. In kollegialem Du fragte er, ob sich «Mario» gut im Amt eingearbeitet habe, um dann zwei kostenlose Bildungsangebote von Google anzubieten. Seither ist die regionale Arbeitsvermittlung (RAV) des Kantons Zürich offizieller Partner von Googles Bildungsaktivitäten.
Aschwanden kann auch klare Kante, wenn er es für nötig erachtet. Dann streicht er hervor, wie wichtig Google sei, dass die Schweiz Google brauche. Zwar gibt der Konzern keine Umsatzzahlen bekannt, und auch über die Steuerrechnung in der Schweiz verliert das Unternehmen kein Wort. Das hält Aschwanden in den erwähnten Kommissionsanhörungen jedoch nicht davon ab, die Anwesenden gleich zu Beginn darauf hinzuweisen, dass Google «einer der grössten Arbeitgeber und Steuerzahler der Stadt Zürich» sei: «Von Zürich aus betreiben wir Innovation für Nutzer in der gesamten Welt.» Seine subtile Botschaft: Ihr wollt doch Google nicht verlieren? Wenn es hart auf hart gehe, sagen Politiker hinter vorgehaltener Hand, greife Google auch zum beliebtesten Lobbying-Druckmittel – und drohe mit dem Wegzug aus der Schweiz.
Bei der Beeinflussung der politischen Prozesse kann sich Anton Aschwanden auf die Unterstützung der PR-Agentur Furrerhugi verlassen, zu deren Kunden Google zählt. «Furrerhugi ist meines Erachtens eine der in Bundesbern am besten vernetzten Agenturen», sagt Otto Hostettler von Lobbywatch. Agentur-Mitinhaber Andreas Hugi bestätigt in einem Telefongespräch das Mandat, mehr will er aber nicht sagen. Agenturen wie Furrerhugi seien für Konzerne wie Google ausschlaggebend, erklärt Hostettler: «Ein einzelner Lobbyist von Google kann nie ein solches Netzwerk wie Furrerhugi bieten, kennt die Verhältnisse in Verwaltung und Politik längst nicht so gut und hat nie einen solch direkten Zugang zu Entscheidungsträgern.»
Wie eng Google sowieso schon mit der Verwaltung verbandelt ist, zeigt das Beispiel der Eidgenössischen Kommunikationskommission (Comcom). Vizepräsident der «unabhängigen Konzessions- und Regulierungsbehörde im Fernmeldebereich» ist Christian Martin, der bis im September vergangenen Jahres Managing Director Alpine Region (Switzerland and Austria) bei Google Cloud war. Problematisch? Nein, sagt die Kommission, zwischen den Geschäftsfeldern von Google Schweiz und ihrem Zuständigkeitsbereich gebe es keine Überschneidungen und somit auch keinen Interessenkonflikt. Vergessen geht, dass gerade im Cloud-Business auch diverse von der Eidgenössischen Kommunikationskommission regulierte Unternehmen wie zum Beispiel die Swisscom mitmischen. Kritische Fragen? Keine.
Googles Trumpf: Das Schweizer Gesicht
Während Lobbyist Anton Aschwanden diskret im Hintergrund bleibt und kaum Nichtberufliches über ihn im Netz zu finden ist (ausser, dass er sich im Vorstand des Zürcher Start-ups «Brainforest» für innovative Lösungen zur Erhaltung des Regenwalds einsetzt und seit Jahren am Engadiner Skimarathon mitfährt), tanzt der zweite Mann hinter Googles Schweizer Lobbyingerfolg auf allen möglichen und unmöglichen Hochzeiten.
Hallenstadion, Anfang Mai 2015. «Eine über zweistündige Power-Show mit viel Glamour»: So fasste die «Schweizer Illustrierte» die 6. Energy Fashion Night zusammen. Neben der Schweizer Sport-, Mode- und Cervelatprominenz knipste der anwesende Fotograf der «Schweizer Illustrierten» auch einen Schnappschuss von Patrick Warnking mit seiner Frau Alexandra.
Warnking war bis Ende 2022 Country Director von Google Schweiz. Er übernahm das Schweizer Geschäft 2011 mit etwas mehr als 700 Angestellten. Und verliess seinen Posten mit mehr als 5000 Mitarbeiterinnen. Anfang dieses Jahres wurde Warnking zum Osteuropachef des Google-Konzerns befördert.
Warnking ist bestens vernetzt in der Schweizer Wirtschaft, unter anderem als Verwaltungsrat bei den Axa-Versicherungen. Er pflegt in der Öffentlichkeit das Bild des engagierten, umtriebigen Chefs, der sich immer wieder gerne an illustren Veranstaltungen wie Galas der «Schweizer Illustrierten», am Zurich Film Festival oder dem Intellektuellen-Treff «World.Minds» blicken lässt. Auch am World Web Forum 2017 war er dabei.
Öffentlichkeitsscheu ist Patrick Warnking also keineswegs. Doch als wir bei der Medienstelle um ein Interview anfragen, heisst es, sein Terminkalender sei voll und er sei sehr wählerisch, mit wem er spreche. Er äussere sich so oder so nur selten in der Öffentlichkeit. Ein Blick in die Mediendatenbank fördert dann allerdings einige Interviews zutage.
Warnking lernte, die Öffentlichkeit zu lieben, und diese erwidert die Liebe. Kritische Stimmen und Berichte über den Google-Direktor finden wir keine. Dafür ein Haufen Boulevardstorys und Interviews mit dankbaren Fragen.
Darin hielt Warnking Lobreden auf den öffentlichen Verkehr im Speziellen oder die Schweiz im Allgemeinen und plauderte darüber, was Google alles gut mache, wie viele Veloparkplätze Google habe, wie Google lebenslanges Lernen fördere. Eben erst im Dezember verteilte Warnking am Paradeplatz Suppe für die Stiftung «Schweizer Tafel», die Lebensmittel für Bedürftige verteilt. Google übernahm überdies den Abwasch in der firmeneigenen Küche.
Hinter Warnkings Auftritten steckt mehr Strategie als blosse Geselligkeit oder soziales Engagement: Der Zürcher Tech-Unternehmer Dorian Selz beschreibt Patrick Warnking als gewieften Kommunikator, der die Schweiz und ihre politischen und wirtschaftlichen Eigenheiten analysiert hat. Warnking habe verstanden, dass es vermehrte Präsenz in der Öffentlichkeit brauche, um dem negativen Image von Google etwas entgegenzusetzen.
Diese Strategie setzte Warnking dann beispielsweise als Schweizer Gesicht von Google am Event eines Lokalradios um – und Anton Aschwanden in der Wandelhalle des Bundeshauses.
Gemeinsam umgarnten die beiden Google-Lobbyisten Politik und Öffentlichkeit mit Fachwissen, Engagement und Boulevardgeschichten. Gleichzeitig vermieden sie kritische Fragen und behaupteten das eigene Schwergewicht. Und schufen so ein Google, über das fast niemand etwas Schlechtes sagen kann. Oder will. Wo aber verläuft die Grenze zu unkritischer Liebesdienerei?
Bei der Eröffnung der Google-Büros an der Zürcher Europaallee im Jahr 2017 sinnierte der damalige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann über die Liebe zwischen Google und der Schweiz. Eine gute Beziehung, sagte der Bundesrat, hänge immer davon ab, «ob zwei Charaktere zueinanderpassen – und ob sie bereit sind, auf dem gemeinsamen Weg zu investieren. Beides ist hier offensichtlich der Fall.»
Der unkritische Umgang der Schweiz mit Google zeigt sich exemplarisch in der Beziehung zur Wettbewerbskommission (Weko). Als wir der Weko einen Fragebogen zu ihrer Strategie im Umgang mit Google zustellen, erhalten wir erstaunliche Antworten. Die Behörde gibt freimütig preis, dass man sich «regelmässig» mit Google über «wettbewerbsrechtliche Entscheide im Ausland» austausche. Es gebe eine Absichtserklärung von Google, «ausländische Verpflichtungszusagen möglichst auch auf die Schweiz anzuwenden».
Diese Erklärung dürfte Google leicht von der Hand gehen, denn im Gegenzug drohen Google bei Verstössen gegen das Schweizer Wettbewerbsrecht keine Bussen. So geschehen beim Fall von Google Shopping, als Google von der EU zu Strafzahlungen in der Höhe von 2,4 Milliarden Euro wegen Marktbeherrschung verurteilt wurde. Die Schweizer Wettbewerbskommission traf dazu Vorabklärungen, worauf Google sich bereit erklärte, die Anpassungen seines Geschäfts in der EU auch in der Schweiz umzusetzen. Eine Busse gegen Google wurde in der Schweiz jedoch nicht ausgesprochen. Die Weko begründete dies mit fehlenden Ressourcen. Zudem sei der Zweck der Weko «die Sicherstellung von Wettbewerb und nicht die Bestrafung».
Während sich Google in Kanada und anderswo kritische Fragen zur dystopischen Dimension seiner Geschäfte gefallen lassen muss, wird dem Konzern in der Schweiz seit zwanzig Jahren der rote Teppich ausgerollt. Es ist wie mit den Banken in den 1990ern: Man schaut weg, will keine Details wissen. Global hat der Wind jedoch gedreht: Während es in der Schweiz still bleibt, wird in der EU an einer Achse Brüssel–Washington gearbeitet, um Google zu zerschlagen.
Von diesem rauen Gegenwind bleibt Google im Nicht-EU-Land Schweiz verschont. Bei der Internetregulierung verharrt die Schweiz im ewigen Beobachterstatus, sanktioniert nicht und übernimmt autonom nur gerade das, was sie muss, von der EU. Hier hat Google keine Millionenbussen zu erwarten. Auch das gehört zu dieser Liebesgeschichte. Die Schweiz mit ihrem Alleingang ausserhalb der EU ist ein perfekter Standort für den mächtigen Konzern, und Googles Lobbying stellt sicher, dass das auch weiterhin so bleibt.
Zur Transparenz: Der im Beitrag zitierte Hannes Gassert ist der Ehemann von Sylvie Reinhard, Verwaltungsratspräsidentin der Republik AG.
In einer früheren Version des Beitrags haben wir geschrieben, dass die Anhörung zum «Einfluss von Digitalplattformen auf die Demokratie» in der Rechtskommission des Nationalrats stattgefunden habe. Doch es handelte sich um die Staatspolitische Kommission. Wir haben das angepasst und entschuldigen uns für den Fehler.
Zur Serie «Do not feed the Google» und zu den Autoren
Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem Dezentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv.
Reto Naegeli arbeitet beim WAV-Recherchekollektiv zu Projekten rund um Konzernverantwortung, Menschenrechte und Migration. Balz Oertli arbeitete in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen als Journalist beim SRF. Seit diesem Jahr arbeitet er vollständig beim WAV. Diese Recherche wurde von der Republik finanziert. Zusätzliche Unterstützung erhielten die WAV-Autoren von Investigativ.ch und Journafonds.