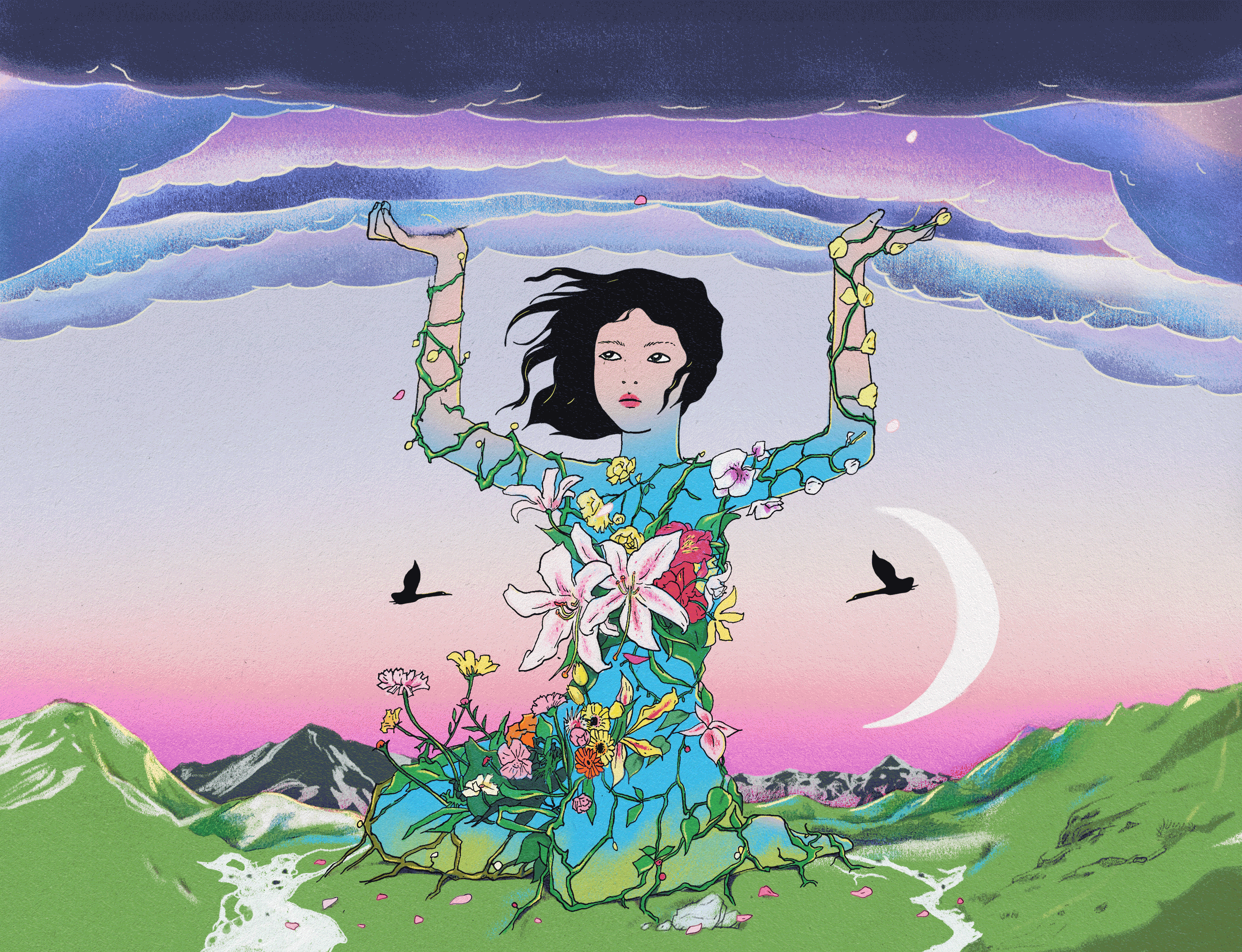
Wie wir die Ozonschicht repariert haben
Die grösste ökologische Erfolgsgeschichte der Menschheit wird leider viel zu selten erzählt. Was lernen wir daraus für die Klimakrise?
Von Hannah Ritchie (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Qianhui Yu (Illustration), 23.01.2023
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Blicken wir in der Geschichte der Ökologie zurück, gibt es nicht viele Erfolgsmeldungen, aus denen wir etwas lernen können. In manchen Bereichen des menschlichen Lebens gab es in den vergangenen Jahrzehnten massive Fortschritte: Die extreme Armut geht zurück, die Kindersterblichkeit sinkt, die Lebenserwartung steigt. Beim Schutz der Umwelt dagegen entwickeln sich die meisten Kennzahlen in die falsche Richtung. Auf lokaler und nationaler Ebene ist zwar der eine oder andere Erfolg zu verzeichnen – wie zum Beispiel die deutliche Reduzierung der Luftverschmutzung in reichen Ländern. Aber global gibt es so gut wie keine Fortschritte.
Eine Ausnahme gibt es allerdings: die Ozonschicht. Dass die Menschheit in der Lage war, die ausgedünnte Ozonschicht zu retten, ist nicht nur unsere grösste ökologische Erfolgsstory, sondern in der Geschichte überhaupt das eindrücklichste Beispiel dafür, wie man Probleme durch internationale Kooperation lösen kann.
Wie wir erkannt haben, dass es ein Problem gibt
Zunächst etwas Ozon-Grundwissen: Ozon (O3) ist in der Erdatmosphäre in mehreren Schichten anzutreffen. Je nachdem, in welchem Teil der Atmosphäre es sich befindet, wird es als «schlechtes» oder als «gutes» Ozon bezeichnet. Ein Teil des Ozons entsteht am Boden durch Reaktionen mit Luftschadstoffen, die durch Autoabgase, Industrieprozesse und chemische Lösungsmittel freigesetzt werden. Das ist das sogenannte schlechte Ozon, das vor allem bei Jungen, bei Alten oder bei Menschen mit Atembeschwerden zu Gesundheitsschäden führen kann. Es kann Schmerzen in der Brust, Atemprobleme, Atemwegsentzündungen und langfristige Schädigungen des Lungengewebes verursachen. Ozon einzuatmen, ist nicht ratsam.
Ozon gibt es aber auch sehr weit oben in der Atmosphäre – rund 15 bis 35 Kilometer über dem Boden, in der Stratosphäre. Dort findet sich das sogenannte gute Ozon. Molekular sind das gute und das schlechte Ozon identisch, aber das gute Ozon spielt, weil es sich in der Stratosphäre befindet, eine entscheidende Rolle bei der Absorption der schädlichen ultravioletten Strahlung (UV-B) der Sonne. Die Schutzschicht aus Ozon bewahrt die Menschen vor Hautkrebs, Sonnenbrand und Erblindung und ist auch für den Schutz anderer Lebensformen äusserst wichtig. Das bedeutet: Das bodennahe Ozon wollen wir abbauen, das Ozon in der Stratosphäre auf keinen Fall.
Ein neuer Expertenbericht im Auftrag der Uno, der USA und der EU geht davon aus, dass sich die Ozonschicht in den kommenden Jahrzehnten vollständig erholen wird. Die im Protokoll von Montreal 1987 beschlossenen Massnahmen zeigten die gewünschte Wirkung.
Dieser Artikel erschien erstmals im Mai 2021 unter dem Titel «How We Fixed the Ozone Layer» bei «Works in Progress». Die Autorin analysiert, wie es nach der Entdeckung des Ozonlochs gelang, rasch weitreichende Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht auf den Weg zu bringen. Eine Geschichte mit zahlreichen Parallelen zu heutigen Herausforderungen der Klimakrise – und einigen interessanten Unterschieden.
Der 2021 verstorbene niederländische Atmosphärenchemiker Paul Crutzen äusserte als Erster die Befürchtung, dass sich die Chemie der Stratosphäre durch die Einwirkung des Menschen verändere. In den 1960er-Jahren gewannen Forscherinnen erste Erkenntnisse darüber, welche Reaktionen die Fotochemie der oberen Atmosphärenschichten regeln. Damals arbeiteten viele Wissenschaftler mit Modellen, die die Wechselwirkungen zwischen OH-Radikalen und Ozonmolekülen in den Mittelpunkt rückten.
Crutzen überzeugten diese Modelle nicht. Die hohen Ozonkonzentrationen in der oberen Stratosphäre liessen sich aus seiner Sicht durch diese Reaktionen allein nicht erklären. Er vermutete, dass weitere Faktoren eine Rolle spielten; dass sich in der Stratosphäre noch andere Wechselwirkungen zwischen chemischen Stoffen wie Stickstoffverbindungen und dem Sonnenlicht abspielten. Leider konnte er seine Vermutung nicht belegen, weil es damals noch nicht möglich war, die Stickstoffkonzentration in der Stratosphäre zu messen.
Ein Jahr später bekam er endlich die Daten, die er brauchte. Forscher hatten mithilfe von Höhenforschungsballons das Sonnenspektrum untersucht und eine Möglichkeit gefunden, die Dichte von Stickstoffverbindungen (HNO3) in der Stratosphäre zu messen. Crutzen stellte nicht nur fest, dass Stickstoff in der Stratosphäre mit dem Ozon reagieren konnte. Er fand auch heraus, dass durch den Menschen emittierte Stickstoffverbindungen diese Reaktionen beeinflussen können. Stickoxide (N2O) produzierte der Mensch auf vielfältige Weise – mit Düngemitteln, Raketentriebwerken und Verbrennungsmotoren. Die dabei entstehenden Emissionen konnten in die Stratosphäre gelangen, mit dem Ozon (O3) reagieren und bewirken, dass dieses Ozon zu Sauerstoff (O2) zerfällt. Die UV-Strahlung begünstigte die Reaktion dabei ideal.
Die grösste Sorge bereitete Crutzen die damals geplante Flotte grosser Überschallflugzeuge, die in stratosphärischen Höhen verkehren sollten. Er befürchtete, diese würden durch ihren Ausstoss von Stickstoff die Ozonschicht massiv schädigen. Während andere Forscher davon ausgingen, dass die Überschallflugzeuge nur geringe fotochemische Auswirkungen auf das Ozon hätten, bahnte sich aus seiner Sicht ein ernstes ökologisches Problem an. Crutzen war sichtlich frustriert, als auf einer Konferenz andere Wissenschaftler seine Bedenken abtaten: «Ich schrieb an den Rand ihres Papers: Idioten!»
Nur wenige Jahre später äusserten die Wissenschaftler Frank Sherwood Rowland und Mario Molina die Vermutung, dass vom Menschen emittierte Chlorverbindungen möglicherweise genau die gleiche Wirkung hätten. Diese Verbindungen – am bekanntesten sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) – kamen in Kühl- und Eisschränken, Klimaanlagen und Spraydosen und in der Industrieproduktion ausgiebig zum Einsatz. Durch Messungen der Chlormolekülkonzentration in den unteren Schichten der Atmosphäre stellten Rowland und Molina fest, dass die Chlorverbindungen nicht zerfielen: Ihre Menge in der Atmosphäre war nahezu identisch mit der bis dahin erzeugten Gesamtmenge. Die chemische Reaktionsträgheit, die sie für die Technologie so attraktiv machte, hinderte die Chlorverbindungen daran, sich in der unteren Atmosphäre zu zersetzen.
Rowland und Molina entwickelten ein Modell der möglichen Quellen und Senken dieser Verbindungen, um herauszufinden, wohin sie verschwinden. Sie stellten fest, dass sich die einzige mögliche Senke in der Stratosphäre befand. Dort konnte die UV-Strahlung die Chloratome abspalten, sodass diese mit dem Ozon reagieren und es zersetzen konnten. Es mehrten sich die Beweise, dass die Menschheit dabei war, durch den Einsatz dieser Schadstoffe die Ozonschicht auszudünnen.
Es überrascht nicht, dass viele Akteure aus der Industrie versuchten, die Arbeit der Wissenschaftler in Misskredit zu bringen. Da noch keine experimentellen Beweise vorlagen, konnten sie die Warnungen einfach als reine Spekulation abtun. Der Vorstandsvorsitzende des weltgrössten FCKW-Produzenten Dupont bezeichnete die Theorie als «Science-Fiction-Geschichte … einen Haufen Müll … absoluten Unsinn». Um ihre Aktivitäten zu koordinieren, schlossen die führenden Hersteller sich zu einer «Allianz für eine verantwortungsvolle FCKW-Politik» (Alliance for Responsible Cfc Policy) zusammen. Sie starteten gross angelegte PR-Kampagnen, welche die Theorie der Ozonausdünnung in Verruf bringen sollten.
Erst spät wurde Crutzen, Rowland und Molina doch noch die Anerkennung zuteil, die sie verdienten: 1995 erhielten sie für ihre Arbeit den Nobelpreis für Chemie.
Das erfolgreichste internationale Abkommen überhaupt
In der Wissenschaft bildete sich relativ schnell ein Konsens über das Problem der Ozonausdünnung. 1974 traten Rowland und Molina mit ihrer Hypothese zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. 1976 bestätigte die US-Akademie der Wissenschaften in einem Bericht, dass die wissenschaftliche Beweislage klar für die Richtigkeit dieser Hypothese sprach. Ab 1979 beobachtete die Nasa mit einem Instrument namens TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) die Ozonkonzentration in der Stratosphäre und stellte fest, dass sie von Jahr zu Jahr zurückging.
Doch die Politik hinkte der wissenschaftlichen Forschung hinterher. 1978 verboten mehrere Länder – die USA, Kanada und Norwegen – lediglich die Verwendung von FCKW als Treibmittel in Spraydosen. Und das erst, nachdem viele Verbraucherinnen bereits von sich aus auf FCKW-haltige Sprays verzichtet hatten. Diese minimalen Veränderungen reichten hinten und vorne nicht aus. Über viele Jahre bewegte sich nichts, weil Branchenriesen wie Dupont massiven Widerstand leisteten und auch die Reagan-Regierung in den USA sich gegen Umweltauflagen positionierte. Anne Gorsuch, die erste Chefin der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA, tat die Sorge über den Abbau der Ozonschicht als Umwelthysterie ab.
Mitte der 1980er-Jahre änderte sich die Lage rasch. Dafür gab es wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche Gründe. Die Nasa konnte den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht inzwischen mit über mehrere Jahre erhobenen Daten belegen. In einem ausführlichen Bericht präsentierte sie 1985 die wissenschaftlichen Belege für die Veränderung der Ozonschicht durch den Menschen.
Der grösste wissenschaftliche Gamechanger war allerdings die Entdeckung des Ozonlochs über der Antarktis. Es schien aus dem Nichts zu kommen. Seit Jahren hatten Forscher in Bodenstationen in der Antarktis Langzeit-Datenreihen gesammelt. 1981 gab es erste kleine Hinweise, aber 1983 bot sich ein klares Bild.
J. C. Farman, B. G. Gardiner und J. D. Shanklin, die im Rahmen des britischen Polarforschungsprogramms British Antarctic Survey am Südpol waren, veröffentlichten ihre Erkenntnisse erst 1985 im Fachmagazin «Nature». Die späte Publikation hatte ihren Grund: Die Erkenntnisse waren so unerwartet und die Implikationen so weitreichend, dass die Forscher unbedingt ausschliessen mussten, dass ein Messfehler vorlag. Die Bilder des grösser werdenden Ozonlochs setzten die Staaten und die Industrie unter Druck, zu handeln.
Politisch hätte das Timing dieser Erkenntnis besser nicht sein können. Eben hatte William Ruckelshaus als Nachfolger von Anne Gorsuch den Chefposten der US-Umweltschutzbehörde EPA übernommen. Ihn beunruhigte das Ozonproblem bereits sehr viel stärker, und wegen der zunehmenden Besorgnis der Öffentlichkeit angesichts des entdeckten Ozonlochs konnte er wirksamer darauf drängen, dass in den USA und international gehandelt wurde.
Als führende Industrienation waren die Vereinigten Staaten prädestiniert für die Vorreiterrolle bei den internationalen Bemühungen. 1985 wurde das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht aus der Taufe gehoben: Zwanzig Länder – darunter die meisten grossen FCKW-Produzenten – kamen überein, sich bei der Regulierung der ozonschädigenden Stoffe international zu koordinieren. Die Schweiz gehörte zu den Erstunterzeichnern.
Auch bei einigen Branchenakteuren kam es zu einem raschen Umdenken. Die FCKW-Patente von Dupont waren inzwischen ausgelaufen. In Erwartung einer strikten Regulierung schaltete der Konzern kurzerhand um und machte aus der Risikosituation eine Chance. Dupont erklärte, chemisch stehe dem Umstieg auf sicherere Alternativen nichts im Wege, aber es gebe sehr wohl preisliche Hindernisse. Man könne innerhalb weniger Jahre Alternativen entwickeln, sofern es dafür entsprechende regulatorische und marktwirtschaftliche Anreize gebe. Der Konzern hatte es auf den Erstanbietervorteil abgesehen.
1987 handelten die Unterzeichnerstaaten der Wiener Konvention ihr erstes Protokoll aus: das Protokoll von Montreal. Darin verpflichteten 43 Staaten sich dazu, ozonschädigende Stoffe ab 1989 schrittweise zu verbieten. Dieser ersten Gruppe gehörten mehrheitlich reichere Länder an, die damals die meisten FCKW produzierten: USA, Kanada, Japan, die meisten europäischen Staaten inklusive der Schweiz und Neuseeland. Ihr Ziel: Sie wollten bis 1999 die weltweite Produktion dieser Substanzen gegenüber dem Niveau von 1986 halbieren. Eines wird allerdings oft übersehen: Das erste Protokoll von Montreal wäre absolut unzureichend gewesen, um das Problem zu lösen. Das Reduktionsziel war zu niedrig angesetzt und die Liste der Stoffe, die verboten werden sollten, unvollständig. Hätten wir an dieser Zielvorgabe festgehalten, wäre das Loch in der Ozonschicht weitergewachsen.
Der Erfolg der Wiener Konvention lag darin, dass sie mit der Zeit immer ambitionierter wurde. Die Regeln wurden nachgeschärft, nachdem weitere Beweise für die Ausdünnung der Ozonschicht und die schädliche Rolle der dafür verantwortlichen Gase auf den Tisch gekommen waren. Die Deadline für den schrittweisen Ausstieg aus der Herstellung ozonschädigender Gase wurde immer weiter vorgezogen. Weitere Länder schlossen sich an. Bis zur Jahrtausendwende wuchs der Kreis der Unterzeichner auf 174. 2009 wurde die Wiener Konvention als erster Vertrag überhaupt weltweit ratifiziert.
Der Erfolg dieser internationalen Bemühungen war wahrhaft überwältigend. Bevor 1989 das erste Protokoll in Kraft trat, hatte der Einsatz ozonschädigender Stoffe immer weiter zugenommen. Der anschliessende schrittweise Ausstieg vollzog sich in hohem Tempo. Innerhalb eines Jahres sank der Verbrauch auf ein Niveau, das 25 Prozent unter dem von 1986 lag. Innerhalb eines Jahrzehnts betrug der Rückgang fast 80 Prozent (und ging damit weit über das ursprüngliche 50-Prozent-Reduktionsziel des Protokolls von Montreal hinaus). Inzwischen ist der Einsatz dieser Stoffe gegenüber 1986 um 99,7 Prozent gesunken.
Rapider Rückgang gegen null
Weltweiter Einsatz ozonschädigender Stoffe, relativ zur Menge im Jahr 1986
European Environment Agency (EEA) via Our World in Data.
Mit wenigen bewilligten Ausnahmen sind wir aus dem Einsatz dieser Stoffe komplett ausgestiegen. Viele Unternehmen haben sie durch weniger schädliche Alternativen wie Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) ersetzt. Das Problem bei einigen ozonschädigenden Stoffen war, dass sie Chlor oder Brom enthielten. Diese reaktionsfreudigen Elemente können dem Ozon (O3) ein Sauerstoffatom «stehlen» und ClO oder BrO bilden, die den Zerfall von Ozon bewirken. Da FKW weder Chlor noch Brom enthalten, können sie dem Ozon nichts anhaben. Allerdings haben FKW den Nachteil, dass sie als potente Treibhausgase den Klimawandel befördern.
Erholt sich das Ozonloch?
Auch wenn die weltweite Antwort auf die Ausdünnung der Ozonschicht schnell erfolgte: Um sich zu erholen, wird die Ozonschicht sehr viel länger brauchen. Doch eine vollständige Erholung ist möglich. Das wissen wir, weil wir inzwischen die Ozonkonzentrationswerte in der Stratosphäre messen können. Die Nasa überwacht schon seit den späten 1970er-Jahren im Rahmen ihres Programms Ozone Watch die Ozonkonzentration und die Grösse des Ozonlochs.
Die Ozonkonzentration wird in sogenannten Dobson-Einheiten gemessen (Dobson units, DU). Eine Dobson-Einheit ist die Anzahl der Ozonmoleküle, die man braucht, um bei bestimmten Temperatur- und Druckverhältnissen eine 0,01 Millimeter dicke Ozonschicht zu erzeugen. Im Bereich von 100 DU oder weniger sprechen wir von einem «Ozonloch».
In den späten 1970er- und in den 1980er-Jahren sank die Ozonkonzentration in der Stratosphäre rapide. Sie wurde innerhalb von zehn Jahren halbiert und geriet in die Gefahrenzone unter 100 DU. Die Ozonschicht, die uns vor den Gefahren der UV-B-Strahlung geschützt hatte, begann sich aufzulösen. Doch unsere globalen Anstrengungen zeigten Erfolge. Durch die rapide Senkung unseres Ausstosses konnten wir die Ozonkonzentration stabilisieren. Wir haben aufgehört, der Stratosphäre dieses wertvolle Gas zu entziehen.
Über dem kritischen Wert stabilisiert
Mittlere tägliche Ozonkonzentration in der Stratosphäre der südlichen Hemisphäre
Und wie hat sich das auf die Grösse des Ozonlochs ausgewirkt? Da diese Auswirkungen erst mit einer gewissen Verzögerung sichtbar werden, war in den gesamten 1980er-Jahren zu beobachten, wie das Loch über der Antarktis grösser wurde. Ende der 1990er-Jahre hatte es eine Ausdehnung von 30 Millionen Quadratkilometern – dreimal so gross wie die USA. Doch irgendwann wurde sichtbar, dass unsere Bemühungen Wirkung zeigten. Seit den späten 1990er-Jahren stabilisiert sich die Grösse des Ozonlochs. 2018 veröffentlichte die Nasa-Mission «Aura» ihre ersten Ergebnisse, die deutliche erste Anzeichen einer Erholung erkennen liessen.
Um sich von den in Jahrzehnten entstandenen Schäden zu erholen, wird die Ozonschicht noch eine Weile brauchen. Bis die Ozonkonzentration weltweit wieder das Niveau von 1960 erreicht, wird es wohl bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts dauern. In der Antarktis, wo die Ozonschicht wegen der tiefen Temperaturen besonders stark gelitten hat, dürfte sich der Erholungsprozess sehr viel länger hinziehen. Dort werden wir womöglich bis zum Ende des Jahrhunderts warten müssen. Solange wir an unserem Ausstieg aus dem Einsatz ozonschädigender Stoffe festhalten, können wir aber davon ausgehen, dass die Situation sich immer weiter verbessern wird. Auch wenn wir eine Weile warten müssen: Das Warten lohnt sich.
Das Loch schrumpft, langsam
Grösse des Ozonlochs über der Antarktis (jährliches Maximum und Mittel)
Bei der Bewältigung anderer ökologischer Probleme sind wir nicht ganz so erfolgreich. Können wir die eine oder andere Erkenntnis, die wir aus der Rettung der Ozonschicht gewonnen haben, auf andere Herausforderungen wie den Klimawandel übertragen?
Es gibt eine Reihe von offensichtlichen Parallelen: Sowohl der Abbau der Ozonschicht als auch der Klimawandel sind Probleme, die die Welt gemeinsam meistern muss. Anders als die Luftverschmutzung, bei der die örtliche Bevölkerung unter örtlichen Emissionen zu leiden hat, leidet unter den ozonschädigenden Stoffen und Treibhausgasemissionen die gesamte Weltbevölkerung, weil diese Gase sich einfach über den Globus verteilen; darum heissen sie auch well-mixed gases. Und: In beiden Fällen liegt auf der Hand, dass es ohne internationale Koordination nicht geht.
Die Tatsache, dass bei der Rettung der Ozonschicht die Bemühungen im Lauf der Zeit intensiviert wurden, kann uns ebenfalls eine Lehre sein. Das erste Protokoll von Montreal aus den 1980er-Jahren war bei weitem nicht ambitioniert genug, um das Problem in den Griff zu bekommen. Es war zwar immerhin besser als business as usual, aber mit dem darin formulierten Reduktionsziel wäre das Ozonloch weitergewachsen.
Unsere Bemühungen waren nur deshalb erfolgreich, weil wir die Regulierungsstandards mit der Zeit immer weiter angehoben haben. Die Klimapolitik ist heute in einer ähnlichen Situation – und das schon seit langem. Mit dem, was die Länder bisher zugesagt haben, steuern wir auf eine Erwärmung von 2,6 bis 2,9 Grad Celsius bis 2100 zu und sind damit weit entfernt vom Ziel der Vereinten Nationen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir mehr Ehrgeiz entwickeln – und zwar schnell.
Es gibt zwischen den beiden Problemen allerdings auch wichtige Unterschiede. Beide sind zwar globale Herausforderungen, aber ihre Auswirkungen machen sich nicht überall auf der Welt in gleichem Masse bemerkbar.
Die Ausdünnung der Ozonschicht ist in höheren Breitengraden gravierender, weil die Luft dort kälter ist. Das ist einer der Gründe, warum Ozonlöcher sich gerade über der Antarktis und der Arktis bilden. Die reicheren Länder in Europa und Nordamerika sind vom Ozonabbau nicht nur in stärkerem Masse betroffen, sondern ihre Bevölkerung ist wegen ihrer Hautfarbe auch anfälliger für Gefahren wie Hautkrebs. Darum hatten die weltgrössten Produktionsländer ozonschädigender Stoffe eine starke Motivation, tätig zu werden.
Ein Leitartikel in der «New York Times» warnte 1986 für die kommenden Jahrzehnte vor Millionen von zusätzlichen Hautkrebsfällen infolge des Ozonabbaus. Die Tatsache, dass die grössten Produzenten am meisten zu verlieren hatten, wirkte vermutlich beschleunigend auf ihre Bemühungen um eine Problemlösung.
Beim Klimawandel liegen die Dinge anders: Diejenigen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind, zählen in der Regel zu den Ärmsten der Welt und haben nicht die Ressourcen, um sich auf diese Auswirkungen einzustellen. Am meisten darunter leiden ausgerechnet diejenigen, die am wenigsten zum Treibhausgasausstoss beitragen.
Ein weiterer grosser Unterschied zwischen der Schädigung der Ozonschicht und dem Klimawandel: Die Ozonausdünnung war ein branchenspezifisches Problem, während der Klimawandel das gesamte Wirtschaftssystem betrifft. Ersatzlösungen für die Substanzen in unseren Kühlmitteln und Spraydosen zu finden, war viel leichter, als unsere gesamte Volkswirtschaft umzumodeln. Wir brauchten nicht aufzuhören, unsere Lebensmittel zu kühlen oder Deodorant zu versprühen. Wir mussten nur eine Möglichkeit finden, dies auf eine andere Weise zu tun.
Doch unser Leben, die Industrie, der Verkehr, Stromquellen und Lebensmittelsysteme basieren allesamt auf CO2-emittierenden Brennstoffen. Viele dieser Infrastruktursysteme haben eine jahrzehntelange Lebensdauer. Unser Reiseverhalten, die Lebensmittelproduktion oder die Energiegewinnung komplett umzustellen, gelingt nicht über Nacht.
Die gute Nachricht ist, dass kohlenstoffarme Energieträger derzeit deutlich billiger werden und es dadurch leichter werden dürfte, diese Energieträger zur Standardoption zu machen. Doch die Systeme neu zu gestalten, die das Fundament für Volkswirtschaften in der ganzen Welt bilden, wird mit Sicherheit keine so leichte Übung, wie die Gase auszuwechseln, die in unseren Kühlschränken zum Einsatz kommen.
Auch wenn uns die Bewältigung des Klimawandels vor grössere Schwierigkeiten stellen wird, lassen sich aus der Ozon-Erfolgsgeschichte wichtige Lehren ziehen. Wir sind fähig, reale globale Probleme in den Griff zu bekommen. Wir können jedes Land in diesen Prozess einbeziehen. Und wir sind, wenn die Zeit knapp wird, zu schnellem Handeln in der Lage.
Dass wir nur noch selten über die Ozonschicht reden, ist vielleicht ein Beleg dafür, dass wir sie erfolgreich gerettet haben. Aber wir sollten uns auf unsere Fähigkeit besinnen, bei der Bewältigung solcher globalen Probleme an einem Strang zu ziehen. Das ist der Grund, warum es Sinn ergibt, immer wieder auf die Geschichte vom Ozonloch zurückzukommen und sie immer wieder aufleben zu lassen.
In einer früheren Version stand, dass UV-Strahlung als Katalysator fungiert. Wir haben die Stelle korrigiert. Vielen Dank für den Hinweis im Dialog.
Hannah Ritchie ist im Führungsteam von «Our World in Data», nachdem sie dort lange das Forschungsteam geleitet hat. Ritchie hat den Doktortitel in Atmosphären- und Erdwissenschaften, als Autorin schreibt sie über Themen wie Landwirtschaft, Energie und Umwelt.