
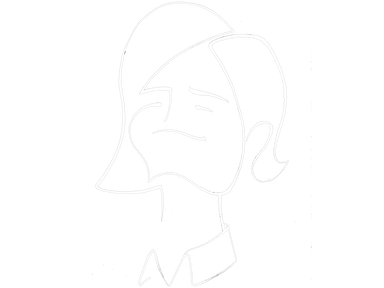
Warum es ein Frauenticket sein muss
Die Ersatzwahl für den SP-Sitz im Bundesrat schlägt Wellen, inklusive Diskussionen über Diskriminierung. Doch es geht hier um Gleichstellungspolitik. Was die Sache relativ simpel macht.
Von Daniel Binswanger, 12.11.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Was zum Teufel ist in Daniel Jositsch gefahren? Eigentlich hat sich die Frage ja schon fast erledigt. Der Zürcher Ständerat, der «aus Prinzip» gegen den «diskriminierenden» Ausschluss von Männern vom Bundesratskandidatinnen-Ticket der SP-Fraktion rebellieren will und der sich gegen den Wunsch der Parteileitung nun um seine Aufstellung bewirbt, dürfte chancenlos bleiben.
Dennoch lohnt es sich, dieses bizarre Kandidatur-Gerangel etwas genauer zu betrachten: Es zeugt nicht nur von den Hürden, mit denen Gleichstellungspolitik immer wieder zu kämpfen hat. Sondern auch von ihrer zentralen politischen Relevanz.
Jositsch selber möchte seine Kandidatur als ethisches Grundsatzstatement verstanden wissen, was an sich schon schmunzeln lässt. Hier will ein zweifelsohne sehr fähiger, sehr engagierter und sehr ehrgeiziger Karrierepolitiker nach dem höchsten Staatsamt greifen – und es soll ihm dabei «ums Prinzip» gehen? Seine Ankündigungs-Pressekonferenz war hart an der Grenze zur unfreiwilligen Komik.
Natürlich kann man verstehen, dass es für Jositsch extrem kränkend, ärgerlich, frustrierend ist, dass ihm – der nach Aussage verschiedener Fraktionskolleginnen seit Jahren konsequent auf eine Bundesratskandidatur hinarbeitet – die Krönung seiner Karriere nun verwehrt bleiben soll. Und all dies nur, weil er unter den aktuellen Umständen das falsche Geschlecht hat.
Allerdings wird er weder der erste noch der letzte Aspirant sein, dem dieses ach so bittere Schicksal widerfährt. Das Schweizer Regierungssystem ist ein grosser Schüttelbecher der Verhinderungsstrategien, Parteikalküle, halbschönen bis schäbigen Privatagenden und Rücksichten auf Geschlecht, Landesteilzugehörigkeit, Kantonsherkunft, Ratszugehörigkeit: ein einziger Elefantenfriedhof der tödlich frustrierten Talente. Dass Jositsch nun quasi vorgibt, diesen «inakzeptablen» Missstand gerade erst zu entdecken, wirkt bestenfalls belustigend.
Natürlich hat er recht, wenn er feststellt, dass sein Ausschluss vom Ticket eine Diskriminierung darstellen würde. Auch positive Diskriminierung ist Diskriminierung. Jede Quotenregelung führt zu Geschlechterdiskriminierung: Darin liegt ihr Sinn. Und natürlich würden wir alle viel lieber in einer Welt leben, in der die Gleichstellung verwirklicht ist und die Geschlechterfrage in der Personalpolitik deshalb überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass wir in dieser Welt noch nicht angekommen sind, müsste sich in der SP-Bundeshausfraktion aber eigentlich herumgesprochen haben.
Jedenfalls wurde mit der letzten Aktienrechtsrevision unter Federführung von Simonetta Sommaruga eine Quote für Verwaltungsräte (30 Prozent) und Geschäftsleitungen (20 Prozent) eingeführt, deren Nichteinhaltung im Vergütungsbericht begründet werden muss, inklusive obligatorischer Massnahmen zur Verbesserung. Aktiv unterstützt wurde diese hart umkämpfte Quotenregelung schliesslich auch von einem gewissen Ständerat Jositsch.
Will er nun allen Ernstes der Mann sein, der in der Landesregierung die Quote unter die 30 Prozent drückt, die künftig für Verwaltungsräte gefordert werden? Der Jusprofessor, der eben noch bei der Aktienrechtsrevision mitmachte, behauptet jetzt sogar, eine Beschränkung auf nur weibliche Kandidatinnen sei «fast schon verfassungswidrig». Keine rechtswissenschaftliche Sternstunde.
Doch letztlich geht es hier nicht um eine Grundsatzdebatte über die Legitimität von positiver Diskriminierung und auch nicht um die grenzwertige Fallhöhe zwischen hochtrabender Rhetorik und persönlicher Agenda. Schliesslich werden auch die weiblichen SP-Kandidatinnen sich nicht nur vom Dienst an der Sache, sondern auch von ihrem Ehrgeiz leiten lassen. Um auszusprechen, was eigentlich selbstverständlich sein müsste: Es geht hier um Politik, nämlich darum, welche Kandidatinnen-Wahl der SP politisch nützen und welche ihr politisch schaden wird. Und auf dieser Ebene ergibt eine Jositsch-Kandidatur rein gar keinen Sinn.
Die wohl wichtigste gesellschaftliche Dynamik der letzten Jahre, von der die SP profitieren konnte, war die Forderung nach verbesserter Gleichstellung. Ganz massiv hat sie sich gezeigt beim Frauenstreik 2019, der von der gewerkschaftlichen Linken angeführt wurde. Niedergeschlagen hat sie sich auch in den nationalen Wahlen 2019, bei denen im linken Lager und in etwas geringerem Masse bei der GLP besonders weibliche Kandidatinnen erfolgreich waren. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass diese Dynamik inzwischen abgeflaut ist, sehr im Gegenteil.
Vor nicht einmal zwei Monaten wäre es der Linken um ein Haar gelungen, die AHV-Reform zu kippen – und zwar ausschliesslich, weil die Erhöhung des Frauenrentenalters auf erbitterten Widerstand stiess. Der Geschlechtergraben im Abstimmungsverhalten war rekordverdächtig gross. Der Politologe Claude Longchamp schloss aus der späten, massiven Zunahme der Ablehnung der Frauenrentenalter-Erhöhung, dass die Gegnerinnen sogar hätten gewinnen können, wenn sie nur zwei Wochen früher mit ihrer Kampagne gestartet wären.
Das Momentum von feministischer Politik ist mächtiger denn je – und nicht nur in der Schweiz. Gerade erleben wir den historischen, für die amerikanischen Demokraten extrem glimpflichen Ausgang der Midterm-Wahlen, der wesentlich darin begründet ist, dass besonders jüngere und weibliche Wählerinnen sich von den Republikanern abwenden, weil sie entsetzt sind über das drohende Verbot von Abtreibungen.
In dieses Umfeld hinein soll die SP Schweiz nun als Auftakt zum nationalen Wahljahr ein Zweier- oder auch ein Dreierticket in die Bundesratswahlen schicken, zu dem Daniel Jositsch gehört? Es wäre die grösstmögliche Kopflosigkeit, eine Art politisches Harakiri. Wenn Jositsch auf dem Ticket steht, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit gewählt. Zum einen, weil er am äussersten rechten Rand der SP politisiert und deshalb in den bürgerlichen Parteien grosse Sympathien geniesst. Zum anderen, weil die Konkurrenz sich sicherlich nicht zweimal bitten lässt, die SP kurz vor den Wahlen auf so komfortable Weise zu demontieren.
Die Folge einer Jositsch-Wahl wären Grossdemonstrationen auf dem Bundesplatz, heftigster Zoff unter den Genossinnen, eine schwer beschädigte Glaubwürdigkeit als Gleichstellungspartei: eine Art Wiederholung des historischen Traumas um Christiane Brunner, der bekanntlich 1993 die Wahl in den Bundesrat verweigert wurde. Wie schon damals würde das Scheitern der weiblichen Kandidatinnen mit Sicherheit zu einer starken feministischen Mobilisierung führen – und zu einer Abwanderung von SP-Wählerinnen. Denn diesmal müsste sich die Empörung nicht gegen die Bundesversammlung, sondern gegen die SP-Fraktion richten.
Weshalb sollten die Genossinnen einen solchen Akt der politischen Selbstbeschädigung begehen? Sofern sie nicht vollkommen von Sinnen sind, werden sie Eva Herzog, Evi Allemann oder auch Elisabeth Baume-Schneider aufs Ticket setzen. Aber keinen wählbaren Mann.
Diese Gegebenheiten sind dermassen evident, dass sich eine Anschlussfrage stellt: Warum zum Teufel will Daniel Jositsch mit dem Kopf durch die Wand? Warum glaubt der so gewiefte und umsichtige Machtstratege, er solle es jetzt um jeden Preis drauf ankommen lassen?
Um es gleich vorwegzunehmen: Es bleibt ein wenig rätselhaft. Eine schlüssige Antwort auf diese Frage habe ich beim besten Willen nicht gefunden. Aber man kann immerhin zwei Vermutungen anstellen:
Erstens: Jositsch scheint überzeugt zu sein, dass es seine einzige Chance ist – wie verschwindend klein auch immer sie ist. Einleuchtender wäre es eigentlich, er hätte auf die Berset-Nachfolge gewartet, die wohl in einem oder in fünf Jahren kommen wird. Dann allerdings haben die Welschen Anspruch auf das Amt. Dass die Bundesratsparteien mit zwei Sitzen nicht nur die Geschlechterparität, sondern auch den Landesteilproporz respektieren wollen, potenziert noch einmal die Zuteilungszwänge (ausser für die SVP, die sich um solche Dinge foutiert). In der Öffentlichkeit hat der Anspruch der lateinischen Schweiz auf einen SP-Sitz sicherlich weniger Gewicht als die Frauenquote, im Parlament allerdings dürfte das anders sein. Jositsch macht vermutlich die Rechnung, dass er gegen Roger Nordmann oder Pierre-Yves Maillard völlig chancenlos bleiben wird. Noch chancenloser als heute.
Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Jositsch seine Kandidatur erst anmeldete, nachdem klar geworden war, dass alle aussichtsreichen Frauen aus der Romandie sich nicht für die Sommaruga-Nachfolge bewerben werden. Mit der jurassischen Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider steht nun zwar eine Kandidatin aus der französischen Schweiz zur Verfügung, ihre Wahlchancen erscheinen jedoch relativ gering. Nur eine siegreiche Kandidatin aus der welschen Schweiz, die zu einem vorübergehenden Romand-Überhang in der Regierung geführt hätte, würde Jositsch bei der Berset-Nachfolge den Weg ebnen.
Zweitens: Jositsch könnte darauf gesetzt haben, dass nur eine schwergewichtige SP-Frau ins jetzige Rennen steigt. Anfang Woche schien dieses Szenario noch durchaus plausibel. Eva Herzogs Ambitionen schienen immer klar, dass sie sich aufstellen lassen würde, wurde kaum in Zweifel gezogen. Bei Evi Allemann jedoch gab es die Frage der Vereinbarkeit von Amt und Familie, die beispielsweise Flavia Wasserfallen für sich nun anders entschieden hat. Es hätte sein können, dass Allemann zurücksteht. Wenn die SP-Fraktion am Ende gar nicht in der Lage gewesen wäre, zwei überzeugende Kandidatinnen zu präsentieren, wäre eine Jositsch-Kandidatur nur schwer zu verhindern gewesen.
Jetzt allerdings verfügen die Sozialdemokratinnen sogar über drei
sehr starke Kandidatinnen, die gemeinsam die Bandbreite der SP-Positionierungen hervorragend repräsentieren und von denen mindestens zwei von der Bundesversammlung auch fraglos wählbar sind.
Mit dem jetzigen weiblichen Kandidatinnen-Trio bekommt der Zürcher Ständerat nun zudem noch ein zusätzliches Problem: Obwohl der dossierfeste, extrem populäre, auch ausserhalb der SP bestens vernetzte, am äussersten rechten Rand der Partei politisierende Jositsch ein sehr starker Kandidat wäre, hat sein Leistungsausweis auch einen klaren Mangel: keine Exekutiverfahrung. Diese ist für eine erfolgreiche Kandidatur zwar nicht zwingend nötig, aber sie ist ein Plus. Sowohl Eva Herzog als auch Evi Allemann und Elisabeth Baume-Schneider bringen Parlaments- und Exekutiverfahrung mit. Sowohl Herzog als auch Allemann sind ebenfalls sehr populäre, erfolgreiche, im rechten SP-Spektrum situierte Politikerinnen. Mit dem Argument, man dürfe nur auf Qualifikation und sonst auf gar nichts achten, kann Jositsch gegen solche Konkurrentinnen rein gar nichts ausrichten. Es wendet sich gegen ihn selbst.
Die nächste SP-Bundesrätin wird vermutlich Eva Herzog heissen. Das liegt nicht nur daran, dass sie im Club der SP-Rechtsabweichler noch weiter aussen steht als Evi Allemann und sogar mit Daniel Jositsch locker mithalten kann. Herzog und Jositsch waren bekanntlich die beiden einzigen gewichtigen SP-Vertreterinnen, die sich gegen das Unternehmenssteuer-III-Referendum stellten – Herzog sogar noch sehr viel lautstärker als der Zürcher Ständerat. Die NZZ lässt wenig Zweifel daran, dass sie sich für eine Bundesrätin Herzog deutlich stärker erwärmen könnte als für eine Bundesrätin Allemann – und es natürlich sehr begrüssenswert fände, wenn auch Jositsch auf dem Ticket wäre.
Aber wie gesagt: Bundesratswahlen sind Schüttelbecher, insbesondere von Motiven, mit denen man lieber nicht hausieren geht. Ein sehr wichtiges Abwägungselement wird der Altersunterschied zwischen Allemann und Herzog sein. Für die SP-Fraktion wäre es ein attraktives Plus, eine vergleichsweise junge Mutter in den Bundesrat zu schicken. Sie würde damit neues gleichstellungspolitisches Terrain erobern, ihre progressive Familienpolitik bekräftigen, ein überfälliges Signal aussenden.
Doch die Wahl vollzieht die Bundesversammlung. Für alle anderen Parteien wäre das schon relativ fortgeschrittene Alter von Herzog, die kurz nach dem Wahltermin vom 7. Dezember ihren 61. Geburtstag feiern wird, sehr viel vorteilhafter. Wenn Allemann das Rennen macht, wird sie voraussichtlich zwölf, vielleicht auch sechzehn Jahre im Amt bleiben. Bei Herzog dürfte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach acht oder zehn Jahren wieder Schluss sein, und eine möglichst kurze Amtszeit der SP-Bundesrätin kommt der politischen Konkurrenz entgegen.
Erstens, weil die alles entscheidende Frage der Departementsverteilung nach dem Anciennitätsprinzip geregelt wird. Zweitens, weil ein Bundesratsrücktritt eine Partei potenziell verwundbar macht – was in den nächsten Jahren, in denen die Zusammensetzung der Landesregierung sich wohl verändern wird, relevanter werden könnte denn je.
Wer wird die nächste SP-Bundesrätin? Trotz des Rummels um die «Diskriminierungs»-Zwischeneinlage wird es diesmal wohl recht absehbar werden. Es sei denn, die SP-Fraktion verliert vollkommen den strategischen Kompass. Dafür gibt es bisher keine Anzeichen.
In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass Herzog und Jositsch «die beiden einzigen gewichtigen SP-Vertreterinnen waren, die sich gegen die Unternehmenssteuerreform III stellten». Dies ist nicht korrekt, die Stelle ist korrigiert. Wir danken für den Hinweis aus der Verlegerschaft.
Illustration: Alex Solman