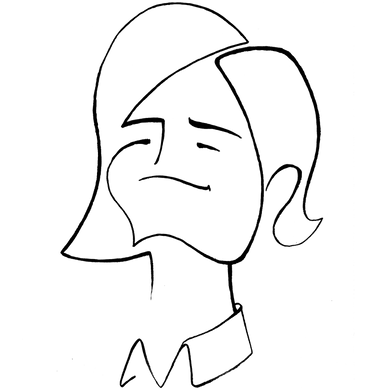
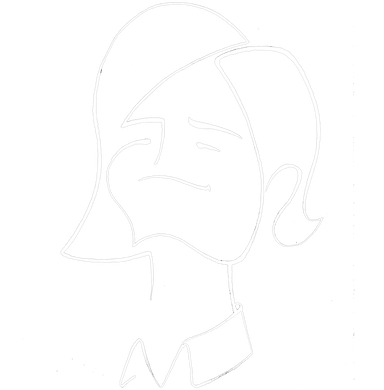
Steuern für homogame Paare
Die ewige Debatte um die «Heiratsstrafe» geht in die nächste Runde. Niemand will sie. Aber ihre Abschaffung ist problematischer, als es scheinen könnte.
Von Daniel Binswanger, 29.10.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
Max Weber, die Gründerfigur der heutigen Sozialwissenschaften, definierte den modernen Staat bekanntlich als «Steuerstaat». Eine Grundeigenschaft entwickelter Staatswesen liegt in der Fähigkeit, sich Zugriff auf einen Teil des Volkseinkommens zu verschaffen, zur Finanzierung stehender Heere, einer funktionierenden Verwaltung und all jener hoheitlichen Aufgaben, welche den Zusammenhalt politischer Gemeinwesen gewährleisten: Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Justiz, minimale soziale Sicherheit. In ihrem Kern ist Politik immer Steuerpolitik.
Das gilt auch und gerade, wenn mit der Auseinandersetzung um die legitime Zuweisung der Steuerlasten nicht «nur» Verteilungsfragen verhandelt werden, sondern auch die fundamentalen Wertefragen einer Gesellschaft. Die Schweiz tut dies momentan intensiv mit den verschiedenen politischen Vorstössen zur Besteuerung von Ehepaaren. An der Notwendigkeit einer Reform kann wenig Zweifel bestehen, in der Hinsicht herrscht breiter Konsens. Dennoch zeigen ausgerechnet die Debatten um die «Heiratsstrafe», wie schwierig und widersprüchlich der vermeintliche gesellschaftliche Fortschritt sich häufig darstellt.
Nicht weniger als drei Reformansätze sind heute auf der Agenda. Erstens wurde der Bundesrat vom Parlament in der Legislaturplanung 2019 bis 2023 dazu verpflichtet, einen Gesetzesvorschlag zur Individualbesteuerung zu verabschieden. Die Eckwerte eines solchen Vorschlags wurden im Mai kommuniziert und sind nun in der Vernehmlassung.
Zweitens hat das hauptsächlich von FDP-Politikerinnen, aber auch von GLP- und selbst ein paar SP-Vertretern unterstützte Komitee für eine «Volksinitiative zur Einführung der Individualbesteuerung» die Unterschriftensammlung diesen September erfolgreich abgeschlossen. Falls das Parlament sich nicht schon 2023 auf die gesetzliche Einführung der Individualbesteuerung einigen kann, dürfte der Initiativtext 2024 zur Abstimmung kommen.
Drittens hat die Mitte-Partei letzte Woche eine Unterschriftensammlung für eine Ehegatten-Besteuerungs-Vorlage lanciert. Die Initiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare» will sich absetzen von der Individualbesteuerung und im Grundsatz die eheliche «Wirtschaftsgemeinschaft» nicht antasten. Da Verheiratete gegenüber Konkubinatspaaren jedoch nicht benachteiligt werden sollen, würden gemäss dem Umsetzungsvorschlag der Mitte Ehepaare vom Fiskus einer zweiten Einschätzung unterzogen, so als wären sie nicht verheiratet und versteuerten ihre Einkommen beide unabhängig. Zur Anwendung kommen würde dann jeweils die für die Eheleute günstigere Steuerrechnung.
Die Vorlagen häufen und überlappen sich aus einem einfachen Grund: Obwohl ein Grundkonsens herrscht, dass die steuerliche Diskriminierung von Ehepaaren gegenüber Konkubinatspaaren nicht aufrechterhalten werden sollte, und obwohl seit den Achtzigerjahren (!) ein Bundesgerichtsentscheid vorliegt, der diese Diskriminierung als nicht verfassungskonform beurteilt, führen die Reformvorschläge sofort zu Zielkonflikten. Diese sind fundamentaler und schwieriger zu lösen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
Was würde die Individualbesteuerung leisten? Die Ehepartner würden je einzeln besteuert (wie bei einem Konkubinatspaar), das heisst, ihre beiden Einkommen würden zur Berechnung des Haushaltseinkommens nicht mehr zusammengezählt. Bei Doppelverdiener-Haushalten mit zwei guten Einkommen führt die Steuerprogression heute dazu, dass der gemeinsame Verdienst deutlich höher besteuert wird, als dies der Fall wäre bei einer getrennten Veranlagung. Wenn zum Beispiel beide Eheleute je 120’000 Franken Jahreslohn versteuern müssen, ist es deutlich günstiger, wenn sie dies separat tun können, als wenn sie dem Fiskus gegenüber das gemeinsame Haushaltseinkommen von 240’000 Franken abzugelten haben.
Der Vorteil der Individualbesteuerung ist erstens, dass die Ungleichbehandlung von Konkubinatspaaren und Ehepaaren aufgehoben wird. Und dass es zweitens für Zweitverdienerinnen (das sind in den meisten Fällen die Frauen) attraktiver wird, einen Teil zum Haushaltseinkommen beizutragen. Das heutige System belastet die Zweiteinkommen mit überproportional hohen Steuerabgaben – und setzt deshalb für die Zweitverdienerinnen einen Anreiz, nur wenig oder gar nicht zu arbeiten. Dieser negative Anreiz steht offensichtlich in krassem Gegensatz zum Ziel der möglichst guten Arbeitsmarktintegration beider Ehepartner. Da es häufig die Frauen sind, die das Zweiteinkommen verdienen, ist es vor allem ein Gebot der Gleichstellungspolitik, dieser fiskalischen Diskriminierung entgegenzutreten.
Allerdings führt die Individualbesteuerung zu einer neuen Form der Ungleichbehandlung: Ein Ehepaar, bei dem beide Partner gleich viel verdienen (120’000 und 120’000, um beim Beispiel zu bleiben), würde stark profitieren vom neuen System. Ein Ehepaar jedoch, bei dem der eine Partner 200’000, der andere aber nur 40’000 verdient, würde weniger profitieren, weil der Lohn von 200’000 bereits einer stärkeren Steuerprogression unterliegt. Die beiden Paare hätten zwar dasselbe Haushaltseinkommen, würden steuerlich aber nicht gleich behandelt.
Auch das wäre nicht unproblematisch: Bei gleichem Einkommen – gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit – sollte gemäss Bundesverfassung im Grundsatz die Steuerlast identisch sein. In der Vernehmlassungsvorlage des Bundes soll diese Diskriminierung teilweise korrigiert werden durch erhöhte Kinder- und Einzelverdienerabzüge. Mit solchen Spezialabzügen könnte ein gewisser Ausgleich geschaffen werden, sie haben aber den Nachteil, dass sie zu noch höheren Steuerausfällen führen.
Noch problematischer ist jedoch eine andere Verzerrung: Besonders vorteilhaft wäre die Individualbesteuerung für Paare, bei denen beide hohe Löhne verdienen, das heisst für die gut ausgebildete obere Mittelschicht. Wenn die Partnerinnen jedoch beide einen tiefen Verdienst haben, schlägt die Steuerprogression beim gemeinsamen Haushaltseinkommen ohnehin nicht stark zu Buche. Der Gleichstellung wäre mit der Individualbesteuerung gedient. Dem sozialen Ausgleich jedoch nicht.
Mit einer etwas anderen Philosophie will die Mitte-Partei der Heiratsstrafe entgegentreten. Dass die Partei, die bis vor kurzem noch das «C» im Namen führte, die Ehe möglichst fördern und nicht bestrafen möchte, kann nicht verwundern. Es geht ihr denn auch nicht um eine Gleichbehandlung von unverheirateten und verheirateten Paaren, sondern um eine Besserstellung der Letzteren. Statt einer Heiratsstrafe will die Mitte eine Heiratsbelohnung.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob im Jahr 2022 die Politik tatsächlich die Aufgabe übernehmen soll, in dieser Weise auf die Lebensführung der Menschen Einfluss zu nehmen – umso mehr, als die Präferenz für die Ehe den Verhältnissen in diesem Land ganz einfach nicht mehr entspricht. 2021 entstammten in der Schweiz über ein Viertel der geborenen Kinder einer nicht-ehelichen Beziehung. Das Konkubinat ist zu einem völlig normalen, weitverbreiteten Modell des Zusammenlebens geworden – auch für Haushalte mit Kindern. Für die Eheschliessung steuerliche Anreize setzen zu wollen, widerspiegelt nicht die gesellschaftliche Entwicklung.
Das eigentliche Grundproblem, das sich in den Debatten um die Ehegattenbesteuerung abbildet, haben wir aber noch gar nicht berührt. Es ist die stärker werdende Tendenz zur sogenannten Homogamie – und die gesellschaftlichen Folgen, die diese mit sich bringt.
Mit Homogamie ist die Angleichung der Partnerinnen in Durchschnittsehen gemeint. Zunehmend haben innerhalb einer ehelichen Lebensgemeinschaft beide Parteien ein ähnliches Bildungsniveau, ein ähnliches Einkommen, ähnliche Vermögensverhältnisse. Früher war es absolut nicht ungewöhnlich, dass ein Mann eine Frau heiratete, die ein deutlich niedrigeres Einkommen hatte: der Chef die Sekretärin, der Arzt die Pflegerin. Die Häufigkeit dieser Asymmetrie war natürlich Ausdruck patriarchalischer Lebensverhältnisse, mehrheitlich war der besser gestellte Teil der Partnerschaft der Mann. Insofern ist die verstärkte Homogamie ein klarer gesellschaftlicher Fortschritt, der stark dadurch vorangetrieben wird, dass zwischen dem durchschnittlichen Bildungsniveau von Männern und Frauen kein Gefälle mehr besteht. Diese positiven Entwicklungen haben aber auch einen Preis: Sie führen zu mehr Ungleichheit.
Besonders massiv ist dieser Effekt in den USA, wie der Ungleichheitsforscher Branko Milanović in seinem Buch darlegt. Studien belegen, dass sich die Muster der Partnerwahl heiratswilliger Amerikaner und Amerikanerinnen stark verändert haben. Seit den Siebzigerjahren wird die Partnerwahl immer «assortierter». Wer gut verdient, wählt eine gut verdienende Partnerin. Wer auf einer Eliteuniversität war, wird jemanden heiraten, der auf derselben Universität einen Abschluss gemacht hat – und dies mit einer Wahrscheinlichkeit, die viel, viel höher ist als noch vor zwei Generationen. Theoretisch ist die heutige Gesellschaft individualistischer denn je. Dennoch sind soziokulturelle Milieunormierungen inzwischen ungleich mächtiger als früher.
Die Folge davon ist, dass ein geschätztes Drittel der Zunahme der Ungleichheit zwischen den späten Sechziger- und den späten Nullerjahren in den USA nicht auf die Veränderung der Einkommensverteilung oder der Sozialpolitik, sondern einzig und allein auf die veränderten Präferenzen bei der Partnerinnenwahl zurückzuführen ist. Die deutlich verbesserte Gleichstellung innerhalb der Partnerschaften ist eine der zentralen Errungenschaften der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Aber sie hat weitreichende, negative Folgen: die Verstärkung der Ungleichheit, eine Verschärfung der sozialen Segregation.
Wie ist die Entwicklung in der Schweiz? Zunächst kann man Entwarnung geben: sehr viel weniger dramatisch. Eine Studie aus dem Jahr 2017 kommt zum Ergebnis, dass zwar auch die Schweiz eine sehr ausgeprägte Homogamie mit Bezug auf den Bildungsgrad der Ehepartnerinnen vorweist, dass sich diese Bildungs-Homogamie aber nur mässig auswirkt auf die Veränderung der Einkommensverteilung. Damit ist die Schweiz ein Sonderfall: In fast allen OECD-Ländern lässt sich ein Einfluss der zunehmenden Homogamie auf die Einkommensverteilung feststellen.
Die Schweizer Eigenheit dürfte unter anderem an einer Besonderheit der hiesigen Erwerbsbeteiligung liegen: der Tatsache, dass hierzulande ausnehmend viele verheiratete Frauen in einem relativ kleinen Teilzeitpensum arbeiten und deshalb trotz guter Ausbildung nur relativ mässige Einkommen erzielen. Diese Schweizer Besonderheit ist ja auch, wogegen die Individualbesteuerung antreten will: Niedrigere Steuern für Zweiteinkommen sollen einen Anreiz schaffen für höhere Pensen.
Gleichstellungspolitisch ist dieses Anliegen absolut einleuchtend. Sozialpolitisch dürfte es jedoch zu verstärkter Ungleichheit führen. Der assortierte Bildungsstand verheirateter Paare würde auch in der Schweiz einen stärkeren Einkommenseffekt bekommen. Die steuerliche Förderung der Doppelverdienerinnen-Familie bleibt deshalb eine ambivalente Angelegenheit. Die Individualbesteuerung ist das Steuersystem für die Homogamie. Und dafür, dass die «assortierten» Paare ihre wirtschaftliche Potenz noch besser ausspielen können.
Wäre es da nicht sinnvoller, die Berufstätigkeit von Frauen prioritär durch andere Massnahmen zu fördern, zum Beispiel durch ein günstiges, qualitativ hochstehendes und gut organisiertes Früh- und Fremdbetreuungsangebot? Muss Gleichstellung wirklich auf Kosten von sozialem Ausgleich gehen? Das ist eine der absoluten Grundfragen der heutigen Politik, und sie stellt sich nicht nur im Bereich der Ehegatten- und Familienbesteuerung. Aber hier besonders akut.
Illustration: Alex Solman