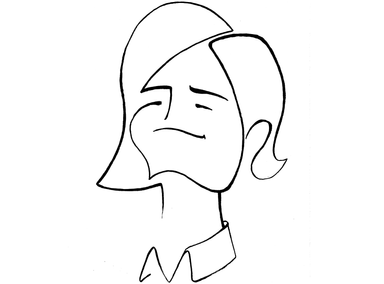
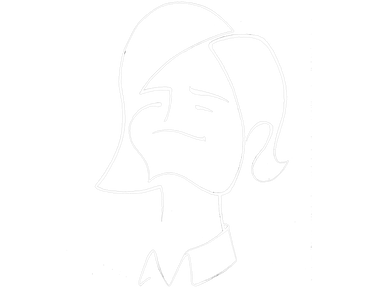
Freiheit ist sozial
Wir leben in hyperindividualistischen Gesellschaften – und gleichzeitig sind autoritäre politische Bewegungen im Aufwind. Wie ist das möglich? Ein neues Buch gibt Antworten.
Von Daniel Binswanger, 08.10.2022
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Leben wir nicht – bei allen Krisen und beängstigenden Perspektiven – in einer Epoche, die mehr Freiheiten bietet als jede andere zuvor? In der zum Beispiel die LGBTQIA+-Community einer gesellschaftlichen Anerkennung und Gleichberechtigung viel näher gekommen ist als jemals in der bisherigen Geschichte? In der die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zwar nicht durchgesetzt, aber unbestreitbar schon sehr viel weiter ist als noch vor einer Generation? Leben wir, mindestens in den westlichen Demokratien, nicht in einer Gesellschaft, die zwar kälter, härter und kompetitiver geworden sein mag, die aber auch mehr Optionen bietet für freie und sinnvolle Lebensgestaltung?
Man wird hier kaum mit Nein antworten können, was aber zu einer seltsamen Anschlussfrage führt: Warum dann nehmen autoritäre Tendenzen zu? Warum stösst der liberale Verfassungsstaat wieder auf so zahlreiche, radikale Kritikerinnen: unter Corona-Leugnern, Putin-Versteherinnen, Verschwörungstheoretikern aller Couleur? Warum haben extremistische Bewegungen so starken Zulauf, warum wird Giorgia Meloni voraussichtlich italienische Regierungschefin und könnte Donald Trump schon bald wieder ins Weisse Haus einziehen?
Wissen wir die eroberten Freiheiten nicht zu schätzen? Sind sie letztlich eine Überforderung? Woher kommt die scheinbar so fundamentale Enttäuschtheit?
Die Literatursoziologin Carolin Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey sind diesen Fragen in einem neuen Buch mit dem Titel «Gekränkte Freiheit» nachgegangen. Der Untertitel des Werks liefert eine Kurzformel für ihren Erklärungsansatz: «Aspekte des libertären Autoritarismus».
Es handelt sich um eine relativ dickleibige, nicht immer übersichtliche, aber stimulierende Bestandsaufnahme der politisch-sozialen Grundentwicklungen, die unsere Epoche prägen. Die These von Amlinger und Nachtwey lautet, dass heutige Gesellschaften von einer neuen Dynamik dominiert werden oder vielmehr dominiert zu werden drohen: einem machtvollen libertären Grundaffekt, der mehr und mehr ins Autoritäre kippt.
Zunächst erscheint dies widersprüchlich. Libertäre Ideologien favorisieren einen übersteigerten, ruchlosen, manchmal mit der Anarchie kokettierenden Individualismus. Ihre Anhängerinnen haben im Prinzip das völlig falsche Profil, um sich einer Autorität zu unterwerfen. Für Amlinger und Nachtwey ist dieses scheinbare Paradox jedoch das eigentlich bezeichnende der heutigen Situation: Der starke Individualismus, die flächendeckende Valorisierung von Eigenverantwortung und die damit einhergehende Entwertung von öffentlicher Regulierung und staatlicher Intervention haben die Sehnsucht nach starken Autoritäten neu angestachelt und transformiert.
Auch autoritäre Neigungen nehmen heute individualistischere Formen an: Sie gelten weniger einem «starken Mann» oder einem mächtigen Staat als einer Idee, einer extremen Ideologie, die aggressiv und apodiktisch daherkommt, einer Verschwörungstheorie zum Beispiel. Sie formieren sich weniger in politischen Parteien und hierarchischen, stabilen Organisationen als in Ad-hoc-Bewegungen wie den Querdenkern. Sie unterwerfen sich nicht einer Autorität, auf die die eigenen Ermächtigungsfantasien projiziert werden, vielmehr erheben sie die eigene Freiheit, die vermeintliche eigene Souveränität, den Willen, sich auf gar keinen Fall von finsteren Mächten über den Tisch ziehen zu lassen, zum neuen Mass aller Dinge. Zum Beispiel, indem man sich weigert, sich Regeln zu unterwerfen, Corona-Massnahmen zu akzeptieren. Indem man sich selber davon überzeugt, dass alle Wissenschafts- und Mediendiskurse manipulativ und unwahr sind – und man deshalb sein eigenes Wissen und «alternative Fakten» zusammenzugoogeln beginnt. Indem man seine eigene Freiheit zu einem kuriosen Quasi-Absolutum erhebt – mit einem illiberalen, autoritären Affekt, aber in ideologischem Gleichklang mit den individualistischen Grundtendenzen unserer Zeit.
Darin unterscheidet sich der heutige Autoritarismus von älteren autoritären Ideologien, insbesondere vom Faschismus, auch wenn dieser weit davon entfernt ist, heute keine Rolle mehr zu spielen. Amlinger und Nachtwey greifen auch auf klassische Faschismustheorien zurück, insbesondere auf die Forschungen der Frankfurter Schule.
Schon Horkheimer und Adorno – und im Umfeld der berühmten Studien über den «autoritären Charakter» auch andere Vertreter des Frankfurter Institutes für Sozialforschung – sind ausgegangen von der «Dialektik der Aufklärung», das heisst von einer zutiefst widersprüchlichen Entwicklung der Freiheitsrechte in der modernen Gesellschaft: Sie führten einerseits zur Herausbildung von Demokratien und andererseits in den Faschismus.
Gemäss Amlinger und Nachtwey ist die heutige, spätmoderne Gesellschaft dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mehr den Konformitätsdruck der Industrie- und Massengesellschaft der Nachkriegszeit erzeugt, sondern dass sie über Distinktions- und Wettbewerbszwang eine Hyperindividualisierung durchsetzt. Diese Hyperindividualisierung ist extrem anfällig für Versagen, für Enttäuschungen – für Kränkung. Es wohnt ihr deshalb ein grosses regressives Potenzial inne. Die nicht eingeholten Versprechungen der Emanzipation führen dazu, dass die Bürgerinnen sich auf unanfechtbare Bezugspunkte zurückziehen wollen. Und das kann unter heutigen Bedingungen zunächst einmal nur bedeuten: auf sich selbst.
«Die Menschen (…) verteidigen die Freiheit, ihre Freiheit – doch dies auf eine merkwürdig apodiktische, ja geradezu autoritäre Weise», resümieren die Autorinnen.
Dieser Grundgedanke eines anhaltenden, immanenten Widerspruchs des modernen Emanzipationsgedankens ist wichtig und fruchtbar. Er schliesst in der Tat an die frühen Faschismustheorien der Frankfurter Schule an, auch wenn das sehr ausführliche Referat dieser historischen Theoriediskurse bei Amlinger und Nachtwey weit über das hinausgeht, was nötig gewesen wäre, um ihre eigene Konzeptualisierung herzuleiten. Beeindruckend sind an ihrem Buch vor allem die empirischen Fallstudien, ausführliche Gespräche mit Menschen aus der Querdenker-Szene, deren Biografie und ideologisches Profil differenziert und überzeugend dargestellt werden.
Das Zentrum von Amlingers und Nachtweys eigener Theoretisierung bildet der Begriff der «verdinglichten Freiheit». Sie greifen damit explizit die Theorie der Verdinglichung des Philosophen Georg Lukács wieder auf: Die Verdinglichung der Freiheit soll besagen, dass «Freiheit» heute eine Art «Gegenständlichkeit» angenommen hat, nicht mehr als eine bestimmte Art der sozialen Beziehung aufgefasst wird, sondern nur noch als eine individuelle Errungenschaft. Als etwas, was der Einzelne im Konkurrenzkampf gegen seine Mitstreiterinnen erobern muss, was ihm als Besitzstand und persönliche Auszeichnung gehört – und von der Gesellschaft nur beschnitten und geraubt werden kann. Dabei, so Amlinger und Nachtwey, ist Freiheit eine Qualität selbstbestimmter und produktiver sozialer Beziehungen – nicht eine Glorifizierung der Vereinzelung.
Die affirmative Vereinzelung, «ein verdinglichtes Freiheitsverständnis, das die sozialen Bindungen abwehrt», ist jedoch der Kern des neuen Autoritarismus und erklärt auch, weshalb die Mobilisierung gegen den Staat, gegen sämtliche Formen kollektiver Aktion im Namen des Gemeinwohls der neue ideologische Kerngehalt des autoritären Gedankenguts darstellt.
Die klassischen autoritären Bewegungen leben von der Identifikation mit einem allmächtigen Führer-Staat. Heute leben sie von einem enttäuschten Hyperindividualismus, der in aggressives Ressentiment umschlägt.
Dieses Grundelement von Amlingers und Nachtweys Analyse ist wichtig – und erlaubt ihnen einen erhellenden Zugriff auf die aktuellen politischen Radikalisierungstendenzen, an deren widersprüchlichem Wesen die Beobachter häufig scheitern. Wir alle kennen die häufig konfusen Debatten: Haben wir es nun zu tun mit Faschismus oder mit Postfaschismus? Mit esoterischen Spinnern oder gefährlichen Rechtsextremen? Und wie schaffen es heutige Gesellschaften, gleichzeitig so hyperindividualistisch zu bleiben und so illiberal zu werden?
Allerdings zeugt auch dieses sehr lesenswerte Werk stellenweise von der dominierenden Konfusion. Es ist eher eine Bestandsaufnahme der neuen politischen Entwicklungen als ein schlüssiges Erklärungsmodell. Sind strukturelle ökonomische Faktoren oder gesellschaftliche Werteverschiebungen für die neue Radikalisierung verantwortlich? Bei Lukács ist der Begriff der «Verdinglichung» eingebettet in einen marxistischen Theorierahmen. Bei Amlinger und Nachtwey ist dem selbstverständlich nicht mehr so. Der Transfer des Begriffs ist nicht illegitim. Aber wie viel Erklärungskraft hat «Verdinglichung» dann noch?
Teilweise scheinen sich die Autoren in ihrer ausgedehnten Kritik und Diskussionen anderer Theoriepositionen auch in Verkürzungen und Widersprüchen zu verheddern. So ist es einerseits ihr Kernanliegen, den Theorieansatz der Frankfurter Schule weiter fruchtbar zu machen, aber sie finden sich auch in erklärungsbedürftiger Gegenstellung zu Jürgen Habermas, deren immer noch bedeutendstem Vertreter.
Habermas hat in seinem kürzlich publizierten «Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik» die gefährdete Unterscheidung zwischen citoyen und bourgeois als Funktionsvoraussetzung für den liberalen Verfassungsstaat ins Zentrum seiner Gegenwartsdiagnose gestellt. Er betrachtet es als das Hauptproblem des heutigen öffentlichen Diskurses, dass die Grenze zwischen privater und öffentlicher Kommunikation insbesondere aufgrund der Dominanz sozialer Medien immer diffuser und durchlässiger geworden ist.
Amlinger und Nachtwey weisen das Insistieren auf dieser Unterscheidung zwischen privater und öffentlicher Kommunikation – allerdings in einer Kritik an Richard Sennett, nicht mit direktem Bezug auf Habermas – mit aller Entschiedenheit zurück. Sie kritisieren sie als «konservative Gesellschaftskritik», weil sie den «emanzipatorischen Gehalt» der neuen Valorisierung von Privatheit und Authentizität nicht adäquat reflektiere. Niemand kann bestreiten, dass die Bedeutung von privaten Präferenzen, wie sie sich seit den Siebzigerjahren zunehmend durchsetzt, eine politische Errungenschaft ist. Aber müsste das nicht getrennt werden von der Frage, welche Rolle sie spielen soll in der politischen Öffentlichkeit?
Stimulierend an der «Gekränkten Freiheit» bleibt, dass sie mit der Dialektik der Aufklärung wirklich ernst machen will. Es könnte durchaus sein, so die Autorinnen, dass «wir nicht mehr zu Normalität zurückkehren», dass der libertäre Autoritarismus eine feste Grösse der politischen Auseinandersetzung bleibt – und sich nach Corona nun am Russland-Ukraine-Krieg und zunehmend wohl auch an der Klimapolitik entzünden wird.
Aber dennoch werden alle kommenden Auseinandersetzungen – wenn wir es schaffen, den öffentlichen Diskurs zu erhalten, und wenn es weiter möglich bleibt, in echten politischen Alternativen zu denken – das Potenzial für weiteren emanzipatorischen Fortschritt bergen. Entscheidend ist, dass wir Freiheit auch in Zukunft «als etwas zutiefst Soziales begreifen».
Illustration: Alex Solman