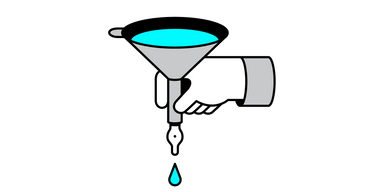
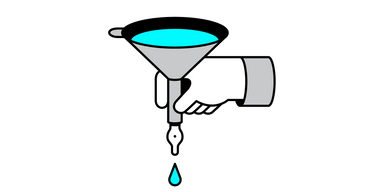
Ukraine erobert Lyman, Brasilien wird den Bolsonarismus nicht los und in Grossbritannien stürzen die Tories ab
Woche 40/2022 – das Nachrichtenbriefing aus der Republik-Redaktion.
Von Philipp Albrecht, Reto Aschwanden, Bettina Hamilton-Irvine, Carlos Hanimann, Boas Ruh und Jana Schmid, 07.10.2022
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Jetzt 21 Tage kostenlos Probe lesen:
Ukraine: Kiew erzielt weitere Geländegewinne, Russland formalisiert Annexion
Das Kriegsgeschehen: Der ukrainische Vormarsch geht weiter. Über das Wochenende wurde die strategisch wichtige Stadt Lyman im Osten des Landes zurückerobert. Am Samstag hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, seine Truppen zurückzuziehen, um einer Einkesselung zuvorzukommen. Am Sonntag erklärte Präsident Wolodimir Selenski, die Stadt sei «vollständig geräumt». Nach der Einnahme Lymans liegen nun auch wichtige Ortschaften in der russisch annektierten Region Luhansk in Reichweite der ukrainischen Armee.
Auch im Süden erzielen die ukrainischen Truppen kilometerweise Geländegewinne. Dort rücken die Soldaten in Richtung Cherson vor. Die Hafenstadt im Mündungsgebiet des Dnipro, in der sich starke russische Einheiten aufhalten, ist unter Beschuss. Entlang des Flusses haben die Russen zunehmend Mühe, ihre Stellungen zu halten, weil ihre Nachschubwege unterbrochen sind.
Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch Ziele in der Nähe von Kiew angegriffen, und zwar mit Kamikaze-Drohnen, die vom Iran geliefert worden sein sollen. Zudem führen russische Einheiten weiter eine Offensive im Donbass fort, allerdings kommen sie dabei nur stockend voran.
Die Annexion: Mit der Unterschrift von Präsident Wladimir Putin ist die russische Annexion von vier ukrainischen Gebieten seit dieser Woche formal vollzogen. Russland betrachtet Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk damit als eigenes Staatsgebiet. Allerdings hat die Armee längst nicht über alle diese Gebiete die Kontrolle, aus manchen ist sie von ukrainischen Truppen wieder vertrieben worden. Trotzdem stehen sie nun unter dem Schutz der Atommacht Russland. Putin hat erklärt, ein Angriff auf die Territorien würde wie eine Attacke gegen Russland gewertet, und hat angekündigt, das Land mit allen Mitteln zu verteidigen. Die Uno bezeichnet die Einverleibung als Bruch des Völkerrechts. Der ukrainische Präsident Selenski hat als Reaktion auf die Annexion per Dekret verfügt, dass es unter Umständen Verhandlungen mit Russland, keinesfalls aber mit Präsident Putin geben könne.
Weitere Entwicklungen: Die Nato hat erklärt, ein neu aufgebauter Gefechtsverband in der Slowakei sei nun einsatzbereit. Eine unlängst beendete Übung habe gezeigt, dass man nun die Aufgaben zum besseren Schutz der Ostflanke erfüllen könne.
Die EU-Staaten haben sich auf ein weiteres, das achte Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Unter anderem billigten sie am Donnerstag die rechtlichen Rahmenbedingungen, um einen Preisdeckel für russisches Öl einzuführen. Diesen Preisdeckel unterstützten auch die G-7-Staaten.
Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass Teile der ukrainischen Regierung verantwortlich sind für den Anschlag mit einer Autobombe, bei dem im August Darja Dugina getötet wurde. Der Anschlag ereignete sich in der Nähe von Moskau und galt womöglich eigentlich Duginas Vater, dem Ultranationalisten Alexander Dugin.
Die russische TV-Journalistin Marina Owsjannikowa, die Mitte März live in einer Nachrichtensendung gegen den Krieg protestiert hatte, ist aus dem Hausarrest geflohen und mit ihrer Tochter untergetaucht. Nun ist sie zur Fahndung ausgeschrieben, ihr drohen bis zu zehn Jahre Haft.
Grossbritannien: Liz Truss macht kehrt und strauchelt weiter
Darum geht es: Nach nur einem Monat im Amt steckt Premierministerin Liz Truss schon in einer schweren Krise. Vor zwei Wochen hatte ihre Regierung Steuersenkungen für Spitzenverdiener im Umfang von 45 Milliarden Pfund angekündigt. Ökonominnen und Ratingagenturen reagierten entsetzt, das Pfund rasselte auf ein Rekordtief. Truss räumte Fehler ein, hielt aber noch am Sonntag an ihren Plänen fest. Am Montag kam dann die Kehrtwende: Finanzminister Kwasi Kwarteng verkündete, die Pläne würden fallen gelassen.
Warum das wichtig ist: Grossbritannien leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten und hoher Inflation. Das Land bräuchte eine starke, handlungsfähige Regierung. Doch das Vertrauen in die neue Premierministerin hat durch ihren Zickzackkurs bereits stark gelitten. Der «Spiegel» titulierte Truss diese Woche in Anspielung auf Maggie Thatcher kalauernd als «eiernde Lady». Die Zustimmungswerte aus der Bevölkerung liegen laut Umfragen tiefer als jene des Ex-Premiers Boris Johnson kurz vor dessen Rücktritt. Auch aus der eigenen Partei kommt Gegenwind. Die nun zurückgezogenen Pläne für Steuersenkungen waren auch von Tories kritisiert worden. Der ehemalige Minister Grant Shapps munkelte bereits von einem möglichen Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen.
Was als Nächstes geschieht: Am Mittwoch hielt Liz Truss am Parteitag der Tories eine Rede. Sie verteidigte dabei ihren politischen Kurs, sagte der Wirtschaftskrise den Kampf an und versprach «Wachstum, Wachstum, Wachstum». Doch die Premierministerin ist eine Hypothek für ihre Partei. Ende September gaben in einer Umfrage 54 Prozent der Teilnehmerinnen an, wenn jetzt das Unterhaus neu gewählt würde, dann ginge ihre Stimme an die oppositionelle Labourpartei. Die Tories kämen gerade mal auf 21 Prozent. Zwar stehen diese Wahlen erst in spätestens zwei Jahren an. Ob sich Truss aber so lange an der Spitze ihrer Partei halten kann, scheint zumindest fraglich.
Brasilien: Lula führt nach dem ersten Wahlgang, aber der Bolsonarismus ist stärker denn je
Darum geht es: Bei den Wahlen in Brasilien hat der frühere Präsident und ehemalige Gewerkschafter Luiz Inácio Lula da Silva am meisten Stimmen geholt. Er liegt mit 48,4 Prozent aber nur 5 Prozentpunkte vor dem amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro. Die meisten Umfragen hatten Lula über 10 Prozent Vorsprung prognostiziert. Lula und Bolsonaro treten am 30. Oktober in der Stichwahl gegeneinander an.
Warum das wichtig ist: Brasilien ist das grösste, wirtschaftlich wichtigste und einflussreichste Land Lateinamerikas und hütet mit dem Amazonas die weltweit grösste Fläche an Regenwald. Seit 4 Jahren wird das Land vom Rechtspopulisten Jair Bolsonaro regiert. Unter ihm wurde der Amazonas so stark abgeholzt wie seit 15 Jahren nicht mehr, die Zahl der bewaffneten Bürgerinnen stieg um 500 Prozent, Hunger und Armut kehrten zurück, in der Pandemie starben fast 700’000 Menschen mit Covid, die Bevölkerung ist politisch tief gespalten. Unklar ist im Moment, wie Bolsonaros Anhänger auf eine Niederlage ihres «Mythos» reagieren würden: Im Vorfeld des ersten Wahlgangs hatte etwa ein Parlamentarier aus Bolsonaros Partei offen mit dem Griff zur Waffe gedroht, sollte der Präsident nicht wiedergewählt werden.
Was als Nächstes geschieht: Zwar deutet im Moment vieles darauf hin, dass Lula Bolsonaro ablösen könnte, aber der Bolsonarismo, die politische Bewegung und Kultur rund um den Präsidenten, wird deswegen nicht verschwinden. Die Liberale Partei PL des Rechtspopulisten wird neu in beiden Parlamentskammern am meisten Abgeordnete stellen und ist damit die stärkste Fraktion. Dahinter folgt Lulas Linksbündnis Hoffnung Brasilien. Eine entscheidende Rolle werden mehrere konservative Zentrumsparteien spielen – denn wer künftig regiert, wird sich mit ihnen arrangieren müssen.
Credit Suisse: Absturz an der Börse
Darum geht es: Die Erholung der stark gebeutelten Schweizer Grossbank verzögert sich weiter. Am Montag verlor die Aktie der Credit Suisse (CS) nach Handelsbeginn 10 Prozent ihres Werts. Dem Kurszerfall ging ein Memo voraus, das CS-Chef Ulrich Körner Ende letzter Woche an die Belegschaft verschickt hatte. Darin hielt er fest, dass es dem Unternehmen besser gehe, als der aktuelle Kurs vermuten lasse. Die Märkte deuteten diese Aussage allerdings als Zeichen der Schwäche.
Warum das wichtig ist: Der jüngste Absturz begräbt die Hoffnungen auf eine baldige Wende zum Besseren. Die Credit Suisse ist für die Schweiz too big to fail, weil ein grosser Teil der Wirtschaft auf die Bank als Kreditgeberin und Vermögensverwalterin angewiesen ist. Der Fall zeigt auch, wie schwierig die Kommunikation in Zeiten der Krise ist. Körner beabsichtigte mit seinem Memo, Unsicherheiten in der Belegschaft über den seit Monaten fallenden Aktienkurs zu beseitigen. Doch das Schreiben fand seinen Weg zur Nachrichtenagentur Reuters und führte daraufhin zu wilden Spekulationen auf Twitter und Reddit.
Was als Nächstes geschieht: Am 27. Oktober publiziert die Credit Suisse ihre Unternehmenszahlen für das dritte Quartal und will dabei auch aufzeigen, wie sie aus der Krise finden will.
Zum Schluss: Vom Twitter-Clown zum Viersternegeneral
Muhoozi Kainerugaba ist erstens Chef der ugandischen Landstreitkräfte. Zweitens ist er als ältester Sohn von Langzeitherrscher Yoweri Museveni ein aussichtsreicher Kandidat fürs Präsidentenamt. Und drittens ist er ein fleissiger Twitterer mit einem etwas eigenen Humor. Am Sonntag bot der Spassvogel der italienischen Wahlsiegerin Giorgia Meloni 100 Nkore-Kühe an. Das seien «die schönsten Kühe der Welt» und ein übliches Geschenk für «a girl you like». Von Meloni ist keine Reaktion bekannt. Gar nicht witzig fanden auf jeden Fall die Kenianer einen Tweet, den Kainerugaba am Montag absetzte. Darin erklärte der Präsidentensohn, er könnte die Hauptstadt Kenias in weniger als zwei Wochen einnehmen. Auch der Herr Papa konnte darüber nicht lachen, zumindest nicht öffentlich, und darum entliess er den Sohnemann als Chef der Landstreitkräfte – und ernannte ihn im Handumdrehen zum Viersternegeneral. Die Wegbeförderung erklärte Museveni mit einer «erprobten Formel», wonach das Negative geschwächt und das Positive gestärkt gehöre. Womöglich meinte er das ernst. Allerdings scheint der Hang zum Humoristischen in der Familie zu liegen. Unterschrieben hat Museveni seine Verlautbarung mit den Worten: «The old man with a hat».
Was sonst noch wichtig war
Die Corona-Lage: Plus 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche: Die Zahl der positiven Tests schnellt hoch. Plus 46 Prozent sind es bei den Covid-Patientinnen, die in Spitälern behandelt werden. Kleiner Lichtblick: Die Zahl der Covid-Kranken auf Intensivstationen sank um 22 Prozent. Die Aussichten aber verdunkeln sich: Die Zahl der Neuinfektionen dürfte sich alle 12 Tage verdoppeln. In den Niederlanden sprechen die Behörden bereits davon, dass die Herbstwelle begonnen habe.
Inflation: Im Euroraum stieg die Inflation im September in vielen Ländern in den zweistelligen Bereich. In der Schweiz hingegen sank sie auf 3,3 Prozent. Die Konjunkturstelle der ETH Zürich (KOF) korrigiert ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,8 auf 2,3 Prozent. Für 2023 rechnet die KOF mit 0,7 Prozent Wirtschaftswachstum.
Energie: Opec Plus hat sich auf eine Reduktion der Ölförderung verständigt. Damit reagiert das Kartell, das einen Marktanteil von 40 Prozent hat, auf die in letzter Zeit gesunkenen Preise. Opec Plus umfasst neben den Opec-Staaten in Afrika und im Nahen Osten unter anderem auch Russland.
Iran: Die Unruhen im Land haben auch die Universitäten ergriffen. Auf dem Campus einer Elite-Uni in Teheran sollen Sicherheitskräfte auf Studentinnen geschossen haben. Mehr zu den Protesten im Iran erfahren Sie in unserem grossen Hintergrundbeitrag hier.
China: Eine Mehrheit der Mitgliedsländer hat es abgelehnt, dass der Menschenrechtsrat der Uno über die Situation der Uiguren in China debattiert. Damit verschwindet der Bericht, in dem Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet scharfe Kritik an Pekings Umgang mit der muslimischen Minderheit geäussert hat, buchstäblich in der Schublade.
Indonesien: Bei einem Fussballmatch sind am Sonntag in Malang mindestens 125 Menschen ums Leben gekommen. Nachdem Fans das Spielfeld gestürmt hatten, setzte die Polizei Tränengas ein, was wiederum eine Massenpanik auslöste. Es handelt sich um eine der schwersten Stadionkatastrophen in der Geschichte des Sports.
EU: Ab 2024 ist ein einheitliches Ladekabel vorgeschrieben. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Die Zustimmung der Staaten steht noch aus, gilt aber als Formsache. Auch in der Schweiz dürften künftig nur noch Geräte auf den Markt kommen, die mit USB-C-Kabeln geladen werden können.
Die Top-Storys
Der Neandertaler in uns Svante Pääbo erhält den diesjährigen Nobelpreis für Medizin. Der Paläogenetiker hat das Erbgut von Neandertalerinnen analysiert und festgestellt: Noch heute steckt in vielen von uns ein Stück Neandertaler. Wie es dazu kam und warum Neandertaler-Gene das Risiko auf schwere Verläufe nach einer Corona-Infektion erhöhen, hat Pääbo schon letztes Jahr dem Wissenschaftsmagazin «Spektrum» erzählt.
Von wegen Genie Elon Musk will Twitter nun doch kaufen. Doch bevor das am Dienstag bekannt wurde, bekam die Öffentlichkeit einen Einblick in das Smartphone des Tech-Milliardärs – ein Gericht hatte im Zusammenhang mit dem Zwist um den Twitter-Kauf Hunderte von SMS und E-Mails veröffentlicht. Was lernt man daraus? Vor allem, dass Musk, der sich gern als Genie sieht, ziemlich banale Konversationen führt. Wer auch immer sagte, beim Brainstorming gäbe es keine schlechten Ideen, habe nie Zugang zu Elon Musks Handy gehabt, schreibt das Magazin «The Atlantic».
«Tu doch nicht so» Sie steckt sich bei der Arbeit im Pflegeheim an und erholt sich nicht mehr. Wegen Long Covid verliert sie ihre Stelle. Doch die IV will nicht bezahlen. Die WOZ über den Leidensweg von Menschen, die sich nicht wirklich erholen können und nicht die Hilfe erhalten, die sie bräuchten.
Illustration: Till Lauer