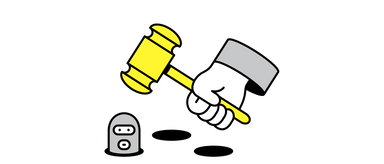
1,5 Grad – um am Leben zu bleiben
Südpazifische Rechtsstudentinnen wollen das Uno-Weltgericht anrufen – um konkrete Aussagen zur Relevanz des Klimawandels zu erzwingen. Kann das klappen? Und was würde es bewirken?
Von Yvonne Kunz, 31.08.2022
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Wir müssen lernen, in einer anderen Welt zu leben: Diesen Appell wiederholt Historiker und Philosoph Philipp Blom seit Jahren. Anlässlich der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise und der Pandemie – vor allem aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
In unseren Breitengraden ist das noch freiwillig. Noch geniessen wir in der Schweiz den Luxus, darüber nachzudenken, ob wir bei einer Strommangellage vielleicht auf die künstliche Beschneiung der Skipisten verzichten wollen. Wir können es uns noch leisten, überhaupt darüber zu streiten, inwiefern das alles mit dem Klimawandel zu tun hat.
Anders im Südpazifik. Dort geht es bereits ums Überleben. Seit Jahrzehnten machen kleine Inselstaaten auf ihre missliche Lage angesichts des Klimawandels aufmerksam – so richtig interessiert es die Weltgemeinschaft bisher nicht. Vielleicht aber schaffen es zwei Handvoll südpazifische Jusstudentinnen bald, dies zu ändern. Via Rechtsweg.
Ort: 77. Uno-Vollversammlung, New York
Zeit: 13. September 2022 (Eröffnung)
Thema: Klimawandel, Menschenrechte, Generationengerechtigkeit
Leicht sei der Alltag in einem Entwicklungsland wie den Salomonen nicht, sagt Jurist und Politologe Solomon Yeo. Und doch bezeichnet er seine Heimat im Südpazifik als «den glücklichsten Ort auf Erden». Das Glück, glaubt er, liege in den Werten, auf denen die Gesellschaft dort baue: Gemeinschaftssinn und tiefe Verbundenheit mit der Natur.
Doch sein Paradies ist in Gefahr. Inselstaaten wie die Salomonen liegen an der vordersten Front der Klimakrise. Wird das Pariser Klimaziel, die Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad seit der vorindustriellen Zeit, verfehlt, drohen sie zu verschwinden. Vielleicht schon in diesem Jahrhundert, befürchtet der Weltklimarat.
«1,5 to stay alive» ist im Südpazifik kein Slogan, sondern spürbare Realität.
Diese Realität hat Solomon Yeo von der entlegenen Pazifikinsel nach New York geführt. Er ist Leiter einer Kampagne der «Pacific Islands Students Fighting Climate Change», die das Ziel verfolgt, die weltweite Rechtsprechung zu den Folgen des Klimawandels zu verändern – und damit auch die Art und Weise, wie wir im Globalen Norden darüber denken.
Wir sitzen uns per Zoom gegenüber. Er rekapituliert die erstaunliche Geschichte dieser Studenteninitiative. In konzisem Englisch spricht er eine Stunde lang Klartext: «What a mess!»
Ich frage ihn, wie er den Klimawandel in seinem Alltag zu Hause wahrnimmt – und erwarte Horrorstorys von untergehenden Inseln und zerstörerischen Zyklonen; Bilder, mit denen die Klimaapokalypse effektvoll heraufbeschworen werden kann.
Stattdessen spricht Yeo darüber, wie in seiner Heimat das gesellschaftliche Klima kippt. Über Spannungen in der Bevölkerung, Anzeichen von Verteilkämpfen, wenn Menschen von der Küste wegziehen, weiter ins Landesinnere; auf Land, das ihnen nicht gehört. Über Vergewaltigungen von Frauen, die zum Wasserholen weiter ins Inland müssen, weil küstennahe Quellen versalzen.
Die Folgen des Klimawandels, sagt er, endeten nicht mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Nicht damit, dass Zyklone heftiger würden, Regenfälle extremer, Dürren häufiger. «Sie dringen ins Fundament einer Gesellschaft und zerfressen es.» Existierende Ungleichheiten verstärkten sich, sagt Yeo. Im Grossen wie im Kleinen.
Und das sei einfach falsch.
Rechtsentwicklung, aber bitte sofort!
Der Jurist und Aktivist gehört zu einer Gruppe Jusstudenten aus acht pazifischen Inselstaaten. 2019 beschlossen sie, ihr letztes Studienjahr an der University of the South Pacific für etwas wirklich Bedeutsames in Sachen Klimagerechtigkeit zu nutzen. Etwas, das über Anreize, Richtwerte oder simple Verbotslösungen hinausgeht. Etwas Globales.
Die Studenten vertieften sich ins internationale Recht und machten sich schlau zu internationalen Rechtsmechanismen – auf der Suche nach einem juristischen Hebel.
Es seien vor allem die Frauen gewesen, sagt Yeo, die darauf gepocht hätten, gross zu denken und schliesslich das ehrgeizigste Vorhaben anzugehen, das ihnen einfiel: ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag (IGH) zur Relevanz des Klimawandels im internationalen Recht.
Als oberstes Rechtsprechungsorgan der Uno ist der IGH das höchste Weltgericht. Seine Hauptaufgabe besteht darin, zwischenstaatliche Streitigkeiten beizulegen. Darüber hinaus erstellt er Rechtsgutachten zu völkerrechtlichen Fragen. Diese sind zwar nicht bindend, jedoch prägend in der Entwicklung des internationalen Rechts.
Es ist allgemein unbestritten, dass es bezüglich Klimawandel im internationalen Recht Klärungsbedarf gibt, dass Lücken bestehen.
Die klaffendste ist für Yeo und seine Kommilitoninnen die fehlende Verknüpfung von Klimaschutz und Menschenrechten.
Klimagesetze und Menschenrechte, erklärt Yeo, hätten sich bislang getrennt voneinander entwickelt. Deshalb fehle es an griffigen Rechtsgrundlagen, um den Klimawandel in der Gesetzgebung und der Gerichtspraxis aus der Menschenrechtsperspektive zu betrachten.
Er ist überzeugt: «Für den Internationalen Gerichtshof wäre es ein Leichtes, diese Verbindung zu klären.» Anschauungsmaterial, case law, gebe es zum Thema genügend. Zum Beispiel sei das neue Klimagesetz der Fidschi-Inseln fest in den Menschenrechten verankert. Auch auf den Salomonen, wo gerade die Richtlinien für die Umsiedlung von Menschen infolge des Klimawandels ausgearbeitet würden, stünden die Menschenrechte im Mittelpunkt.
Die pazifischen Staaten, sagt Yeo, und viele Länder des Globalen Südens hätten längst erkannt: Der Klimawandel ist eine ernsthafte Bedrohung für die Menschenrechte. «Wir wissen: Wenn der nächste Zyklon kommt, könnten wir unser Leben verlieren.»
Anderswo betrachte man den Klimawandel nicht generell durch die Menschenrechtsbrille. Man tue sich noch schwer, den Zusammenhang anzuerkennen.
Die wohlhabenden Länder des Nordens sieht er besonders in der Pflicht, die Menschenrechte angesichts des Klimawandels zu sichern. Sie sollen nicht nur die eigenen Bürger schützen, sondern alle. Vor allem die verletzlichsten, die nicht in der Lage sind, für sich selbst sorgen zu können.
Nicht nur, fügt Yeo an, weil ihnen schlicht die Mittel fehlten. «Wollte man kleinlich sein», sagt er, «müsste man den reichen Staaten in diesem Zusammenhang die Kolonialgeschichte vorhalten. Sie verfolgt uns bis heute und ist mitverantwortlich dafür, dass wir von Anfang an schlechtere Karten hatten.»
Wie, fragt er, soll ein Land die Grundrechte seiner Bürgerinnen sicherstellen, wenn seine Wirtschaft ständig zertrümmert wird? «Stell dir vor, ein Zyklon würde in der Schweiz oder in Deutschland binnen Stunden 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts wegwaschen!»
Wie Zyklon Pam 2015 im Inselstaat Vanuatu.
«How the hell are you going to recover from that?»
Dann kommt 2020 Zyklon Harold.
Aber um Entschädigungen, um «climate finance», betont Yeo, gehe es im angestrebten IGH-Rechtsgutachten nicht direkt. Das einzige diesbezügliche Ziel sei, dass den vom Klimawandel stark betroffenen Ländern nicht noch mehr finanzielle Lasten auferlegt werden.
Denn dies will Yeo festgehalten haben: Den Entwicklungsländern seien in den bisherigen Klimaabkommen 100 Milliarden Dollar pro Jahr zugesagt worden – doch es harze mit den Zahlungen. Und das müsse man auch noch wissen: Die meisten Mittel würden in Form von vergünstigten Darlehen gewährt. «Die reichen Länder, die Grossemittenten, zahlen also nicht wirklich für die Kosten, um den Klimawandel bewältigen zu können. Sie gewähren nur Kredite – und machen damit Profit.»
Ein langer Weg vor die Uno
Neben der Verbindung von Menschenrechten und Klimaschutz ist der andere inhaltliche Schwerpunkt der Kampagne die weltweite Durchsetzung des Prinzips der Generationengerechtigkeit.
Was bedeutet das für ihn?
Yeo antwortet mit einem Beispiel: «Wer eine Ölbohrfirma aufmachen will, muss dabei berücksichtigen, ob das künftigen Generationen schadet. Und sich fragen: Welche Auswirkungen haben das Geschäft und das Geld, das es generiert, auf die Erdatmosphäre? Läuft es dem 1,5-Grad-Ziel zuwider?»
Weiter führt er eine Überlieferung an aus der Kolonialgeschichte. Als ein britischer Verwalter einen salomonischen Ureinwohner fragte, wie viel sein Land kosten würde. Und dieser die Frage ungeheuerlich fand. Er habe geantwortet: «In unserer Kultur haben wir Land immer als etwas betrachtet, das wir pflegen müssen, damit wir es in Zukunft an die nächste Generation weitergeben können.»
Generationengerechtigkeit soll nach Ansicht der pazifischen Jusstudenten Völkergewohnheitsrecht werden. Das Rechtsgutachten soll diesen Prozess beschleunigen, begonnen habe er ja längst, so Yeo. «Schau dir das Verfassungsrecht in Deutschland an, in Südafrika oder Bolivien.» Es widerspiegle bereits heute die Überzeugung, dass es nicht angehe, dass sich die heutige Generation auf Kosten der künftigen ein schönes Leben macht.
All das packten die pazifischen Studentinnen in eine Rechtsschrift, die sie an ihre Regierungen verschickten. Sie klemmten sie unter den Arm und sprachen nervös und overdressed erst beim Oppositionsführer in Vanuatu vor, dann beim Präsidenten, schliesslich beim Pacific Islands Forum, einem Konsultativausschuss der pazifischen Inselstaaten zur Förderung der Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft und Kultur.
Yeo amüsiert die Erinnerung an diese Meetings. Die Wege seien sehr direkt auf den kleinen Inseln. «Dein Onkel könnte der Premierminister sein, Tantchen trifft sich vielleicht regelmässig mit ein paar Ministern zum Tee.»
Inzwischen ist der lose Studentenbund von damals zu einer grossen regionalen NGO geworden: eben der Pacific Islands Students Fighting Climate Change. Und ihre studentische Kampagnenschrift bildet nun die Grundlage für eine Uno-Resolution.
Unter der Federführung von Vanuatu soll sie anlässlich der 77. Uno-Generalversammlung den 193 Mitgliedsstaaten vorgelegt werden, die am 13. September eröffnet wird. Dass der Vorstoss aus Vanuatu kommt, ist dem Umstand geschuldet, dass sich dort die Rechtsfakultät der University of the South Pacific befindet. Die ganze Uni erstreckt sich über zwölf pazifische Inselstaaten; darunter Nauru, Kiribati, Tuvalu. Die School of Agriculture and Food Technology befindet sich auf Samoa. Yeo hat am Hauptstandort Fidschi Politikwissenschaften und auf Vanuatu Jus studiert.
Das sind ja ganz schöne Distanzen, sage ich, mir die Pendelei vorstellend.
Und Yeo: «Wir sagen, der Ozean trennt uns nicht, er verbindet uns.»
Dass der Vorstoss aus Vanuatu Erfolg hat, ist die Voraussetzung dafür, dass der IGH sich mit der Klimafrage befasst. Damit der höchste Uno-Gerichtshof nämlich tätig werden kann und tatsächlich ein Rechtsgutachten erstattet, muss eine Mehrheit der Staaten einen entsprechenden Antrag stellen.
Für den Antrag muss eine konkrete Frage ans Gericht ausformuliert werden. Derzeit wird in New York über den genauen Wortlaut gefeilscht. Und der ist: Streng geheim! Zu den laufenden Verhandlungen darf Solomon Yeo nichts sagen.
Der politische Wille
Bisher hatte die Weltgemeinschaft wenig Gehör, wenn es um die Anliegen der vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten ging. Der Archipel Palau drängte die Uno-Vollversammlung schon 2012 auf eine Rechtsklärung durch den IGH. Damals zeichnete sich vor der Abstimmung ab, dass das Anliegen keine Chance hat. Der Inselstaat verzichtete darauf, den Antrag zu stellen.
Glaubt Yeo, dass es dieses Mal zur Abstimmung kommen wird?
«Wir sind nur zu 101 Prozent überzeugt», lächelt er.
Was macht ihn so zuversichtlich?
Da sei erstens der grosse Support des Pacific Islands Forum, dem auch Australien und Neuseeland angehören. Und die 1500 Graswurzel-Organisationen, die sich rund um den Globus dafür starkmachen, dass sich ihre Länder hinter die Initiative Vanuatus stellen. Bisher sind es 79 Staaten. Notwendig sind 97. «Etwas Überzeugungsarbeit müssen wir noch leisten», sagt Yeo.
Ob ihn die Langsamkeit des Prozesses nicht manchmal frustriere, frage ich.
Schon, sagt er. Sehr sogar. Seit 26 Jahren kämpften Menschen aus den pazifischen Inselstaaten und vielen anderen Entwicklungsländern für Klimagerechtigkeit. Wesentliche Fortschritte seien keine zu erkennen.
Nun habe Covid gezeigt: Ist der politische Wille vorhanden, ist alles möglich.
«Da fragen wir uns schon: Warum geht das nicht auch bezüglich des Klimawandels? Wo liegen die Prioritäten in der Welt? Sind Profite wichtiger als Menschenleben?»
Vor allem: «Warum ist es so schwierig, Empathie für uns zu empfinden?»
Es sei doch nicht schwer zu begreifen: Alle hätten dasselbe Problem. Yeo staunt über die schon fast sture Weigerung vielerorts, diese Tatsache zu akzeptieren. Vielleicht, sinniert er, verstünden es die Europäerinnen, wenn eines Morgens kein Kaffee mehr auf dem Tisch stehe. Weil die Anbauländer in Afrika und Südamerika aufgrund des Klimawandels im Chaos versänken.
«Egal, wie hoch du deine Mauer baust», sagt er, «und egal, wie weit du auf deine Berge kletterst: Vor dem Klimawandel wird niemand sicher sein.»
Illustration: Till Lauer