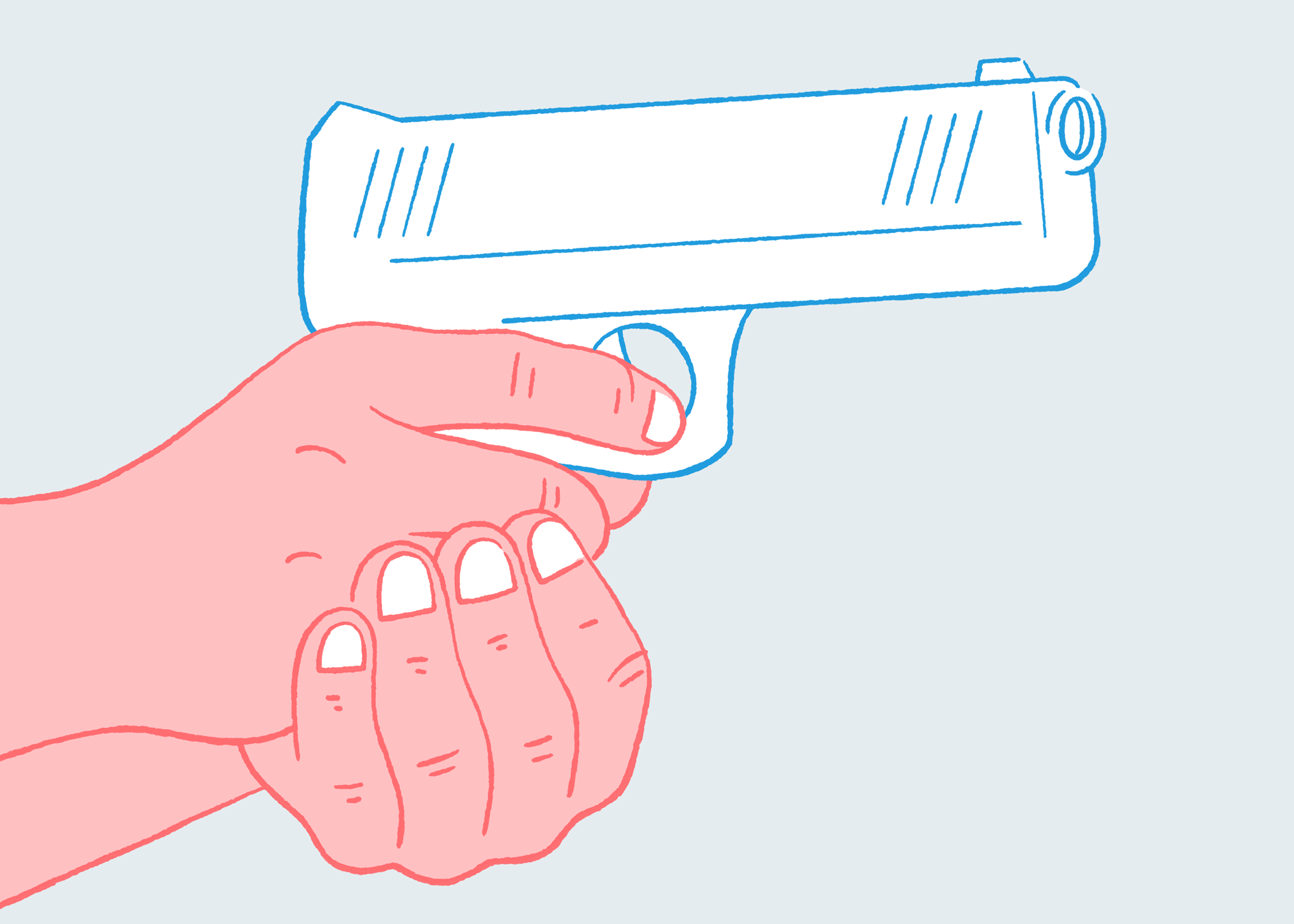
«Die Polizei ist eine Art Fremdkörper in der Demokratie»
Die Polizei darf Gewalt ausüben, manchmal tötet sie sogar. Wer setzt ihr Grenzen? Strafrechtsprofessor Tobias Singelnstein über die Erschiessung eines schwarzen Jugendlichen in Dortmund und darüber, wie eine ideale Polizei aussähe.
Von Brigitte Hürlimann, Basil Schöni (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 30.08.2022
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Elf Polizisten, ein Jugendlicher. Am späten Nachmittag des 8. August rücken in der deutschen Metropole Dortmund bewaffnete Uniformierte aus, nachdem sie von einem Betreuer einer katholischen Jugendwohngruppe alarmiert worden sind: Einer der Bewohner, der 16-jährige Senegalese Mouhamed Lamin Dramé, sei im Innenhof der Einrichtung mit einem Messer gesehen worden.
Kurze Zeit später ist der Junge tot. Was genau passiert ist, wird derzeit strafrechtlich untersucht. Fest steht: Einer der Polizisten war mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Er drückte sechsmal ab. Fünf Schüsse trafen den psychisch angeschlagenen Jugendlichen in Bauch, Arm, Schulter und Kiefer. Dramé stirbt noch während der Notoperation im Spital.
2020 seien in Deutschland fünfzehn Menschen durch Polizeikugeln ums Leben gekommen, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». Im gleichen Zeitraum sei ein Polizist im Dienst gestorben.
Der Vorfall von Dortmund hätte auch in der Schweiz passieren können. Vor einem Jahr war einem Bahnmitarbeiter im waadtländischen Morges ein Mann aufgefallen, der sich auf den Gleisen aufhielt. Der Angestellte rief die Polizei, weil er befürchtete, der Mann könnte sich etwas antun. Als die Polizei am Bahnhof eintraf, soll der 37-jährige Roger Nzoy ein Messer gezogen haben, als er auf die Uniformierten zueilte. Ein Polizist schoss dreimal, Nzoy starb noch vor Ort. In den Wochen vor dem Vorfall hatte er an paranoiden Schüben gelitten.
Ende Dezember 2015 feuerte die Zürcher Stadtpolizei dreizehn Schüsse auf den Äthiopier Omar Mussa Ali ab, der mit einem Küchenmesser in der Hand durch die Strassen irrte – ohne jemanden zu bedrohen. Der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Seine Partnerin hatte die Polizei alarmiert und darum gebeten, Ali zu suchen und in ein Spital zu bringen. Doch als der Kranke von fünf bewaffneten und uniformierten Polizisten konfrontiert wurde, schrie er «Kill me, kill me!» und ging mit dem Messer auf die Polizisten zu. Zwei von ihnen schossen. Ali überlebte wie durch ein Wunder.
Warum gelingt es der Polizei immer wieder nicht, angemessen mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen umzugehen? Warum kommt es gerade in solchen Konstellationen zu Todesfällen? Und ist es Zufall, dass auffallend häufig People of Color von Polizeigewalt betroffen sind? Dramé, Nzoy, Ali – um nur drei Namen zu nennen.
Tobias Singelnstein ist Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er forscht unter anderem zur Polizeigewalt und hat diesen Frühling zusammen mit dem Berliner Rechtsanwalt Benjamin Derin das Sachbuch «Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt» veröffentlicht. «Alles in allem ist die Polizei nicht nur eine der mächtigsten Organisationen in unserer Gesellschaft, sondern auch eine, die besonders schwer zu kontrollieren ist», schreibt das Autorenduo. Die Republik hat Tobias Singelnstein in Frankfurt zum Gespräch getroffen.
Herr Singelnstein, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie hörten, dass die Polizei in Dortmund einen Jugendlichen getötet hat?
Spontan habe ich gedacht: o Gott, schon wieder.
Warum?
Weil es eine typische Konstellation ist. Es geht um einen Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation, und es ist ein Messer im Spiel. Solche Situationen haben wir in den vergangenen Jahren häufiger gesehen. Sie führen immer wieder zu tödlichen Schusswaffeneinsätzen. Besonders tragisch ist, dass es sich um einen Jugendlichen handelt.
Welche Rolle spielte es, dass die Polizei in ein sogenanntes Problemquartier ausrückte?
Wir wissen nicht, was in den Köpfen der Beamten vorgegangen ist. Aber es liegt nahe, davon auszugehen, dass sie mit einem anderen Erfahrungshintergrund dorthin fahren, als wenn sie in ein gutbürgerliches Viertel ausrücken. Wenn die Polizei hört: Es geht um eine schwarze Person mit einem Messer in einem Problemquartier, dann erzeugt das andere Bilder, als wenn es heisst, es handelt sich um eine weisse Frau mittleren Alters mit einem Messer in einem gutbürgerlichen Viertel.
In Dortmund trafen elf bis an die Zähne bewaffnete Polizistinnen auf einen Jugendlichen.
Der Gedanke kommt einem schon, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn zunächst vielleicht zwei Beamte die Szene betreten und sich die Lage angeschaut hätten; mit dem Ziel, zu deeskalieren. In dem Augenblick, wenn die Polizei als grosse Übermacht sichtbar in Erscheinung tritt, wird schon eine Eskalation in Gang gesetzt.
Der Polizist, der sechsmal auf den Jugendlichen schoss, hat eine Maschinenpistole benutzt.
Das ist bemerkenswert. Von der Wirkung her macht es zwar nicht unbedingt einen grossen Unterschied, ob mit der normalen Dienstwaffe oder mit der Maschinenpistole geschossen wird. Auch die normale Dienstwaffe wird eingesetzt, bis die Person gestoppt ist. Aber man fragt sich, mit was für einem Bild die Polizisten zu diesem Einsatz gehen, dass sie denken, sie müssen eine Maschinenpistole mitführen. Die befindet sich im Auto, die musste vorher noch ausgepackt werden. Warum packen sie diese aus, obwohl ja alle schon am Körper eine Schusswaffe tragen?
Was ist Ihre Erklärung?
Es sind verschiedene Szenarien denkbar. Vielleicht gab es ungenügende Informationen, und deshalb sind die Beamten vom Schlimmsten ausgegangen: Es hätte beispielsweise ein Amoklauf sein können. Oder man hat die Situation falsch eingeschätzt. Es sieht, Stand heute, jedenfalls nicht danach aus, als wäre es darum gegangen, den 16-Jährigen in seiner psychischen Ausnahmesituation zu beruhigen und die Situation so in den Griff zu bekommen.
Der Jugendliche konnte kein Deutsch. Wie soll da eine Kommunikation und damit eine Deeskalation möglich sein?
Wenn keine unmittelbare Gefahr für die Beteiligten und für Dritte besteht, könnte die Polizei einen Dolmetscher oder einen sozialpsychiatrischen Dienst beiziehen. Doch das fällt den Beamten oft schwer. Sie schauen durch eine ganz bestimmte Brille: Recht, Ordnung und die Beseitigung einer Gefahr stehen im Vordergrund. In der Polizeiausbildung geht es nicht in erster Linie darum, dass man die Situation sichert, beruhigt und dann abwartet. Die Polizistinnen wollen die Gefahr so rasch wie möglich beseitigen. Es gibt eine Situation mit einem Messer, die muss geklärt werden.
Das heisst, die Polizei ist nicht die richtige Organisation, die in einer solchen Situation als erste vor Ort sein sollte?
Genau. Und zwar gerade dann, wenn es um Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation geht, die unter Umständen nicht mehr wissen, was sie tun. Sie wollen vielleicht niemanden verletzen und handeln erst, wenn sie sich bedroht fühlen. Sie stellen weniger eine Gefahr dar, sondern benötigen vor allem Hilfe. Es bräuchte jemanden, der sich mit psychischen Ausnahmezuständen auskennt und professionell handeln kann. Und mit einem anderen Fokus vorgeht.
Wer könnte das sein?
Psychologinnen, Psychiater, ein sozialpsychiatrischer Dienst. Anders als die Polizei sind solche Fachkräfte jedoch nicht rund um die Uhr und nicht so schnell verfügbar. Deshalb wird in einer Situation wie in Dortmund die Polizei gerufen. Aber die Beamtinnen wollen eine Gefahr beseitigen und sehen oft nicht, dass jemand Hilfe braucht. Dafür sind sie nicht in erster Linie ausgebildet.
Stattdessen rüstet sich die Polizei immer mehr auf. Das wirkt nicht gerade beruhigend.
Um auf Dortmund zurückzukommen: Es war ein Messer im Spiel, das ist ein gefährliches Werkzeug, es kann schnell zu tödlichen Verletzungen führen. Polizeibeamte werden für solche Situationen auf Eigensicherung trainiert. Sie sollen schiessen, wenn sie den Eindruck haben, dass sie angegriffen werden, und wenn eine bestimmte Distanz unterschritten wird. Und sie sollen so schiessen, dass die Person gestoppt wird. Was in der Regel den Tod der mutmasslich angreifenden Person zur Folge hat.
Das ist unabdingbar?
Der Schlüssel liegt in den Minuten oder Stunden zuvor. Schafft man es, die Situation zu beruhigen, bevor die Eskalationsspirale zu drehen beginnt? Dabei sind Einsatzmittel und Waffen grundsätzlich problematisch, weil sie die ganze Interaktion beeinflussen. Wird Pfefferspray eingesetzt und dann der Taser benutzt, führt das zu Reaktionen auf der anderen Seite. Wenn dieser Automatismus eingesetzt hat, ist es oft zu spät. Gerade wenn es um Menschen in psychischen Ausnahmesituationen geht.
Die Polizei ist darauf trainiert, zu schiessen, wenn sie sich von jemandem angegriffen fühlt, der ein Messer in der Hand hält?
Das ist der Stand der Ausbildung. Ich habe volles Verständnis dafür, dass Polizeibeamte auf ihre Sicherheit achten müssen. Sie üben einen Beruf aus, der gefährlich sein kann. Aber Eigensicherung hat auch eine negative Seite. Eine umfassende Schutzausrüstung, das Mitführen und der Einsatz von ganz verschiedenen Mitteln und Waffen wirken sich nicht nur schützend für die Beamtinnen aus. Es verändert auch, wie die Polizei wahrgenommen wird. Und es beeinflusst das gesamte Interaktionsgeschehen zwischen Polizei und Bürgerinnen.
Beim Vorfall in Dortmund trugen die Polizisten Bodycams. Doch keine einzige Kamera war eingeschaltet.
Ursprünglich stammen Bodycams aus den USA. Dort war die Idee, das polizeiliche Handeln kontrollierbar zu machen. Die Geräte laufen die ganze Zeit, um später nachvollziehen zu können, was passiert ist.
Und warum ist das in Deutschland nicht der Fall?
Das geht aus Datenschutzgründen nicht. Der Staat darf nicht ohne Anlass filmen. Die Kameras müssen also an- und ausgeschaltet werden. Die Bundesländer regeln das unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen, zu dem Dortmund gehört, entscheiden die Beamten im Prinzip selbst, wann und für wie lange sie die Bodycams einschalten.
Sie entscheiden selbst? Das klingt wie ein Witz.
Ja. Und damit können Bodycams praktisch kaum zur Kontrolle polizeilichen Verhaltens beitragen. Im Gegenteil. In Deutschland werden sie als Schutz für die Polizei betrachtet. Da sind sich die mächtigen Polizeigewerkschaften und weite Teile der Politik einig. So wurde der Einsatz von Bodycams in arbeitsrechtlichen Vereinbarungen, aber auch in vielen Gesetzen geregelt. In manchen Vereinbarungen steht ausdrücklich drin, dass Bodycams nicht dafür genutzt werden dürfen, um die Beamten zu überwachen – sondern als Beweismittel gegen Bürger, die im Konflikt mit der Polizei standen.
Welche Chance haben Bürgerinnen, wenn sie sich gegen Gewalt durch Polizisten wehren möchten?
Die Chancen sind sehr schlecht. In Deutschland werden nur 2 Prozent der angezeigten Fälle von «Körperverletzung im Amt» vor Gericht gebracht. Körperverletzungen von «gewöhnlichen Bürgern» haben eine Anklagequote von etwa 20 Prozent. Bei Sexualstraftaten, wo es eine ähnliche Beweisproblematik gibt wie bei den Polizeifällen, weil oft Aussage gegen Aussage steht, sieht es ähnlich aus. Die 2 Prozent bei der «Körperverletzung im Amt» sind einmalig gering. Und wir sprechen hier nur vom Hellfeld, also von jenen Fällen, die bekannt werden. Unsere Forschung zeigt, dass ein Grossteil der Fälle mutmasslich rechtswidriger Polizeigewalt gar nicht angezeigt wird. Auf jeden angezeigten Fall kommen mehrere, die nicht in der Statistik landen.
Warum ist das so?
Die Betroffenen können die Polizisten nicht identifizieren, haben Angst vor einer Gegenanzeige oder davor, dass man ihnen nicht glaubt. Sie gehen davon aus, dass sie in einem Verfahren gegen Polizisten keine Chance haben.
Das Dunkelfeld ist also gross, die Anklagequote einmalig tief. Wenn Polizisten trotz allem vor Gericht kommen, wie oft werden sie schuldig gesprochen?
Auch das kommt im Vergleich mit anderen Strafverfahren deutlich seltener vor.
Wie wird das Vorgehen der Polizei in Dortmund in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen?
Der Vorfall wird kritisch hinterfragt. Die grosse Mehrheit ist sich einig, dass das Ergebnis nicht gut ist – unabhängig davon, was schiefgelaufen ist und ob man den Beamtinnen strafrechtlich einen Vorwurf machen kann. Jetzt muss man die Resultate der Untersuchung abwarten.
Der Vorfall wird von der Polizei einer benachbarten Region untersucht, federführend ist wie immer die Staatsanwaltschaft, die im Alltag eng mit der Polizei zusammenarbeitet. Kann man da von einer unvoreingenommenen Untersuchung sprechen?
Nordrhein-Westfalen hat sich für die zweitschlechteste Lösung entschieden. Es ermittelt zwar nicht die genau gleiche Polizeidienststelle – das wäre die schlechteste Lösung –, aber jene aus der Nachbarschaft. Andere Bundesländer haben das besser organisiert. Dort gibt es spezielle, unabhängige Dienststellen, die für polizeiinterne Ermittlungen zuständig sind. Ausserdem gibt es in manchen Ländern unabhängige Polizeibeauftragte, die vom Parlament ernannt werden. Das Problem ist aber, dass diese unabhängigen Stellen nur für niederschwellige Fälle zuständig sind – wenn ein Beamter unfreundlich war zum Beispiel. Bei Tötung oder Gewalt untersuchen dann wieder Polizei und Staatsanwaltschaft.
Die Zweifel der Öffentlichkeit sind also begründet.
Die Aufarbeitung des Dortmunder Vorfalls wird zu Recht beargwöhnt, ja. Das wäre in jedem anderen Bereich auch so, wenn Kollegen mögliche schwere Fehler von Kollegen beurteilen müssten, ohne Blick von aussen. Bei der Polizei ist das besonders problematisch – nicht zuletzt wegen der cop culture: Es gibt innerhalb der Polizei ein ungewöhnlich starkes Zusammengehörigkeits- und Loyalitätsgefühl. Polizistinnen sind für andere Polizistinnen keine normalen Beschuldigten. Das gilt aber auch für die Staatsanwaltschaften und für die Gerichte. Der Staat tut sich schwer damit, seine Bediensteten bei einem Fehlverhalten zur Verantwortung zu ziehen.
Wie stark prägt diese cop culture die Polizeiarbeit?
Sie spielt eine sehr grosse Rolle. Sie prägt, wie Polizisten die Welt und ihre Arbeit darin sehen, auch in Bezug auf Zusammenarbeit und Fehlverhalten. Es gibt eine Art kollegiale Grundannahme, dass die anderen schon rechtmässig und richtig handeln. Die Polizei tut sich daher schwer damit, das Verhalten von Kollegen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Noch schwerer fällt es ihr, dies nach aussen, gegenüber der Gesellschaft, zu tun.
Die Polizei ist nicht besonders kritikfähig.
Nein, das kann man leider wirklich nicht sagen. Was in vielen anderen Bereichen und Organisationen längst normal geworden ist, findet bei der Polizei nicht statt: Es gibt keine angemessene Fehlerkultur.
Was braucht es, um das zu ändern?
Ich hoffe, dass mit der jüngeren Polizistengeneration eine bessere Fehlerkultur etabliert werden kann. Es muss zum Selbstverständnis gehören, dass Fehler passieren. Das ist der wichtigste Schritt. Aber die Polizei hat Angst davor, Fehler einzugestehen, weil sie glaubt, Legitimität zu verlieren. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, denn die Polizei ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung ihr Handeln als legitim anerkennt. Doch es funktioniert einfach nicht mehr, Fehler unter den Teppich kehren zu wollen. Da leidet die Legitimität der Polizei unter Umständen stärker: wenn alle die Probleme sehen und die Polizei gleichwohl so tut, als wäre alles in Ordnung. Dazu kommt, dass die Gesellschaft einen Anspruch darauf hat, dass sich die Polizei mit Problemen und Fehlern angemessen und transparent auseinandersetzt.
Warum kann sich die Polizei ein solches Verhalten leisten?
Polizistinnen haben das Selbstbild, dass sie die Guten sind, dass sie grundsätzlich richtig und rechtmässig handeln. Dieses Selbstverständnis wird von der Politik stark gefördert. Sie tut sich schwer damit, die Polizei zu kritisieren. Denken Sie an die Worte von Olaf Scholz nach dem G-20-Gipfel und den Ausschreitungen in Hamburg: «Polizeigewalt hat es nicht gegeben.» Oder Horst Seehofer vor zwei Jahren: «Racial profiling gibt es nicht, weil es rechtswidrig ist.» Dabei ist beides vielfach belegt, durch Bilder, Betroffenenberichte und wissenschaftliche Untersuchungen.
Umfragen ergeben immer wieder, dass die Polizei grosses Vertrauen in der Bevölkerung geniesst.
Wenn man allgemein fragt, sagen etwa 80 Prozent, dass sie der Polizei vertrauen. Man muss aber differenziert hinschauen und nachfragen. Unter diesen 80 Prozent gibt es viele, die trotzdem davon ausgehen, dass die Polizei ein Problem mit Rassismus hat oder dass es zu rechtswidriger Gewalt kommt. Man kann der Organisation insgesamt vertrauen und trotzdem sagen: Ihr habt Probleme, und ich erwarte als Bürger, dass ihr diese Probleme löst, damit ich euch weiter vertrauen kann.
Wer sind die 20 Prozent, die der Polizei nicht vertrauen?
Das sind Gruppen, die eher negative Erfahrungen mit der Polizei machen. Randgruppen, Minderheiten, politische Aktivistinnen, Fussballfans, Arme, People of Color, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Für sie ist die Polizei oft keine Institution, die schützt, sondern eine, vor der sie sich in Acht nehmen müssen. Damit sind wir wieder beim Thema «Problemviertel»: Die Beamtinnen haben möglicherweise einen anderen Blick, wenn sie dort eine schwarze Person sehen. Und behandeln die Menschen dann anders. Stichwort racial profiling: Es gibt Leute, für die gehört es zum Alltag, von der Polizei kontrolliert zu werden. Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich werde nie von der Polizei kontrolliert.
Inwiefern hat das auch mit der Zusammensetzung der Polizei zu tun?
Tatsächlich ist die Polizei in Deutschland – und auch in der Schweiz – mehrheitlich männlich, weiss und politisch eher konservativ geprägt. Die Diversität ist zwar besser als noch vor zwanzig oder dreissig Jahren, aber längst nicht ausreichend. Aber Diversität allein führt nicht unbedingt zu weniger Diskriminierung und hebt den strukturellen Rassismus in der Polizei nicht auf. Das sieht man in den USA.
Wo liegt das Problem?
Es gibt in der Polizei ein massives Wissensdefizit, was strukturellen Rassismus, unbewusste Stereotype und Vorurteile betrifft. Die Beamtinnen erkennen oft nicht, wie stark ihre Arbeit mit solch weniger offenen Formen von Rassismus verwoben ist. Sie reagieren mit grosser Irritation und Abwehr, wenn man ihnen sagt, sie diskriminierten und seien rassistisch. Für viele ist Rassismus eine bewusste Ideologie der Abwertung; etwas, was Rechtsextremisten machen. Doch wenn man einen derart wichtigen Job macht wie die Polizei, der mit einer Gewaltlizenz verbunden ist und mit der Befugnis, in die Grundrechte anderer einzugreifen, dann muss man sehr genau wissen, was man tut. Und warum.
Stimmt der Eindruck, dass sich die Polizei lieber mehr Aufgaben zuschanzt, als dass sie Aufgaben loswerden möchte?
Ja, obwohl sie sagt, sie sei überlastet und brauche deshalb mehr Personal, mehr Technik und mehr Ausrüstung. Wenn man ihnen Bereiche wegnehmen will, ist es auch nicht recht. Die Polizei möchte nicht an Status, Macht und Einfluss verlieren. Sie wird tatsächlich immer grösser und bekommt immer mehr Befugnisse, nicht nur in Deutschland.
Warum eigentlich? Gibt es mehr Kriminalität?
In Deutschland nicht, wir registrieren in den letzten Jahren einen Rückgang der bekannt gewordenen Straftaten. Ohnehin macht die Kriminalität nur einen kleinen Teil der Polizeiarbeit aus, viel weniger als Verwaltung, Gefahrenabwehr und Präsenz auf der Strasse zeigen. Der Ausbau hängt also nicht damit zusammen, dass es mehr Aufgaben für die Polizei gäbe. Es geht eher ums Sicherheitsbedürfnis der bürgerlichen Gesellschaft, das zunimmt. Die Polizei ist eine mächtige Organisation, die zu betonen weiss, dass sie wichtig ist. Und politische Prozesse beeinflussen und prägen kann. Die Politik arbeitet eng mit der Polizei zusammen. Sie ist auf die Unterstützung der Polizei angewiesen.
Warum?
Schauen Sie die Grössenordnung an: In Deutschland arbeiten rund 300’000 Menschen bei der Polizei. Das ist ein Riesenapparat, der viel Einfluss hat, gut und eng vernetzt ist. Zumindest in der Innenpolitik kann man eigentlich gar nicht gegen die Polizei agieren.
Was ist der Grund dafür?
Weil die Polizei den Politikerinnen das Leben ganz schön schwer machen kann. Es gab den einen oder anderen Innenpolitiker, der gehen musste, weil er keine Unterstützung vom Polizeiapparat hatte. Die Politiker brauchen diesen Rückhalt. Den bekommen sie nicht, wenn sie ständig die Polizeiarbeit hinterfragen, eine Fehlerkultur fordern oder Budgets kürzen. Also machen die Politikerinnen Zugeständnisse, erfüllen Wünsche und bemühen sich um die Polizei. Ein interessantes Beispiel ist Saskia Esken, die SPD-Co-Vorsitzende, die vor zwei Jahren öffentlich sagte, es gebe auch in der deutschen Polizei latenten Rassismus. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen: Das war eine sehr banale Feststellung. Aber Saskia Esken musste die Aussage zurücknehmen und öffentlichkeitswirksam eine Polizeischule besuchen. Der Druck war enorm. In den Augen der Polizei hatte sie etwas Schreckliches, etwas Unsagbares geäussert.
In Ihrem Buch, das diesen Frühling erschien, ziehen Sie das Fazit, Demokratie und Polizei passten nicht besonders gut zusammen.
Die Polizei gibt es ja in den unterschiedlichsten Staatsformen, etwa auch in Russland. Und die Polizeiarbeit beinhaltet Tätigkeiten, die mit unserem demokratischen Verständnis eigentlich nicht zusammenpassen. Freiheit, Gleichheit, Gewaltfreiheit oder Konsens machen eine demokratische Gesellschaft aus. Die Polizei ist in mancher Hinsicht genau das Gegenteil: Sie schränkt Freiheiten ein, reproduziert Ungleichheiten, setzt Gewalt ein und sorgt nicht für Konsens. Sie entscheidet autoritativ; so, wie sie es für richtig hält. Das ist natürlich politisch gewollt und der Auftrag der Polizei. Aber sie ist damit dennoch eine Art Fremdkörper in der Demokratie und darin, wie wir uns das Zusammenleben vorstellen.
Deshalb braucht es Ihrer Meinung nach eine «Einhegung» der Polizei. Was meinen Sie damit?
Dass die Gesellschaft versucht, die Polizei in ihrer Machtfülle, ihrer Grösse und in ihrer Bedeutung einzugrenzen. Das ist mit verschiedenen Instrumenten möglich; rechtlich, aber auch durch eine zivilgesellschaftliche, eine mediale und eine politische Kontrolle. Wenn sich die gesellschaftlichen Widersprüche zuspitzen und die Polizei grösser, mächtiger und gleichzeitig unkontrollierbar wird, kann das fatal enden.
Wie gut gelingt die «Einhegung» der Polizei?
Wir haben heute eine Organisation, die relativ demokratisch ist. Die Polizei hat sich professionalisiert, akademisiert und stark verjüngt. Doch das bleibt eine permanente Arbeit. Die Polizei ist nicht per se demokratisch und tendiert dazu, sich in eine schlechte Richtung zu entwickeln. Stichwort cop culture. Deshalb ist eine Einhegung so wichtig.
Nach all dieser Kritik: Wie könnte eine ideale Polizei aussehen?
Ich würde versuchen, die Polizei auf ein Kerngeschäft zu reduzieren. Die Gesellschaft muss die Situationen definieren, für die sie eine bewaffnete und rund um die Uhr verfügbare Einheit im Einsatz haben will. Und dann muss sie sich überlegen, wie alle anderen Probleme zu lösen sind, die heute bei der Polizei landen. Denn vieles davon sind letztendlich soziale Konflikte und gesellschaftliche Probleme, die man anders angehen könnte. Die Polizei löst das Problem der Armut, der Obdachlosigkeit, der Migration oder der Drogensucht nicht. Sie kann das gar nicht. Die Polizei kann solche Probleme nur stummstellen.
Hinweis: In einer früheren Version schrieben wir über die Ereignisse in Dortmund, die Polizei sei informiert worden, einer der Bewohner fuchtle draussen auf der Strasse mit einem Messer rum. Korrekt ist, dass die Meldung lautete, einer der Bewohner sei im Innenhof der Einrichtung mit einem Messer gesehen worden.
Zur weiterführenden Literatur
Benjamin Derin, Tobias Singelnstein: «Die Polizei: Helfer, Gegner, Staatsgewalt. Inspektion einer mächtigen Organisation». Econ/Ullstein, Berlin 2022. 448 Seiten, ca. 38 Franken.