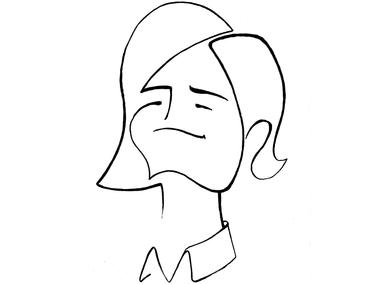

Traditionell, progressiv, Amok: Was ist bürgerlich?
Der Schweizer Politikbetrieb kommt wieder in Fahrt. Und wirft ein paar grundsätzliche Fragen auf zur Zukunft unseres Landes.
Von Daniel Binswanger, 27.08.2022
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Die Schweiz ist seit der Gründung des Bundesstaates 1848 und bis zum heutigen Tag ein zutiefst bürgerliches Land. Wenn nicht eine explosive Beschleunigung der Klimakatastrophe die politischen Kräfteverhältnisse plötzlich revolutioniert – eine Entwicklung, die man nicht mehr ausschliessen, aber sicher nicht herbeiwünschen sollte –, wird das auf absehbare Zukunft so bleiben. In ganz Europa – mit Ausnahme von Luxemburg – dürfte die Eidgenossenschaft das einzige Land sein, das noch nie eine linke Regierung hatte. Der wahre Schweizer Sonderfall: die permanente rechte Mehrheit.
Natürlich muss man diese Tatsache in Teilaspekten relativieren. Mit rund 30 Prozent der Stimmen haben die linken Kräfte in der nationalen Politik durchaus gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, zumal die Sozialdemokraten (und dereinst vielleicht auch die Grünen) ein Teil der Konkordanzregierung sind. Mit den Instrumenten der direkten Demokratie können sie ihre klare parlamentarische Unterlegenheit immer mal wieder kompensieren. Last but not least: Dass Rot-Grün sämtliche grossen Städte regiert, ist ein bedeutender Machtfaktor. Die Schweiz steht unter bürgerlicher Dauerherrschaft. Aber die linken Einflusszonen sind beträchtlich.
Dennoch: Die Gesundheit, das Entwicklungspotenzial, das Entgleisungsrisiko der Schweizer Demokratie hängt primär an den Kräften aus dem Mitte-rechts-Lager, noch viel stärker als in irgendeinem anderen europäischen Staat. Zwei Ereignisse dieser Woche werfen ein grelles Schlaglicht auf den aktuellen Zustand der bürgerlichen Schweiz. Und stimmen, was das Entwicklungspotenzial betrifft, nicht eben optimistisch.
Da war zunächst das famose «Weltwoche»-Sommerfest, das – wenn wir den albernen (und vermutlich völlig falsch erzählten) Lauwarm-Gig einmal beiseitelassen – in zweierlei Hinsicht symptomatisch erscheint. Zum einen ist es bemerkenswert, wie stark der Rechtsradikalismus inzwischen paneuropäisch konsolidiert wird und welch prominente Rolle die Zürcher Drehscheibe dabei einzunehmen scheint. Jetzt reisen sie wirklich alle an: Alice Weidel, Alexander Gauland, Hans-Georg Maassen. Die oberste Garde der alleräussersten parlamentarischen Rechten in der Bundesrepublik.
Der Ukraine-Krieg hat der ideologischen Konvergenz zwischen SVP und AfD noch einmal gewaltig Schub verliehen. Unmittelbar nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine sprach Alice Weidel bekanntlich vom «historischen Versagen» des Westens – nicht Russlands, sondern des Westens –, der die russische Führung «gekränkt» haben soll. Roger Köppel hatte zeitgleich exakt denselben Diskurs. «Das wichtigste Thema sind die kolossalen Fehler, die Dummheiten, die Überheblichkeiten, die Demütigungen, die der Westen gegenüber Russland gemacht hat», heisst es in der Köppel-Version.
Auch die ideologische Basis dieser «differenzierten» Russland-Beurteilung ist weitestgehend identisch.
Weidel gelangte zu erstem politischem Ruhm, als sie als frisch gekürte AfD-Spitzenkandidatin in einer Brandrede in einen euphorischen Parteitagssaal den Ausruf schmetterte: «Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte!» Köppels Ode an den missverstandenen Putin gipfelt in dem Satz: «Putins Verbrechen besteht aus ihrer [der Journalisten und Intellektuellen] Sicht darin, dass er die grösste Schwäche des Westens aufgedeckt hat: politische Korrektheit.» Der Krieg in der Ukraine führt zu völliger Gesinnungsgenossenschaft zwischen SVP und AfD.
Diese Entwicklung hat sich allerdings schon lange angekündigt und wurde durch das geteilte Verständnis für den Kreml-Herrscher höchstens noch einmal beschleunigt. Etwas anderes ist sehr viel verblüffender: Das Schweizer Establishment lässt sich von alldem nicht im Allergeringsten die Festlaune verderben. Nicht FDP-Politiker wie etwa Ständerat Andrea Caroni oder Stadtrat Filippo Leutenegger. Nicht auf bürgerliche Respektabilität bedachte Sozialdemokraten wie Ständerat Daniel Jositsch. Sommerfest ist Sommerfest, und alle sind sie wieder hingeströmt. Ob mit den von weit her angereisten Ehrengästen entspannt über die «historische Schuld» des Westens geplauscht wurde?
Fast noch erstaunlicher als die Präsenz von Profipolitikern war allerdings die Anwesenheit von Honoratioren der Zivilgesellschaft.
Mit Michael Hengartner, Präsident des ETH Rats, war auch dieses Jahr wieder der vielleicht wichtigste institutionelle Vertreter des Schweizer Wissenschaftsstandortes unter den Gästen. Ob er die Gelegenheit nutzte, um sich mit dem Corona-Verschwörungstheoretiker und Youtube-Aktivisten Daniel Stricker endlich mal in Ruhe auszutauschen? Stricker ist unter anderem ein glühender Verehrer von Sucharit Bhakdi, und da hätte dann auch Hans-Georg Maassen noch einiges beizutragen gehabt.
Im Januar hat sich der CDU-Vorstand explizit von Maassen distanziert – auch ein Parteiausschluss wurde diskutiert – weil der Ex-Verfassungsschutzpräsident ein Video von Bhakdi über die sozialen Netzwerke verbreitete. Bhakdi ist nicht nur ein radikaler Impfgegner, sondern inzwischen wird auch wegen horrender antisemitischer Äusserungen gegen ihn ermittelt. Ob ETH-Rats-Präsident Hengartner, der als begnadeter Netzwerker gilt, Maassen und Stricker bei dieser günstigen Gelegenheit vielleicht ein paar biologische Grundbegriffe hat näherbringen können? Oder ob er sie – natürlich immer im höheren Interesse des Networkings – taktvoll ihre Theorien ausbreiten liess?
Sicherlich: Mit Leuten, deren Ansichten man nicht teilt, ein Glas zu trinken, ist eine demokratische Grundtugend. Die bange Frage bleibt allerdings, wo man die Grenze zieht. Sie scheint kaum mehr zu existieren.
Offensichtlich sind die Kriegsverbrechen in der Ukraine ganz weit weg und völlig irrelevant. Wie verschwörungstheoretisch, rechtsradikal oder antisemitisch muss man in der Schweiz des Jahres 2022 sein, um seine Salonfähigkeit zu verlieren? Ist das überhaupt noch zu schaffen? Und gegen welche Formen des blanken politischen Wahnsinns sind die bürgerlichen Kräfte, die alles fröhlich mitspielen, eigentlich noch immun?
In seiner Sommerfestrede feierte Köppel die «friedliche Koexistenz» als Bedingung des demokratischen Zusammenlebens. Seit es um die Frage geht, ob die Ukraine sich wehren darf gegen den russischen Angriffskrieg, sind die SVP-Wortführer ja ganz generell zu Radikalpazifisten geworden. Was Köppel innenpolitisch unter «friedlicher Koexistenz» versteht, entnimmt man aber am besten den «Weltwoche»-Texten.
Da steht dann zum Beispiel zu lesen: «Die Schweiz steht am Scheideweg: Volksaufstand oder Untergang (…) Wir werden regiert von Bundesräten, die sich nicht an die Verfassung halten, diese dank Selbstkastration des Parlaments und Stillschweigen der komatösen Justiz schänden. (…) Evidenzlose, illegale und unwissenschaftliche Corona-Zwangsmassnahmen verursachen massives Leid und zerstören den gesellschaftlichen Zusammenhalt. (…) Entweder erheben wir uns und zwingen unsere Regierung zum Rücktritt und retten die Seele der Eidgenossenschaft oder die Willensnation Schweiz ist gescheitert.»
Der Autor dieser Zeilen, die vor gut zwei Wochen veröffentlicht worden sind, ist Nicolas Rimoldi, der Präsident von Mass-voll, der neuerdings zu den «Weltwoche»-Stammautoren gehört. Es braucht enorm viel guten Willen, um den Text nicht als Aufruf zur Gewalt gegen die Schweizer Landesregierung zu lesen. Aber hey: alles kein Problem mehr in der bürgerlichen Schweiz. Die «Weltwoche» veröffentlicht es. Putschrhetorik wird offenbar jetzt für politisch einsetzbar gehalten. Und dann ist Sommerfest. Der Verleger, der solche Pamphlete publizistisch zu verantworten hat, erzählt etwas über «friedliche Koexistenz». Und über die abscheuliche Aggressivität von woker Cancel-Culture.
Sicher, man soll diese Dinge nicht überschätzen. Der Partykalender sagt zwar etwas aus über die Schweizer Gesellschaft, aber er ist nicht der wichtigste Indikator für den politischen Zustand des Landes. Da wird die Agenda von anderen Dingen geprägt, was uns zum zweiten bemerkenswerten Ereignis der Woche bringt: die Pressekonferenz des bürgerlichen Ja-Komitees zur Verrechnungssteuerreform. Natürlich sass da Thomas Matter, der SVP-Finanzpolitiker und grosse Strippenzieher der Steuerhinterziehungslobby. Aber ebenfalls auf dem Podium sass GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Es war ein beelendendes Spektakel.
Denn immer dann, wenn eine Perspektive aufgezeigt werden soll, wie die Schweiz sich sinnvoll fortentwickelt, wie sie in der Europa-, der Umwelt-, der Gleichstellungs- und der Gender-Politik vielleicht ja doch noch einmal sinnvolle Lösungen finden soll, dann landet man früher oder später bei der GLP. Weil die Grünliberalen eine bürgerliche Kraft sind, die in der bürgerlichen Schweiz noch grosse Wachstumschancen hat. Weil sie den ökologiebewussten und proeuropäischen Flügel der FDP schon bald vollständig ersetzt haben dürfte. Weil sie eine ganze Generation von Nachwuchstalenten aufbaut, die vor zwanzig Jahren noch selbstredend bei der FDP gelandet wären, heute aber einen vielversprechenderen Karriereweg beschreiten.
Momentan zwar, da im Kriegskontext die Wahlentscheide von Angst und Rückzugsreflexen bestimmt werden, legt die FDP wieder etwas zu. Aber weder das Europa- noch das Umweltproblem noch die Gender-Fragen werden deshalb verschwinden. Die Zeit spielt für die GLP.
Damit bekommt auch die Frage eine strategische Bedeutung, wie denn der künftige Liberalismus es mit der «Wirtschaftsnähe» halten wird. Wird auch die GLP den Sonderinteressenlobbyismus kultivieren, der in den bürgerlichen Traditionsparteien einen so geheiligten Brauch darstellt? An den Aufstieg der Grünliberalen knüpft sich eigentlich auch die Hoffnung einer Erneuerung der politischen governance-Standards in unserem Land. Doch jetzt kommt das Verrechnungssteuerdesaster.
Kathrin Bertschy sagte brav ihr Sprüchlein auf – die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Zinseinnahmen sei gut für den Service public, den Gesundheitssektor, den Verkehr –, und man schien ihr anzusehen, dass sie selber weiss, wie ungesichert diese Ansagen sind. Sicherlich wird die Belebung des Schweizer Anleihenmarktes öffentliche Finanzierungskosten tendenziell senken. Aber heute schon ist die Nachfrage nach staatlichen Anleihen viel grösser als das Angebot. Ob der Effekt für die öffentliche Hand am Ende positiv oder negativ sein wird, wurde schlicht nie seriös untersucht (man hätte es tun können, liess es aber tunlichst bleiben).
Ist das der Diskurs des vermeintlich progressiven Liberalismus? Das abgestandene Ammenmärchen, Steuersenkungen führten automatisch zu höheren Steuereinnahmen?
Und hier liegt noch nicht einmal die eigentliche Enttäuschung. Die Enttäuschung ist, dass die GLP nicht die ursprünglichen Pläne der Landesregierung unterstützt hat und dass sie nicht eine Lösung favorisiert, bei der die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Zinsen durch eine Zinsmeldepflicht der inländischen Zahlstellen kompensiert wird. Denn auch wenn die langfristigen Effekte auf die Steuereinnahmen schwer zu prognostizieren sind, eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Verrechnungssteuerreform in ihrer heutigen Form favorisiert die Steuerhinterziehung.
Ist die GLP bereits so Finanzplatz-nah? Hat sie sich bereits eingereiht in die grosse Koalition der bürgerlichen Schwarzgeldprotektoren? Das Ja zur Verrechnungssteuerreform in ihrer heutigen Ausgestaltung scheint dafür ein starkes Indiz zu sein. Für die Ausgestaltung der «Wirtschaftsnähe» des kommenden Liberalismus lässt das nichts Gutes ahnen.
Fest steht jedenfalls: Auch in Zukunft wird das Schicksal der Schweiz in weitgehendem Mass von den bürgerlichen Kräften bestimmt. Angesichts der zahlreichen Blockaden im eidgenössischen Politikbetrieb und angesichts der extremen Radikalisierung der Diskurse unter dem Deckmantel von althelvetischer Konzilianz, stellen sich heute ein paar sehr unangenehme Fragen:
Was, wenn die neue Bürgerlichkeit de facto nur die traditionelle ist – mit lindengrünem Anhauch? Und was, wenn die traditionelle Bürgerlichkeit tatsächlich den Kompass zu verlieren beginnt und plötzlich weit die Tore öffnet für Umsturzfantasien, Putin-Pazifisten und einschlägige deutsche Ehrengäste?
Illustration: Alex Solman
In einer früheren Version haben wir Michael Hengartner als ETH-Präsidenten bezeichnet. Hengartner ist jedoch Präsident des ETH-Rats, des Gremiums, das unter anderem auch die EPFL in Lausanne beaufsichtigt. Wir haben die Stelle korrigiert und bedanken uns für den Hinweis aus der Verlegerschaft.