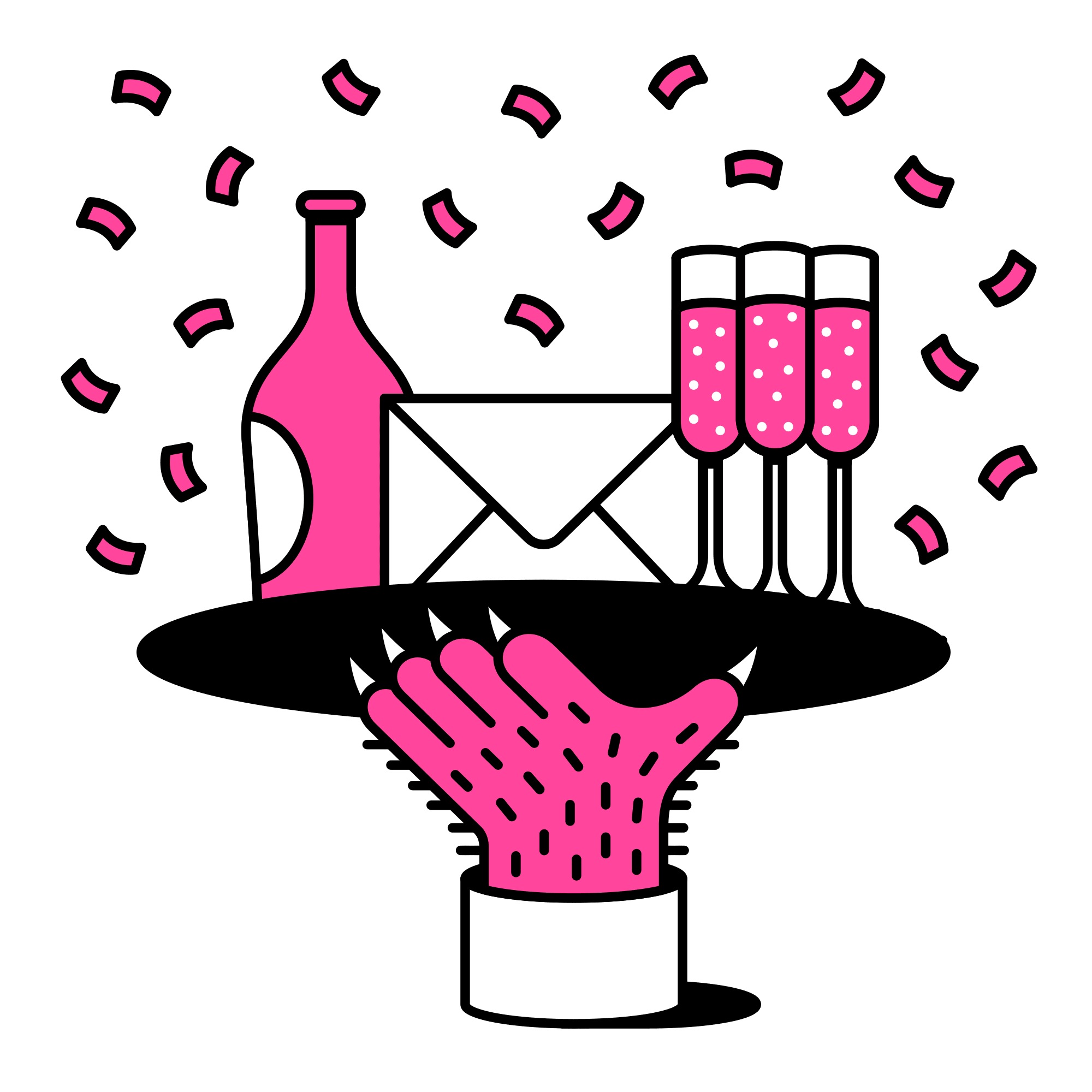
Wir feiern Jubiläum, der Bundesrat will Gassparen verordnen und der Bund kauft nun doch Impfstoff gegen Affenpocken
Ein Blick auf die letzten hundert Ausgaben. Und wie jede Woche: Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (200).
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden, Cinzia Venafro und Patrick Venetz, 25.08.2022
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Sehr geehrte Leserschaft, Sie lesen die 200. Ausgabe des «Briefings aus Bern».
Wie beim letzten runden Jubiläum im Mai 2020 erheben wir darauf die Gläser – und wagen einen Blick in die Statistik.
In den letzten zweihundert Ausgaben des Briefings haben 27 Autorinnen 2’093’649 Zeichen geschrieben. Wer seit der ersten Ausgabe im März 2018 keinen einzigen Buchstaben verpasst hat, dürfte für die Lektüre ungefähr 1630 Leseminuten respektive gut 27 Lesestunden gebraucht haben.
Beim Erscheinen der 100. Ausgabe schrieben wir, das «Briefing aus Bern» ähnele einem Hochseedampfer: Schadlos habe es vier Chefredaktionen überlebt und halte unbekümmert seinen Kurs «durch Wind, Wellen und Wetter». Und jetzt? Sollen wir das Format zum Jumbojet erklären? Zum unverrückbaren Fels in der Brandung? Oder schlicht zum Monolithen?
Was sich auf jeden Fall sagen lässt: Die Entwicklung des intern «BaB» genannten Formats ist positiv. So wächst seine Fangemeinde kontinuierlich an, wie ein Blick auf die Klickzahlen zeigt.
Auch anderes wächst. Während wir uns im Mai 2020 noch für Beiträge in «für die Republik uncharakteristischer Kürze» rühmen konnten, müssen wir nun leicht zerknirscht konstatieren: Die durchschnittliche Ausgabe ist länger geworden – von sechseinhalb Leseminuten in der ersten Lebenshälfte auf nunmehr 9,8 Minuten. (Allerdings scheinen Sie sich davon nicht abschrecken zu lassen, denn ausgerechnet das längste aller Briefings erzielte die höchste Einschaltquote.)
Nichts geändert hat sich hingegen an der Machart: Weiterhin besteht jedes Briefing aus einer Einleitung, drei bis fünf «Dreizacken» – worum geht es, warum braucht man das zu wissen und wie geht es weiter – und einer Schlussbemerkung, die meist etwas weniger nüchtern daherkommt als der Rest der Rubrik. Und weiterhin beginnt das Bundeshausteam Dennis Bühler, Priscilla Imboden und Cinzia Venafro am Montagmittag mit der Planung der Inhalte, um manchmal noch am Mittwochnachmittag alle Absprachen über Bord zu werfen, wenn der Bundesrat zu einer überraschenden Medienkonferenz lädt.
Unverändert sind auch die Begriffe, die in den Briefings am häufigsten genannt werden: Weiterhin dominiert die «Schweiz» (1272 Nennungen ab der 100. Ausgabe), gefolgt vom «Bundesrat» (1025), dem «Nationalrat» (533), dem «Parlament» (481) und dem «Ständerat» (467).
Etwas aber ist anders als bei der ersten Auswertung: Alle sieben Bundesräte erhielten von uns zuletzt markant mehr Aufmerksamkeit als zuvor. In dieser Veränderung erkennen wir ein Abbild der Schweizer Politik: In Krisenzeiten gewinnt die Exekutive nun mal an Bedeutung. Alain Berset erwähnten wir in mehr als jedem zweiten der letzten hundert Briefings (51-mal), einen ähnlich hohen Wert erreichte Ignazio Cassis (46). Im Fokus standen der Gesundheits- und der Aussenminister wegen der Covid-19-Pandemie respektive der Schweizer Europapolitik und wegen des Krieges in der Ukraine.
Wer drückt der Schweizer Politik in den nächsten zwei Jahren den Stempel auf? Wir bleiben für Sie dran.
Doch vorerst danken wir Ihnen herzlich für Ihre Treue, Ihre Kritik und Ihre Debattenbeiträge.
Ihre Autorinnen und Autoren der letzten hundert Ausgaben:
Adrienne Fichter, Andrea Arežina, Anja Conzett, Bettina Hamilton-Irvine, Brigitte Hürlimann, Carlos Hanimann, Christof Moser, Cinzia Venafro, Daniel Ryser, Dennis Bühler, Elia Blülle, Lukas Häuptli, Olivia Kühni, Patrick Venetz, Philipp Albrecht, Priscilla Imboden, Reto Aschwanden, Ronja Beck und Simon Schmid
PS: Während die Männer in unserer Bundesratsstatistik obenaus schwingen, gehen wir den umgekehrten Weg: Waren Autorinnen in der ersten «BaB»-Lebenshälfte noch an bloss zwei Dritteln der Ausgaben beteiligt gewesen, stieg dieser Wert seit der 100. Ausgabe erfreulicherweise auf 95 Prozent (Insider sprechen vom «Venafro- und Imboden-Effekt»).
PPS: Im Mai 2020 konstatierten wir etwas enttäuscht, dass das Wort «Angst» in den ersten hundert Ausgaben des Briefings 12-mal vorgekommen war, während es die «Hoffnung» nur auf 9 Nennungen brachte. Trotz Dauerkrisenmodus können wir nun good news verbreiten: Während die Angst nachliess (10 Erwähnungen), hat uns unverbesserliche Optimistinnen Hoffnung ergriffen (17).
PPPS: Was mögen Sie am «Briefing aus Bern»? Was gefällt Ihnen weniger? Schreiben Sie es uns im Dialog.
Und damit zum – Briefing aus Bern.
Energie: Schweiz soll 15 Prozent Gas sparen
Worum es geht: Der Bundesrat hat ein Gas-Sparziel von 15 Prozent beschlossen. Damit folgt die Schweiz den Vorgaben der umliegenden europäischen Staaten. Ohne diese Massnahme könnte sie nicht auf die Solidarität der Nachbarländer zählen, falls es im Winter zur Gasknappheit kommen sollte. Der Bundesrat will dieses Ziel mit freiwilligen Vereinbarungen mit der Industrie erreichen und auch indem verschiedene Anlagen, die sowohl mit Gas als auch mit Öl betrieben werden können, auf Öl umgestellt werden. Ebenso will er die Bevölkerung dazu aufrufen, Energie zu sparen. So soll eine Energiekrise vermieden werden.
Warum Sie das wissen müssen: Die Schweiz verfügt über keine eigenen Gasspeicher und ist damit von Lieferungen aus dem Ausland abhängig. Russland drosselt derzeit wegen der Sanktionen die Gaslieferungen in die EU. In der Schweiz werden mehr als 40 Prozent des Gases von den Haushalten verbraucht, vor allem fürs Heizen. Deshalb werden auch Privatpersonen aufgerufen, ihre Wohnungen weniger stark zu heizen. Wer die Temperatur nur schon um 1 Grad senkt, spart laut Angaben des Bundesrats rund 5 Prozent Energie.
Wie es weitergeht: Auf Ende Monat startet der Bundesrat eine Energiesparkampagne. Falls es im Winter tatsächlich zu Knappheiten kommt, will er bestimmte Verwendungszwecke verbieten, wie etwa den Betrieb von Freizeit- und Wellnessanlagen oder Heizpilze vor Restaurants. Das Wirtschaftsdepartement soll bis nächsten Mittwoch konkrete Verordnungsentwürfe vorlegen. Danach gehen diese in Konsultation bei «mitinteressierten Kreisen».
Affenpocken: Bund beschafft nun doch Impfstoff
Worum es geht: Der Bund will 40’000 Dosen eines Impfstoffs gegen Affenpocken und ein Medikament zur Behandlung der Erkrankung beschaffen. Dabei handelt es sich laut Mitteilung um einen Impfstoff der Firma Bavarian Nordic und das antivirale Arzneimittel Tecovirimat des Herstellers Siga. Zusätzlich wird die Armeeapotheke 60’000 Impfdosen und 500 Behandlungen als sogenannte Einsatzkontingente beschaffen, da dieser Impfstoff auch bei einem Ausbruch anderer Pockenviren eingesetzt werden könne. Der Impfstoff gegen Pocken und Affenpocken ist derselbe. Mit einer gemeinsamen Beschaffung für die Bevölkerung und die Armee profitiere die Schweiz von besseren Konditionen.
Warum Sie das wissen müssen: Die Schweiz hat, anders als das europäische Ausland, bisher gezögert mit der Beschaffung eines Impfstoffs gegen Affenpocken. Verschiedene Organisationen wie Pink Cross kritisierten den Bundesrat scharf deswegen und forderten die Ausrufung der «besonderen Lage». Die Eidgenössische Kommission für Impffragen und das Bundesamt für Gesundheit empfehlen Risikogruppen eine Impfung. Dazu gehören Männer, die Sex mit Männern haben, und Transpersonen mit häufig wechselnden Sexualpartnern sowie Personen, die exponiert sind wie medizinisches Personal und Kontaktpersonen von erkrankten Personen.
Wie es weitergeht: Die Finanzdelegation des Parlaments muss der Beschaffung formell noch zustimmen. Die Kosten des Impfstoffs und der Verimpfung – insgesamt 8,6 Millionen Franken – werden vom Bund übernommen, bis die Voraussetzungen geschaffen sind, dass die Krankenkassen diese übernehmen können.
Roger Köppel: Immunität bleibt gewahrt
Worum es geht: Die Immunität von SVP-Nationalrat Roger Köppel wird definitiv nicht aufgehoben. Die Immunitätskommission des Nationalrats ist der Rechtskommission des Ständerats gefolgt.
Warum Sie das wissen müssen: Anfang April hatte die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats Strafanzeige gegen Roger Köppel eingereicht. Es besteht der Verdacht, dass er das Amtsgeheimnis verletzt hat. In einem Videoformat seiner Zeitschrift «Weltwoche» hatte er aus einer vertraulichen Informationsnotiz des Aussendepartements vorgelesen. Die Anzeige durch seine Kollegen war ein deutliches Zeichen an den Journalisten und Politiker.
Wie es weitergeht: Ohne Konsequenzen soll das Verhalten des SVP-Nationalrats allerdings nicht bleiben: So soll nun das Büro des Nationalrats Disziplinarmassnahmen prüfen. Dies könnte eine Verwarnung oder aber auch ein vorübergehender Ausschluss aus der Aussenpolitischen Kommission sein. Die Kommissionen beider Kammern erachten eine parlamentsinterne Sanktionierung als zielführender als eine strafrechtliche Untersuchung.
Schulstart: Die Schweiz debattiert den Lehrermangel
Worum es geht: Die Schule hat wieder angefangen – und die Schweiz ist mitten in der Debatte über Lehrermangel. Die Kantone greifen auf Lehrpersonen ohne Diplom zurück, im Kanton Bern beispielsweise haben 1500 von 17’400 Lehrerinnen keine abgeschlossene pädagogische Ausbildung, das entspricht 9 Prozent. Zudem unterrichten in der Oberstufe des Öfteren Personen Fächer, für die sie nicht ausgebildet wurden: Die Schüler pauken folglich auch mal Französisch bei der Mathelehrerin.
Warum Sie das wissen müssen: Durch die Laienlehrer sei die Qualität der Ausbildung in Gefahr, sagt Dagmar Rösler, als Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz quasi die oberste Lehrerin der Schweiz. Rösler schlägt Alarm: Der Lehrermangel sei «eklatant». Doch obwohl ihr Verband seit Jahren darauf hingewiesen habe, müssten nun die Schulen die Untätigkeit der Politik ausbaden.
Wie es weitergeht: Der Lehrerinnen-Dachverband stellt Forderungen: Es brauche finanzielle Unterstützung für Personen in Ausbildung und Entlastung für Klassenlehrer. Das Image des Berufs und seine Attraktivität müssten verbessert werden. Die Lohnunterschiede sind kantonal und je nach Stufe sehr gross. In den vergangenen Jahren wurden die Löhne teils erhöht und teils harmonisiert: So gibt es auf Kindergartenstufe im Kanton Zürich rund 87’000 Franken bei hundert Prozent. Wie «Watson» berichtet, beläuft sich der Schweizer Durchschnitts-Anfangslohn auf 74’737 Franken. Der durchschnittliche Maximallohn liegt bei 112’976 Franken. Nun liegt der Ball bei den Bildungspolitikern.
Unbeliebte Namen der Woche
Kennen Sie ein Baby, das Mia oder Noah heisst? Überraschend wäre das nicht: Denn das waren im letzten Jahr die beliebtesten Vornamen für neugeborene Mädchen und Buben. Die Bundeshausredaktion der Republik hat in diesem Zusammenhang ein paar Nachforschungen gemacht. Und festgestellt: Keiner der zehn aktuell beliebtesten Vornamen ist im Parlament vertreten. Im Gegenteil: Der im Parlament häufigste männliche Vorname Thomas – er kommt 7-mal vor – landet auf der Hitparade des letzten Jahres mit 93 Vertretern abgeschlagen auf Rang 89. Noch weiter hinten auf der Rangliste finden sich die häufigsten Parlamentarierinnennamen: 19-mal gab es 2021 eine Céline, 3-mal tauften Eltern ihre Töchter Barbara oder Marianne, 2-mal Prisca. Vielleicht lehnt sich unsere Bundeshausredaktion hier etwas weit zum Fenster hinaus. Aber zumindest könnten ihre Recherchen einen Hinweis darauf geben, dass Eltern heutzutage ihre Kinder auf keinen Fall nach einer Politikerin benennen wollen.
Illustration: Till Lauer