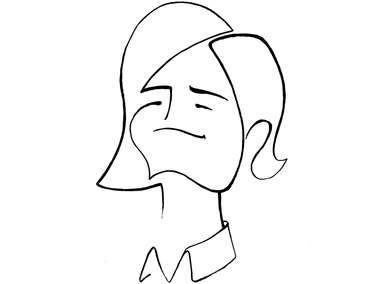
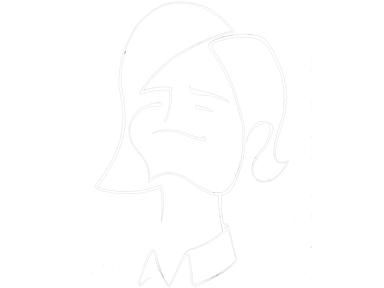
Putins nützliche Patrioten
Wie sollen die westlichen Länder mit dem Russland-Ukraine-Krieg umgehen? In den USA stellen sich noch nicht einmal die Rechtspopulisten offen auf Putins Seite. In der Schweiz haben sie weniger Hemmungen.
Von Daniel Binswanger, 21.05.2022
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!
«Als Ideologie ist der Faschismus nie besiegt worden.» So begann diese Woche ein Gastkommentar von Timothy Snyder, dem Yale-Professor und Spezialisten für ukrainische Geschichte in der «New York Times». Mit dem Aggressionskrieg gegen die Ukraine sei der Faschismus zurück, so Snyder. Es sei der Grund, weshalb der Westen in der Pflicht stehe, die Ukraine zu unterstützen: «Wenn Russland gewinnt, werden sich Faschisten rund um den Globus bestärkt sehen.»
Es geht hier nicht um akademische Debatten, wie Putins Invasion des Nachbarlandes terminologisch zu bezeichnen sei. Ob als Ausdruck einer imperialistisch-grossrussischen Gesinnung, als das Gebaren eines autoritären, hypernationalistischen Regimes – oder eben als faschistischer Gewaltakt. Es geht auch nicht um terminologische Eskalation, die unterstreichen soll, wie verwerflich das putinsche Handeln ist. Snyder legt sehr präzise und überzeugend dar, dass der Feldzug des Kreml-Herrschers, obwohl er offiziell doch der «Entnazifizierung» der Ukraine dienen soll, von einer Ideologie getragen wird, die in den übelsten historischen Kontinuitäten steht.
Ins Feld führt Snyder nicht nur die menschenverachtende Brutalität, mit der der russische Machthaber vorgeht. An historische Vorbilder erinnert vor allem auch die Quasi-Abschaffung der Wahrheit, deren der Kreml sich befleissigt. Alles kann in sein Gegenteil verkehrt werden, solideste Fakten werden nach Belieben vernebelt. Kein Narrativ ist zu absurd, um von Putins Propagandamaschine in die Welt hinausgetragen und ganz unvermittelt gegen ein anderes, nicht weniger absurdes Narrativ ausgetauscht zu werden. Wichtig ist nicht die Glaubwürdigkeit – und schon gar nicht die Debatte. Der Propagandadiskurs soll lediglich für Desorientierung sorgen. Und für die Lähmung der Gegenkräfte.
Faschistische Züge hat jedoch nicht nur der russische Überfall inklusive zahlreicher Kriegsverbrechen, die zwar bislang nicht von unabhängigen Behörden abschliessend untersucht, aber von zahlreichen internationalen Medien mit absolut erdrückender Präzision rekonstruiert werden konnten. Faschistische Züge trägt auch das Gewaltverbrechen, das sich vor einer Woche im amerikanischen Buffalo ereignete, ein mass shooting, bei dem zehn Menschen getötet wurden. Der Anschlag ereignete sich in einer vornehmlich von Afroamerikanerinnen bewohnten Gegend, und acht der zehn Todesopfer waren schwarz. Der vermutliche Täter, ein achtzehnjähriger Mann namens Payton Gendron, hat seinen Amoklauf live ins Internet gestreamt.
Man könnte einwenden, dass solche Massenmorde inzwischen keine Einzelfälle mehr seien und dass der Amoklauf eines Einzeltäters nicht gleich zu Warnungen vor einem wiedererstarkenden Faschismus animieren muss. Schliesslich gab es vergleichbare Attacken, um nur die wichtigsten zu nennen, bereits in Charleston, Christchurch, Oslo und Utøya, El Paso, Pittsburgh. Der Täter von Buffalo – auch hier ist er nicht der erste – postete vor der Tat ein langes Pamphlet, in dem er sich zur white supremacy bekannte und sich insbesondere auf die Theorie des «grossen Austauschs» berief.
Hier liegt jedoch auch der Grund, weshalb uns seine brutale Wahnsinnstat eben doch in besonderem Mass beunruhigen sollte. «Der grosse Austausch» war einst eine Verschwörungstheorie für Spinner am äussersten rechtsextremen Rand. Inzwischen erobert der Begriff den konservativen Mainstream.
Geprägt wurde die Theorie des «grossen Austausches» vom französischen Schriftsteller Renaud Camus, der 2011 ein Buch dieses Titels veröffentlichte. Camus bezeichnet damit die These, dass es einen finsteren Masterplan geben soll, nach dem Migranten aus dem Maghreb und Schwarzafrika Europa kolonisieren, dank der Zuwanderung sowie einer höheren Geburtenrate die ansässige Bevölkerung verdrängen und so einen «grossen Austausch» herbeiführen sollen, der zum völligen Verlust der bisherigen kulturellen Identität in Europa führen werde.
Unter französischen Rechtsextremen sind diese Thesen äusserst populär. Der gescheiterte Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour zum Beispiel beruft sich darauf. Marine Le Pen jedoch hat sich explizit vom «grossen Austausch» distanziert: Die These einer gezielten Umvolkung ist selbst für sie zu extremistisch.
Das hat das Schlagwort natürlich nicht daran gehindert, regelmässig aufzutauchen in den Bekenntnisschreiben rassistischer Gewalttäter – wie jetzt eben in Buffalo. Schon sehr viel erklärungsbedürftiger: Der Begriff findet nun auch eifrig Verwendung bei prominenten Vertreterinnen des «Make America Great Again»-Republikanismus (MAGA).
Der Fox-Starmoderator Tucker Carlson hat in mehr als 400 seiner Sendungen die These ausgebreitet, die Demokraten würden den demografischen Austausch der Bevölkerung favorisieren, um ihre eigene Wählerbasis zu erweitern. Die republikanische Kongressabgeordnete Elise Stefanik, der aufsteigende Star einer neuen Generation von MAGA-Republikanerinnen, benutzte die Verschwörungstheorie für ihre Wahlkampagnen. Der «grosse Austausch» befeuert nicht nur entsetzliche Hassverbrechen – er hat Eingang gefunden in den politischen Mainstream.
Wie immun ist die amerikanische Rechte noch gegen die Versuchung durch faschistische Kräfte? Diese Frage lastet seit dem 6. Januar vergangenen Jahres bleischwer auf der US-Demokratie. Sie ist noch einmal verschärft worden durch die Annullierung des Rechtes auf Abtreibung, die der Supreme Court voraussichtlich beschliessen dürfte. Ein fanatischer Antifeminismus scheint heute auch für unantastbar gehaltene Errungenschaften der sexuellen Selbstbestimmung infrage stellen zu können. Dieser Antifeminismus mag zu guten Teilen durch religiös begründeten Konservatismus motiviert sein, aber er gehörte stets auch zum Kerngehalt faschistischer Ideologien. Auch er ist wieder mainstreamfähig geworden.
Alle diese Entwicklungen geben den kommenden Midterm-Wahlen in den USA ein sehr ungemütliches Gewicht – ganz zu schweigen von den nächsten Präsidentschaftswahlen 2024, bei denen Trump ins Weisse Haus zurückkehren könnte. Extremistische Diskurse sind leitend geworden für weite Teile der amerikanischen Rechten – und Gewalteruptionen scheinen nie sehr fern.
Es ist dieselbe amerikanische Rechte, die für Putins aggressives Gebaren phasenweise helle Bewunderung zeigte. Insofern ist es alles andere als selbstverständlich, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine vom amerikanischen Senat nun einstimmig gutgeheissen wurden. Diese überparteiliche Front sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit unserer Haltung gegenüber dem Krieg in der Ukraine auch die Zukunft unserer westlichen Demokratien verhandeln.
Passend zur aktuellen Weltlage ist dieser Tage die empfehlenswerte deutsche Ausgabe von «Faschismus. Und wie man ihn stoppt» erschienen, das neue Buch von Paul Mason. Der versierte Theoretiker und viel gereiste Reporter liefert zu Snyders These, die Ideologie des Faschismus sei weiter unter uns, sehr reichhaltige Evidenz. In einem Gedankenexperiment lässt er eine Gruppe von SS-Männern 1945 in eine Zeitmaschine steigen und in der Gegenwart landen.
Erst wären diese Reisenden sehr negativ überrascht von der Diversität und Offenheit der heutigen Gesellschaften. Doch dann würden sie an allen Ecken und Enden des Globus auf massive Krisensymptome der Demokratien treffen, die ihnen angenehm vertraut vorkämen. Vor allem aber würden sie das Internet entdecken – und die Echokammern ihrer eigenen Ideologie, in denen völlig ungeschminkt zu Mord und Genozid aufgerufen werden kann und in denen sich rund um den Globus Millionen von Anhängern tummeln. Was tun die SS-Männer aus der Zeitmaschine, die die Zukunft erobern wollten, gemäss Mason? «Sie kaufen Popcorn, entspannen sich und geniessen das vergnügliche Spektakel. Ihre Mission war nicht erforderlich.»
Was Mason besonders beunruhigt, ist die neue Konvergenz zwischen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und autoritärem Konservatismus. Der Rechtsextremismus setzt auf Gewalt und ist eigentlich faschistisch. Der Rechtspopulismus bedient sich zwar rassistischer Rhetorik und nimmt es nicht genau mit rechtsstaatlichen Prinzipien, aber Gewaltanwendung interessiert ihn im Grunde nicht: Er will einfach Wahlen gewinnen, ganz egal wie. Der autoritäre Konservatismus ist typisch für den rechten Rand des Establishments. Es ist die Ideologie von konservativen Eliten, die sich eigentlich an die Spielregeln halten wollen, der eigenen Macht aber deutlich stärker verpflichtet sind als der Demokratie.
Wie hat sich das Zusammenspiel dieser Kräfte verändert? «Das Problem ist», so Mason, «dass diese drei Strömungen begonnen haben, ganz bewusst Synergien zu erzeugen. Seit den Neunzigerjahren nahmen die Politikwissenschaftler an, rechtspopulistische Parteien würden als Brandmauern gegen den eigentlichen Faschismus dienen. Tatsächlich ist das Gegenteil geschehen. Die Brandmauer hat Feuer gefangen.»
Mason entwickelt eine ausführliche, durch die historischen Erfahrungen informierte Diskussion der Faschismus-Definitionen und der «wehrhaften Demokratie». Der Kern der politischen Abwehrstrategie muss auf einer gemeinsamen Front von liberalen und linken Parteien beruhen. Und ein ganz entscheidendes Kampffeld, gerade im Zeitalter der Internet-Kommunikation, ist der öffentliche Diskurs: «Das faschistische Gebäude muss abgerissen werden. Es ist immer noch ein vernünftiger Eröffnungszug, die Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren», sagt Mason. Auch der Krieg in der Ukraine führt uns dramatisch vor Augen, wie sehr der Kampf gegen den Faschismus ein Kampf um die Wahrheit ist.
Und damit wären wir bei der Schweizer Debatte. Es ist sehr positiv, dass nun eine intensive Diskussion über Neutralität, Waffenlieferungen, den Rohstoffhandels- und Finanzplatz sowie das absolut existenzielle Interesse geführt wird, das die Schweiz daran hat, osteuropäische Demokratien gegen den russischen Aggressor zu unterstützen. Es kommt auch zu anerkennenswerten Repositionierungen, etwa wenn Mitte-Präsident Gerhard Pfister klar und deutlich formuliert, dass in der Ukraine auch die Schweizer Demokratie verteidigt wird und dass die Eidgenossenschaft in der Pflicht steht – sowohl was den Umgang mit Oligarchengeldern als auch was Waffenlieferungen anbelangt. Allerdings gibt es aber auch die gegenläufige Tendenz: die kaum verhohlene Putin-Apologetik.
In der «Arena» von letzter Woche verstieg sich SVP-Nationalrat Roger Köppel zu Aussagen, von denen kaum zu glauben ist, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen der Schweiz sie über den Äther gehen lassen muss. Grundsätzlich ist nicht weltbewegend, was «Weltwoche»-Verleger Köppel im Fernsehstudio so von sich gibt. Aber hier sprach er als Vertreter von SVP-Präsident Marco Chiesa. Als Repräsentant von einem Viertel der Schweizer Wählerinnen.
Roger Köppel betreibt russische Kriegspropaganda. Zwar sagt er in jedem zweiten Satz, der Krieg sei schrecklich, ein Völkerrechtsbruch, und Putin hätte nicht in der Ukraine einmarschieren dürfen. Aber in der «Arena» sagte er auch, sein Artikel vom 24. Februar, der eine Lobeshymne auf Putin war, und das «Weltwoche»-Cover, auf dem er Putin den tragisch «Missverstandenen» nannte, seien aufgrund der Invasion überhaupt nicht zurückzunehmen. Im Gegenteil: Köppel gibt nach wie vor den «Provokationen» der Nato die Schuld am Krieg. Zu den Verbrechen von Butscha hat er nichts zu sagen, ausser dass er es einen unfassbaren Skandal findet, dass man diese Verbrechen denunziert, obwohl es noch keine abschliessende, internationale Untersuchung gegeben hat. Butscha verurteilen? Wo kämen wir da hin!
Es müsste jeden Schweizer Patrioten zutiefst degoutieren, dass dieser kaum verhohlene Pro-Putin-Diskurs sich auch noch eine neutralitätspolitische Pappnase aufsetzt. Auf dem neuen «Weltwoche»-Cover werden nun Thierry Burkart und Gerhard Pfister als gewaltgeile Rambos karikiert. Putin ist der «Missverstandene», die bürgerlichen Schweizer Parteipräsidenten hingegen sind «Kriegstreiber». Der SVP-Nationalrat fühlt sich offensichtlich völlig unangreifbar, weil er nicht nur obszönen Unsinn, sondern gleich immer auch noch das Gegenteil behauptet. So argumentieren Faschisten.
Der Russland-Ukraine-Krieg ist eine Bewährungsprobe, ganz besonders für die westlichen Demokratien, die mit ihren hausgemachten Bedrohungen zu kämpfen haben. Wir sehen es auf sehr dramatische Weise in den USA. Wir dürfen auch vor den politischen Realitäten in der Schweiz die Augen nicht verschliessen.
Illustration: Alex Solman