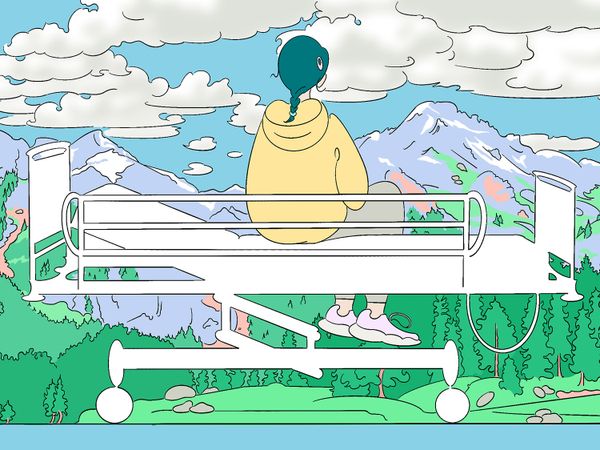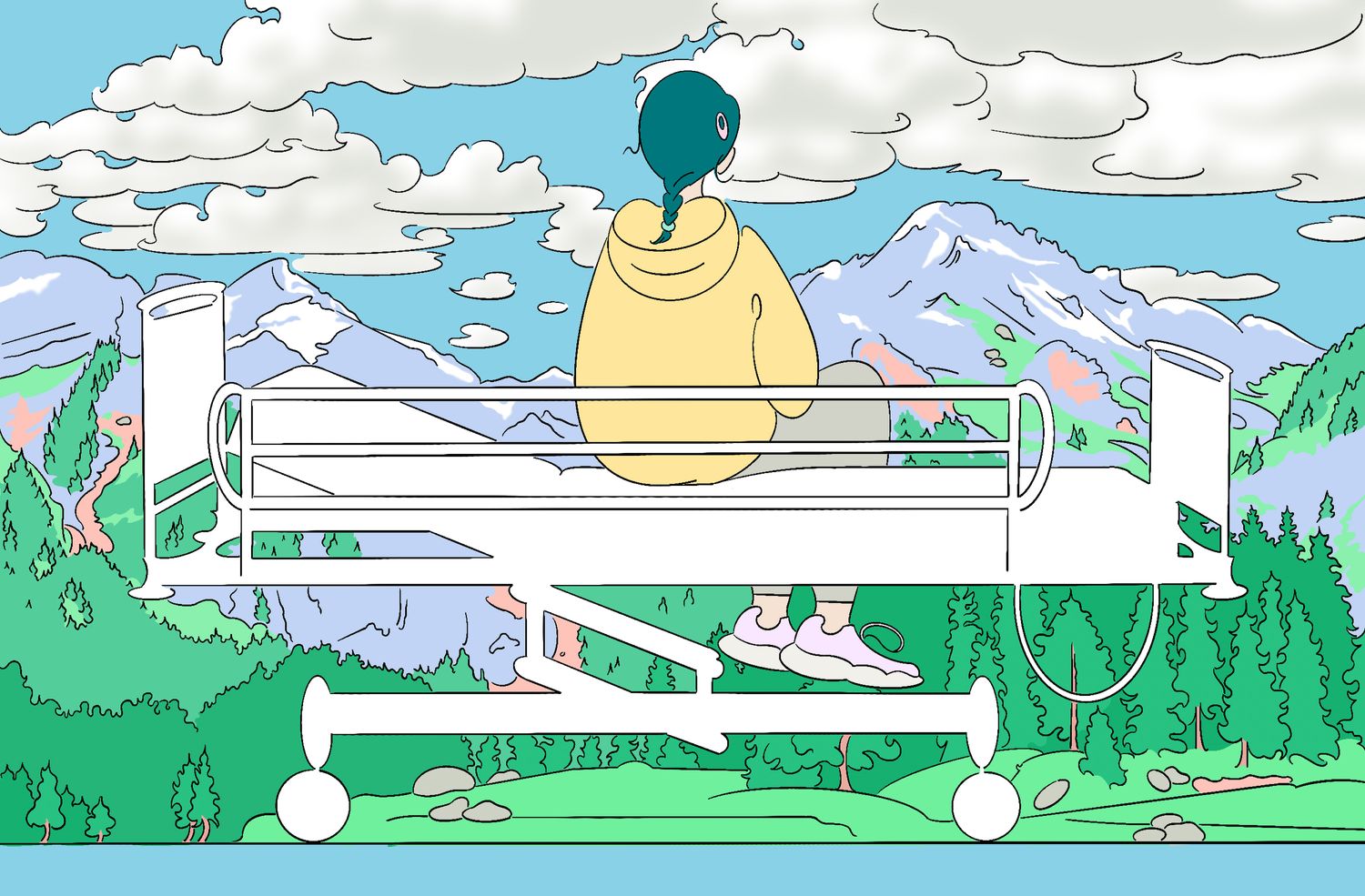
«Ich hätte jeden Preis bezahlt, damit meiner Tochter geholfen wird»
Schweizer Kinderpsychiatrien sind überbelegt. Junge Menschen warten teilweise monatelang auf einen Platz. Das verursacht viel Leid – und hohe Kosten. Wird 2022 das Jahr, in dem sich das ändert? «Jugend und Psyche», Teil 1.
Von Marah Rikli (Text) und Masha Krasnova-Shabaeva (Illustration), 12.05.2022
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.
Linda, 41 Jahre alt, über ihre Tochter Lana, heute 17 Jahre alt (beide Namen zu ihrem Schutz geändert): «Lana wollte schon als Kleinkind immer die gleichen Dinge bei sich haben: einen bestimmten Schal oder ein bestimmtes Spielzeug. Wenn sie Angst hatte, verstärkten sich diese Fixierungen und auch die emotionalen Ausbrüche – zum Beispiel vor den Ferien oder vor einem Ausflug. Am Morgen schrie sie jeweils panisch oder versteckte sich.
In der Schule bekam sie oft Strafaufgaben, weil sie ihre Hausaufgaben vergessen hatte, verträumt wirkte oder während der Stunde mit dem Bleistift spielte. Sie hatte oft Kopfweh und Bauchweh. Und obwohl die Schulpsychologin in einem ihrer Berichte schrieb, dass Lana viel positive Bestärkung brauche und ihre psychosomatischen Beschwerden dringend ernst genommen werden müssten, blieb der Umgang der Schule mit ihr defizitorientiert. Die Lehrerin drohte ihr mit Strafen, wenn sie sich nicht mehr Mühe gäbe. Bereits in der dritten Klasse hängte sie ab und konzentrierte sich auf alles andere als die Aufgaben auf ihrem Pult. Später diagnostizierte dann eine Kinderpsychiaterin die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Auf Medikamente verzichteten wir aus Angst vor den Nebenwirkungen, wir gleisten aber mit der Schule Förderungsmassnahmen auf. Trotzdem blieb die Situation belastend.
Als Lana in die Pubertät kam, arbeitete ich viel. Ich wäre gerne mehr für sie da gewesen, doch als geschiedene Mutter konnte ich mir das finanziell nicht leisten. Ich bekam wohl auch daher erst nach ein paar Monaten mit, dass sie kiffte. Damals machte ich mir noch nicht so grosse Sorgen. Schliesslich wusste ich aus eigener Erfahrung, dass die Pubertät eine schwierige Phase ist.
Dann kam der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie – und unser Zusammenleben wurde schlagartig unerträglich. Lana flippte aus, wenn ich etwas verlangte. Sie schmiss Dinge durch ihr Zimmer oder ignorierte mich den ganzen Tag. Für sie bedeuteten die Schulschliessungen Ferien und Freiheit und sicher nicht, etwas für die Schule zu tun. Im Fernunterricht konnte sie sich keine zehn Minuten lang auf den Schulstoff konzentrieren, auch nicht, wenn ich daneben sass. Stattdessen starrte sie aus dem Fenster und stundenlang in ihr Handy. Wollte ich es ihr wegnehmen, wurde sie aggressiv oder lief davon.
Sie ging in die Therapie, im Lockdown fielen jedoch immer wieder Stunden aus. Nach ein paar Wochen begann Lana weitere Regeln zu brechen, sie traf sich in grossen Gruppen mit Freunden, klaute und log, trank Alkohol und nahm vermutlich auch andere Drogen. Irgendwann sah ich sie nur noch zugedröhnt. Ich versuchte es mit Reden, mit Verboten oder Aufklärung, doch je mehr ich sagte, desto schlimmer wurde es. Immer wieder sagte sie: ‹Mein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr.› Da rief ich das erste Mal die Kinder- und Jugendpsychiatrie an und fragte nach einem Gespräch. Doch schnell war klar: Die Plätze – auch für eine ambulante Therapie – sind rar. Solange nichts Gravierendes passiert war, hatten wir keine Chance, einen Platz zu bekommen.»
Die Erfahrungen, die Linda machen musste, sind kein Einzelfall. In den letzten Monaten berichteten die Medien immer wieder von vollen Kinder- und Jugendpsychiatrien, überlasteten Therapeutinnen und verzweifelten Familien. Tatsächlich ist die Situation prekär: «Wir wissen kaum noch, wie unter diesen Umständen eine Klinik überhaupt geführt und den betroffenen Familien in nützlicher Frist geholfen werden soll», sagt Dagmar Pauli, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Während des ganzen Jahres 2021 hätten sich die Anmeldezahlen nochmals sehr stark erhöht.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz ist seit Jahren chronisch überlastet. Die Situation hat sich während der Pandemie noch einmal drastisch verschärft. Was bedeutet der Notstand konkret für die Betroffenen? Zur Übersicht.
Sie lesen: Teil 1
Die Geschichte von Linda und Lana
Viele psychiatrische Kliniken sind – ähnlich wie die Intensivstationen – zur Triage gezwungen. Eine sehr belastende Situation, gerade wenn es um Kinder und sehr junge Menschen geht. Doch auch wenn die mediale Aufmerksamkeit plötzlich sehr gross ist: Notstand herrscht schon lange.
«Jahrelange Versäumnisse»
2016 hielt das Bundesamt für Gesundheit in einem ausführlichen Bericht eine «deutliche psychiatrisch-psychotherapeutische Unterversorgung» fest. Aus Sicht der Stiftung Pro Juventute sind die jetzt sichtbaren Probleme nicht nur eine direkte Folge der Corona-Pandemie, sondern von «jahrelangen Versäumnissen im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – trotz vieler Warnzeichen».
Doch obwohl immer mehr Kinder und Jugendliche an einer psychischen Störung erkranken und professionelle Hilfe benötigen, wurde die Schweizer Politik in den letzten Jahren kaum aktiv. Dazu kommt ein Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, der die Situation noch zusätzlich verschärft. Erst die Pandemie machte die Probleme in den Kinder- und Jugendpsychiatrien in den letzten zwei Jahren jedoch so gross, dass die Politik sie unmöglich weiter übersehen kann.
Möglicherweise wird dadurch 2022 das Jahr, in dem politisch gehandelt wird. Genau jetzt, seit Mitte März und bis Mitte Mai, ist im Kanton Zürich die neue Spitalplanung in der Vernehmlassung – und die sieht einige Verbesserungen vor. Aber dazu später.
Zuerst kommt nochmals Linda zu Wort: «Wie viele Jugendliche mit schlechten Schulnoten fand auch Lana im Lockdown keine Lehrstelle. Schnuppereinsätze waren ebenfalls kaum möglich – sie wäre dazu aber auch nicht zu motivieren gewesen. Ich suchte eine Privatschule und bezahlte diese im Voraus; sie besuchte die Schule nach den Sommerferien aber gerade mal zwei Tage lang. Dann stand sie nicht mehr auf am Morgen. Ab da entglitt sie mir total.
Lana wirkte zunehmend verwirrt. Nach ein paar Wochen ohne Tagesstruktur war ihr Zimmer zugemüllt mit Abfall, Kleidern, Zigaretten. Sie duschte nicht mehr. Dann hörte sie auf zu essen, stattdessen schlief sie täglich bis zum Nachmittag. Irgendwann stand sie nur noch auf, um zu kiffen und wieder ins Bett zu liegen. Ein so grosses Kind, das während Wochen nur noch im Bett liegt, vor sich hinvegetiert und wie ein verletztes Tier reagiert, wenn man ihm helfen will – was tut man da? Ich war hilflos.»
Gemäss Chefärztin Pauli haben in den letzten Jahren vor allem Fälle von Kindern mit nach innen gerichteten psychischen Erkrankungen stark zugenommen. Dazu gehören Depressionen, Angst- und Essstörungen oder auch selbstverletzendes Verhalten. Auf den Notfallstationen sind die Patientinnen immer jünger und die Störungen immer schwerer.
«Wir haben Fälle, die zu ihrem eigenen Schutz während 24 Stunden rund um die Uhr in abgeschirmten Zimmern von mindestens einer, manchmal auch zwei Personen betreut werden müssen», sagt Pauli. Die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich führt diese immer akuteren Störungen unter anderem auf die lange Wartezeit für eine Behandlung zurück: Mindestens sechs bis neun Monate müssen Jugendliche in sogenannten nicht dringenden Fällen derzeit warten. Eine lange Zeit, in der sich Symptome oft verstärken und Störungen weiterentwickeln – selbst bei vergleichsweise häufigen und eigentlich gut behandelbaren Diagnosen wie ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen.
Neuropsychologische Forschungen zeigen, dass ein früh erkanntes ADHS gut behandelbar ist, während ein nicht erkanntes oftmals zu Folgeerkrankungen wie einer Angst- und Panikstörung, einer Depression oder bis hin zu einer Borderline-Störung führen kann. Die Verzögerung verstärkt in vielen Fällen nicht nur das Leiden – sondern treibt bei einer Eskalation auch die Kosten in die Höhe. «Das sind immense Kosten, die durch solche Settings entstehen», sagt Pauli. «Das wird uns dann wiederum vorgeworfen.»
So hat es Linda mit ihrer Tochter Lana erlebt: «Auch bei Lana eskalierte die Situation irgendwann. Ohne Medikamente und gezielte psychotherapeutische Hilfe und ohne sozialpädagogische Unterstützung im Tagesablauf verschlechterte sich ihr Zustand.
Als Lana nur noch in ihrem Zimmer lag, konsultierte ich eine Psychiaterin. Diese war sehr beunruhigt, fand aber, es sei zu früh für einen stationären Aufenthalt. Sie wollte Lana erst einmal in der Tagesklinik behandeln lassen. Doch auch da gab es keinen Platz. Sie empfahl uns daher wieder regelmässige Therapiesitzungen und Stabilisierung zu Hause. Wir folgten dem Rat, doch Lana half das kaum. Eine Stunde in der Woche war einfach zu wenig, wenn sie denn überhaupt hinging. Ich schämte mich für unsere Situation, arbeite ich doch selbst im sozialen Bereich.
Als ich Lana schliesslich auf Anraten der Therapeutin den Geldhahn abstellte, damit sie sich keine Drogen mehr kaufen konnte, drehte sie durch. Sie schrie während Stunden, warf Dinge umher, drohte mir, sie würde sich umbringen und alle, die sich ihr in den Weg stellten.
Da rief ich den Notfallarzt.»
Die Situation, die Linda beschreibt, ist nicht nur in Zürich derart unhaltbar. Plätze für Kinder und Jugendliche fehlen überall – das stellt auch der Bund in entsprechenden Berichten immer wieder fest, zuletzt im Dezember 2020. Es mangelt an Plätzen in Tageskliniken, in denen die Kinder über Nacht nach Hause können, es fehlt an Langzeittherapie-Plätzen in Kliniken, in der Akutpsychiatrie, auf den Stationen. Sogar die Suche nach einem freien Termin in einer psychotherapeutischen Praxis für Kinder oder Jugendliche kann schnell zur Geduldsprobe werden.
Vor allem Therapeutinnen, die über die Grundversorgung der Krankenkassen abrechnen dürfen, nehmen kaum noch neue Patientinnen an. Insbesondere Familien mit geringen finanziellen Mitteln können sich Psychotherapien jedoch nur leisten, wenn die Krankenkasse sich beteiligt.
Das mussten auch Linda und Lana erfahren: «Als der Notfallarzt eintraf, beruhigte sich Lana sofort. Ich selbst war wie paralysiert und rief jede Jugendpsychiatrie in der Schweiz an, schilderte unsere Situation. Vergeblich: Landesweit gab es für Lana keinen einzigen Platz, auch nicht in privaten Kliniken. Ich hätte jeden Preis bezahlt, damit meiner Tochter geholfen wird.
Nach Stunden kam dann doch die Erlösung – initiiert durch den Notfallarzt. Ein Krankenwagen holte sie ab, fuhr sie in eine psychiatrische Klinik für Erwachsene. Bis heute bin ich überzeugt, dass frühere Hilfe diesen Schritt hätte verhindern können.»
Auch dass Jugendliche in die Erwachsenenpsychiatrie ausweichen müssen, ist kein neues Phänomen. Schon vor mehr als zwanzig Jahren mussten im Kanton Zürich, in dem Lana mit ihrer Familie lebt, Minderjährige auf der Erwachsenenpsychiatrie gepflegt werden. Dabei kam es in mehreren Fällen zu sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, wie die NZZ 2001 berichtete.
Zehn Jahre später folgte im Kanton Zürich die Psychiatrieplanung 2012. Die Politik – bereits vorgewarnt – kalkulierte, welche Leistungen bis im Jahr 2022 notwendig sein würden, um die künftige Versorgung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Das wäre eine Chance gewesen, um zu reagieren.
Die damalige Planung ging richtigerweise von einer leichten Zunahme der Fälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus – jedoch ebenfalls von einer Reduktion der Aufenthaltsdauer. Denn die Politik will die Aufenthaltsdauer und damit die Kosten möglichst gering halten.
Bei diesem Anliegen unterstützen die Spitäler seit 2012 noch besser. Damals wurde die neue Spitalfinanzierung eingeführt, bei der mit sogenannten Fallpauschalen abgerechnet wird. Das bedeutet, dass Spitäler den gleichen Betrag belasten können, unabhängig davon, ob der Patient vier oder fünf Nächte im Spital verbracht hat. Je effizienter eine Patientin also behandelt wird, desto grösser ist der Gewinn für das Spital.
Es ist daher im wirtschaftlichen Interesse der Kliniken, dass Patienten – auch die jungen Menschen in der Psychiatrie – möglichst schnell nach Hause geschickt werden und dort genesen. Oder wie es die Soziologin Franziska Schutzbach in ihrem Buch «Die Erschöpfung der Frauen» formuliert: «Menschen können im Krankenhaus nicht ausreichend lang gepflegt werden und werden früher nach Hause entlassen. In beiden Fällen wird wegen Kostendruck Care-Arbeit nach Hause delegiert.»
Die Auswirkungen auf die Familien und die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind dabei – wie man aktuell sieht – oftmals schwerwiegend.
So hat es Linda erlebt: «Man kann sich nicht vorstellen, was Kinder sehen in der Erwachsenenpsychiatrie. Hier kommen Jugendliche, die beinahe noch Kinder sind, mit schwer kranken Erwachsenen in Kontakt. Das war alles zusätzlich belastend für Lana. Niemand war auf Jugendliche eingestellt, auch Therapien gab es für sie nicht – Lana lag einfach den ganzen Tag im Zimmer. Daher besuchte ich sie von morgens bis abends, meldete mich bei der Arbeit krank, ging mit ihr spazieren oder machte Spiele. Kurz: Ich übernahm die Arbeit der Pflege. Nach einer Woche konnte Lana zum Glück auf eine Jugendstation wechseln, wo sie mehrere Monate blieb und die Ärzte endlich einen Behandlungsplan aufstellten.»
Die beschriebene Unter- und Fehlversorgung bleibt selbst dann ein Thema, wenn Jugendliche einen stationären Platz erhalten haben. Vor allem, wenn sie während des Aufenthaltes 18 Jahre alt werden: Dann müssen sie möglichst schnell in die Erwachsenenpsychiatrie wechseln, auch wenn sie noch gar nicht dazu bereit sind. Es gibt nur wenige Angebote, in denen Jugendliche auch bleiben können, wenn sie volljährig geworden sind. Das zeigt unter anderem ein Bericht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften aus dem Jahr 2020.
Solche Brüche erschweren es jungen, psychisch kranken Menschen, langfristig gesund zu werden, und sie verstärken einen sogenannten «Drehtüreffekt»: Viele Jugendliche brechen die Behandlung nach dem Übertritt in die Erwachsenenpsychiatrie frühzeitig ab. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass sie einen Rückfall haben. Und dass sie später abhängig werden von der Invalidenversicherung oder der Sozialhilfe.
Besonders stark trifft es dabei Jugendliche aus Pflegefamilien. Diese jungen Leute können nach erreichter Volljährigkeit nämlich nicht einmal mehr zu ihren Pflegefamilien zurück. Ihr Pflegevertrag endet, Behörden stoppen die Zahlungen an die Pflegefamilien, und die Beistände legen ihre Mandate nieder. Damit verlieren die jungen Erwachsenen sämtliche Unterstützung. Für viele ist dies ein weiterer traumatischer Bruch, der allfällige Krisen noch verschlimmert.
«Wie ein Fass ohne Boden»
Trotzdem: Die Psychiatrieplanung 2012 hat im Kanton Zürich in den letzten zehn Jahren auch zu einigen Verbesserungen in der Versorgung geführt. Das bestätigt unter anderem Chefärztin Pauli von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nur: Die Massnahmen und Erweiterungen reichten bei weitem nicht aus. Oder wie es Pauli formuliert: «Der Bedarf ist wie ein Fass ohne Boden, jedes neue Angebot, das wir aufbauen, ist umgehend wieder besetzt und führt bereits nach kurzer Zeit lange Wartelisten.»
Erst die Pandemie machte für viele Menschen sichtbar, wie dramatisch die Situation ist. «Aufgrund der Corona-Pandemie werden wir endlich ernst genommen», sagt Pauli.
Auch der Zürcher Regierungsrat erkannte letztes Jahr, dass dringend Hilfe benötigt wird. Im Juni 2021 verabschiedete er ein Massnahmenpaket zur Verbesserung der Versorgungssituation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton. Damit sprach er 7,9 Millionen Franken für verschiedene Sofortmassnahmen.
Linda hat die Dramatik unmittelbar erfahren: «Lana bekam in der Klinik Medikamente gegen Depressionen und das ADHS, die ihr schnell halfen. Aber immer wieder wurden Elterngespräche verschoben oder die Ärztin musste während des Gesprächs zu einem Notfall rennen. Auch Therapien waren auf längere Zeit hin ausgebucht. Das Thema Personalmangel war allgegenwärtig, immer wieder hatte Lana neue Bezugspersonen, Vereinbarungen oder Tagespläne wechselten ständig, was bei Lana zu starken Wutausbrüchen und Frust führte.
Es war keine gute Zeit für meine Tochter, auch wenn ihr der Aufenthalt half, wieder in einen klaren Tagesablauf zu kommen – und mehrere Wochen lang drogenabstinent zu sein.
Trotzdem war ich dankbar, als wir endlich eine geeignete Langzeittherapie fanden. Leider musste Lana dann aber nochmals mehrere Wochen warten, bis sie eintreten konnte.»
Sind die 7,9 Millionen Franken, die der Kanton Zürich für Sofortmassnahmen bereitstellt, viel? Zum Vergleich: An den Erstellungskosten für die Erweiterung des Kunsthauses beteiligte sich die Stadt Zürich mit 88 Millionen und der Kanton mit 30 Millionen. Für neue Projekte im Strassenbau stehen dem Kanton Zürich jährlich 90 Millionen zur Verfügung.
Doch immerhin schafft das Paket erste Entlastung, vor allem bei den Notfallplätzen. Zum Beispiel in der Modellstation Somosa in Winterthur. Auch die Integrierte Psychiatrie Winterthur kann dank der Finanzspritze eine zusätzliche Jugendstation eröffnen. Die Versorgung von Jugendlichen auf den Erwachsenenstationen wird verbessert. Unterstützt wird auch eine Kriseninterventionsstation, die Tagesplätze oder stationäre Behandlung anbietet. Damit wechseln Jugendliche rasch in ein intensives ambulantes Setting, langfristige stationäre Behandlungen sollen vermieden werden.
Es handle sich dabei um kurz- und mittelfristige Massnahmen, schreibt Jérôme Weber von der Gesundheitsdirektion Zürich auf Anfrage. Einige davon hätten bereits umgesetzt werden können, beispielsweise die Aufstockung des Personals zur ambulanten Betreuung in Spitälern. Andere, wie der Ausbau stationärer Angebote, seien in Vorbereitung. Die Gesundheitsdirektion fördere zudem innovative Behandlungsansätze, so Weber. Dazu gehören etwa home treatments – also Akutbehandlungen zu Hause –, die den bereits erwähnten «Drehtüreffekt» verhindern sollen.
Alles wichtige erste Schritte also.
Trotzdem: Die Wartelisten und Wartezeiten für Therapien beispielsweise von Kindern mit ADHS oder einer Autismus-Spektrum-Störung bleiben lang. Ambulante Lösungen belasten zudem die Familien. Und der Mangel an Fachkräften und Pflegepersonal die Klinikteams. Diese äussern sich ähnlich wie in den letzten zwei Jahren die Kolleginnen auf den Intensivstationen: Die Ärztinnen und Pfleger sind müde.
Der Zürcher Regierungsrat ist sich denn auch bewusst, dass die Sofortmassnahmen wohl nicht ausreichen werden, um den gesamten prognostizierten Bedarf an Plätzen für stationäre Behandlungen zu decken. Weitere Massnahmen sollen deshalb im Rahmen der Spitalplanung 2023 behandelt werden, die zurzeit in der Vernehmlassung ist.
Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli verspricht, die Spitalplanung dazu zu nutzen, um «die Gesundheitsversorgung im Kanton Zürich weiter zu verbessern». Die Bevölkerung soll «die richtige Leistung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und in guter Qualität» bekommen.
Offenbar ist das Ausmass der Krise bei der Gesundheitsdirektion angekommen. Sie erwartet gemäss Versorgungsbericht in den kommenden Jahren «eine steigende Inanspruchnahme stationärer psychiatrischer Leistungen, die über den demografischen Effekt hinausgeht». Die stärkste Zunahme wird im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie erwartet: 38 Prozent mehr bei «Störungen des Sozialverhaltens», 30 Prozent mehr «Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen».
Hat die Politik also verstanden, wie gross die Not ist?
Man wolle die Unterversorgung in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie längerfristig beheben, schreibt Jérôme Weber von der Gesundheitsdirektion. Und er betont, die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung sei auch national ein Thema, man tausche sich dazu mit Vertretern des Bundes und der anderen Kantone aus.
Zum Abschluss noch einmal Linda: «Heute, 18 Monate später, geht es Lana recht gut, aber die Situation ist immer noch fragil. Sie macht jetzt eine Ausbildung, Therapien und nimmt Medikamente. Immer wieder habe ich mich gefragt, was ich hätte anders machen sollen. Sicher, die Erziehung war nicht perfekt, und auch in der Schule hätte man sehr vieles besser machen können – doch ich habe mir früh Hilfe geholt, als die Krise kam.
Ist es nicht das, was man Jugendlichen und den Eltern immer rät: sich Hilfe holen, wenn man es allein nicht mehr schafft? Doch was, wenn keine verfügbar ist? Ich kann einfach nicht verstehen, warum man uns Familien so im Stich lässt.»
Marah Rikli ist freie Autorin, Buchhändlerin und Mutter zweier Kinder. Als Kolumnistin für das Lehrpersonenmagazin «Rundgang» schreibt sie über das Leben mit ihrer Tochter, die eine Behinderung hat. Sie publiziert regelmässig Artikel für den Mamablog des «Tages-Anzeigers» und veröffentlichte Beiträge im «Magazin», in der «SonntagsZeitung», in «Wir Eltern» und der «Aargauer Zeitung». Ihre Schwerpunkte: Inklusion, LGBTQIA+, Feminismus und Erziehung. Sie ist für diese Themen auch als Referentin oder Moderatorin von Talks und Panels unterwegs.