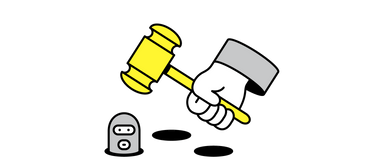
Suizidhilfe für Gesunde?
Ein alter Mann erkrankt unheilbar an Krebs. Seine Frau will mit ihm zusammen sterben. Ein Arzt leistet dem Paar Suizidhilfe – und landet darum vor Bundesgericht. Dort sorgt der Fall für eine kontroverse Diskussion.
Von Daniel Hürlimann und Caroline Ruggli, 16.03.2022
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Eine Warnung: Dieser Beitrag behandelt das Thema Suizidalität. Im Text werden Suizidgedanken und Angst vor Einsamkeit thematisiert. Anlaufstellen finden Sie am Schluss des Beitrags.
In der Schweiz ist die Suizidhilfe grundsätzlich erlaubt. Nach dem Strafgesetzbuch ist die Beihilfe zum Suizid nur dann strafbar, wenn sie aus egoistischen Motiven erfolgt. Für Ärztinnen gelten aber noch andere Gesetze und Regeln. Sie sollten unter anderem die Richtlinien einer privaten Stiftung einhalten, der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW). Diese Richtlinien legen fest, dass Krankheitssymptome und/oder Funktionseinschränkungen vorliegen müssen, damit Ärzte Suizidhilfe leisten dürfen.
Was aber gilt, wenn eine Ärztin das Mittel einem gesunden Menschen verschreibt?
Die Verschreibung des Sterbemittels Natrium-Pentobarbital an eine gesunde, betagte Frau hat zu einer Strafuntersuchung gegen einen Arzt und zur Anklageerhebung geführt. Der Arzt wurde schuldig gesprochen, was er nicht akzeptierte. Er zog seinen Fall bis vors höchste Gericht.
Das Bundesgericht erledigt rund 8000 Beschwerden pro Jahr. Die allermeisten Urteile werden ohne öffentliche mündliche Beratung gefällt; vergangenes Jahr waren es nur gerade 30 Fälle, die öffentlich beraten wurden. Im Bundesgerichtsgesetz steht, dass ein Entscheid immer dann mündlich beraten wird, wenn sich im Richtergremium keine Einstimmigkeit ergibt. Das heisst, das Bundesgericht entscheidet in 99,6 Prozent der Beschwerden einstimmig.
Der Fall der gesunden, betagten Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann sterben wollte, gehört also zu den restlichen 0,4 Prozent. Mit anderen Worten: Am höchsten Gericht herrschte Uneinigkeit.
Ort: Bundesgericht, Lausanne
Zeit: 9. Dezember 2021, 9.30 Uhr
Fall-Nr.: 6B_646/2020
Thema: Verletzung des Heilmittelgesetzes
Folgendes ist geschehen: Eine Suizidhilfeorganisation erhält vom betagten Ehepaar Rochat (das in Wirklichkeit anders heisst) einen Brief. Rochats sind seit über 60 Jahren zusammen und sehr eng verbunden. Der Ehemann ist krebskrank und möchte seinem Leiden ein Ende setzen. Die Ehefrau ist 86 Jahre alt und gesund, kann aber den Gedanken nicht ertragen, ohne ihren Gatten weiterleben zu müssen.
Das Paar bittet die Organisation, sie bei einem Doppelsuizid zu unterstützen.
Doktor Favre (der ebenfalls anders heisst) ist pensionierter Arzt und bei der Suizidhilfeorganisation tätig. Für ihn ist von grösster Bedeutung, unbegleitete Selbsttötungen zu vermeiden. Favre möchte es jeder Person ermöglichen, Zeitpunkt, Ort sowie die Art ihres Todes selbst zu wählen.
Die Geschichte des Ehepaars berührt den Arzt sehr. Er führt mit den beiden mehrere Gespräche. Frau Rochat betont wiederholt, sie werde sich so oder so das Leben nehmen, ob ihr Favre nun helfe oder nicht. Sie schildert dem Arzt konkrete Ideen, wo sie sich das Leben nehmen könnte, ohne dass Dritte zu Schaden kämen. Die Frau ist entschlossen, zusammen mit ihrem Ehemann zu sterben; ein Weiterleben ohne ihn kommt für sie nicht infrage.
Daniel Hürlimann ist als Professor für Rechtsinformatik und IT-Recht an der Berner Fachhochschule tätig. Er war als Mitglied der zuständigen Kommission an der Erarbeitung der SAMW-Richtlinien zu Sterben und Tod beteiligt. Seine Habilitationsschrift mit dem Titel «Recht und Medizin am Lebensende» erscheint demnächst.
Caroline Ruggli ist Rechtsanwältin und Doktorandin bei Professor Marc Thommen an der Universität Zürich. Sie verfasst eine Dissertation im Bereich des Strafprozessrechts.
Frau Rochat gibt im Dezember 2015 bei ihrem Notar folgende Erklärung ab: «Ich kann die Aussicht, meinen Mann zu überleben, psychisch nicht ertragen und ergreife daher die notwendigen Massnahmen, um meine Verzweiflung zu bewältigen, falls ich meinen Mann überleben sollte. Ich bitte daher die Suizidhilfeorganisation, mir zu helfen, mein Leben in dieser Welt unverzüglich zu beenden.»
Der Arzt verschreibt Frau Rochat im April 2017 das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital. Daraufhin nimmt die 86-jährige, gesunde Frau zusammen mit ihrem krebskranken Ehemann das verschriebene Mittel ein und setzt dadurch mit Unterstützung der Suizidhilfeorganisation ihrem Leben ein Ende.
All diese Vorgänge, Absichten und Aussagen werden Monate später im zweitinstanzlichen Urteil des Genfer Kantonsgerichts detailliert nachzulesen sein.
Eingespielte Abläufe
Schweizer Suizidhilfeorganisationen informieren nach einem Suizid oder Doppelsuizid standardmässig die Polizei. Sie dokumentieren das Geschehen teilweise mit Filmaufnahmen und übergeben diese zusammen mit einer Bestätigung der Urteilsfähigkeit und weiteren Unterlagen der Polizei. Meist wird auch die Staatsanwaltschaft beigezogen. Die Abläufe sind eingespielt, und in der Regel wird kein Strafverfahren eröffnet.
In diesem Fall war es jedoch anders, weil es unüblich ist, dass eine gesunde Person sich auf diesem Weg das Leben nimmt. Der Suizid von Frau Rochat hatte strafrechtliche Konsequenzen.
In erster Instanz verurteilte das Polizeigericht des Kantons Genf den beteiligten Arzt wegen Verletzung des Heilmittelgesetzes. Favre wehrte sich gegen das Verdikt, weshalb sich auch das Genfer Kantonsgericht damit befasste – und das Urteil der Vorinstanz bestätigte. Der Verurteilte gab nicht auf und zog den Schuldspruch bis vor Bundesgericht. Dieses hatte zu entscheiden, ob die Bestrafung des Mediziners gestützt auf das Heilmittelgesetz korrekt ist – oder nicht.
An einer mündlichen Beratung sind immer fünf Bundesrichter beteiligt. In einer ersten Runde äussert sich jede Richterin zum Fall – in aller Regel in ihrer Muttersprache. Im Fall des Arztes und Suizidhelfers hat sich der erste Richter in Französisch, die zweite und dritte Richterin in Deutsch, der vierte Richter in Italienisch und schliesslich die Abteilungspräsidentin wieder in Französisch geäussert.
Ja? Nein? Die Spannung steigt
Diese erste höchstrichterliche Auslegungsrunde dauerte zwei Stunden lang. Die Spannung war gross, vergleichbar mit einem Penaltyschiessen: Die Richterinnen und Richter argumentierten abwechselnd für die Gutheissung der Beschwerde (also für die Aufhebung des Urteils) und dann wieder für deren Abweisung (Festhalten am Schuldspruch).
Doch während es beim Penaltyschiessen nur Schwarz oder Weiss gibt, lebt das Recht von Grautönen. So war es möglich, dass im ehrwürdigen Gerichtssaal auf Mon-Repos neben den zwei Ja-Voten (Freispruch) und den zwei Nein-Voten (Verurteilung) auch ein Ja-aber-Votum zu hören war.
Die betreffende Richterin war zwar der Auffassung, eine Bestrafung gestützt aufs Heilmittelgesetz sei nicht möglich. Sie wies aber gleichzeitig darauf hin, dass eine Bestrafung gestützt auf das Betäubungsmittelgesetz durchaus zu prüfen wäre. Ihre Begründung lautet, kurz zusammengefasst: Das Heilmittelgesetz regelt Heilmittel, also Mittel zur Heilung von Krankheiten. Wenn eine gesunde Person ihrem Leben ein Ende setzen will, hat das nichts mit Heilung und somit auch nichts mit dem Heilmittelgesetz zu tun.
Die Bundesrichterin hält es jedoch für möglich, dass die Verschreibung des Natrium-Pentobarbitals gestützt auf das Betäubungsmittelgesetz bestraft werden müsste. Der Fall solle deshalb zur Klärung dieser Frage ans Genfer Kantonsgericht zurückgewiesen werden.
Heil- oder Betäubungsmittel?
Am Ende einer mündlichen Beratung wird jeweils abgestimmt. Dabei ist zunächst zu entscheiden, ob eine Beschwerde gutgeheissen oder abgewiesen wird. Wird die Beschwerde gutgeheissen, kann das Bundesgericht entweder selber entscheiden – oder die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückweisen, wie das in diesem Fall ja beantragt wurde. Auch darüber muss anschliessend noch abgestimmt werden.
Im Suizidhilfe-Fall hat dieses Prozedere dazu geführt, dass in der ersten Abstimmungsrunde mit drei zu zwei Stimmen für die Gutheissung der Beschwerde votiert wurde.
Doch damit war der beschuldigte Arzt nicht etwa freigesprochen.
Die Spannung blieb, denn nun stand eine zweite Abstimmungsrunde an. In dieser Runde wurde darüber entschieden, ob die Sache ans Genfer Kantonsgericht zurückzuweisen sei, damit die Vorinstanz eine Bestrafung des Arztes gestützt auf das Betäubungsmittelgesetz prüfe.
Erneut lautete das Resultat drei zu zwei Stimmen – und zwar für eine Rückweisung. Jene Richter, die in der Runde zuvor für eine Verurteilung gestimmt hatten (und von der Mehrheit überstimmt worden waren), votierten nun für eine Rückweisung ans Kantonsgericht.
Ethik ist keine exakte Wissenschaft
Von dieser höchst kontroversen Diskussion, von den unterschiedlichen Argumenten oder vom knappen Abstimmungsergebnis wird im schriftlich begründeten Urteil (das noch nicht vorliegt) nichts zu lesen sein. Dort werden nur jene Argumente abgehandelt, die zum hart errungenen Resultat passen. Nur wer an einer der seltenen öffentlichen Beratungen des Bundesgerichts teilnimmt, bekommt Einblick in die Meinungsvielfalt unter den höchsten Richterinnen des Landes. Dissenting opinions werden nicht publiziert, anders als zum Beispiel am Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
Der Ball liegt nun also wieder beim Genfer Kantonsgericht, das zu prüfen hat, ob der Arzt allenfalls gestützt auf das Betäubungsmittelgesetz bestraft werden muss. Doch unabhängig davon, wie es entscheiden wird, ist davon auszugehen, dass der Fall anschliessend erneut ans Bundesgericht weitergezogen wird. Bei einem Schuldspruch dürfte der Arzt den Fall nach Lausanne bringen, bei einem Freispruch die Staatsanwaltschaft.
Die Genfer Richter werden sich mit der Argumentation des höchsten Gerichts auseinandersetzen müssen; und diese mag auf den ersten Blick erstaunen. Das Bundesgericht ist wie erwähnt nicht einverstanden damit, dass der Schuldspruch gegen den Arzt auf dem Heilmittelgesetz basiert. Es weist aufs Betäubungsmittelgesetz als mögliche Grundlage hin.
Beide Gesetze orientieren sich für die Zulässigkeit einer Verschreibung an den Regeln der medizinischen Wissenschaften. Doch es ist unter Juristen schon länger umstritten, ob die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften als «anerkannte Regeln der medizinischen Wissenschaften» gelten.
Denn diese Richtlinien sind nicht rein medizinische, sondern medizin-ethische Regeln. Und die Ethik ist, wie das Recht auch, eine nicht exakte Wissenschaft. Gerade das Thema Suizidhilfe zeigt, dass ein wissenschaftlicher Konsens in ethischen Themen kaum möglich ist.
Kein Verstoss ohne anerkannte Regeln
Vergleicht man den Wortlaut von Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetz, erscheint die Rückweisung ans Genfer Kantonsgericht dennoch nachvollziehbar. Denn das Heilmittelgesetz verlangt, dass bei der Verschreibung von Arzneimitteln die anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften «beachtet» werden. Das Betäubungsmittelgesetz hingegen hält fest, dass Ärztinnen verpflichtet sind, Betäubungsmittel nur in dem Umfang zu verordnen, der nach den anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften «notwendig» ist.
Das bedeutet konkret: Wenn für die Verschreibung eines Sterbemittels keine «anerkannten Regeln der medizinischen Wissenschaften» existieren, liegt auch kein Verstoss gegen das Heilmittelgesetz vor. Denn wo es keine derartigen Regeln gibt, können diese auch nicht «beachtet» werden.
Die Verschreibung des Sterbemittels könnte aber als nicht «notwendig» und damit als Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz beurteilt werden. So auf jeden Fall das vorläufige Fazit des Bundesgerichts – das in der Sache selbst allerdings nicht entschieden hat. Weder pro noch contra Suizidhilfe für Gesunde.
Es bleibt also spannend – obwohl damit zu rechnen ist, dass das Genfer Kantonsgericht erneut einen Schuldspruch gegen den Arzt aussprechen wird; dieses Mal gestützt aufs Betäubungsmittelgesetz. Danach dürfte der Ball erneut beim Bundesgericht liegen. Sollte es den Arzt in der zweiten Runde freisprechen, ist davon auszugehen, dass das Thema vom Bundesparlament aufgenommen wird. Und nicht länger der Ärzteschaft überlassen bleibt.
Zu Anlaufstellen für Hilfe: Sie haben Suizidgedanken? Reden Sie darüber!
Die Erfahrung zeigt: Menschen, die einen Suizidversuch überlebten, waren froh, noch am Leben zu sein. Holen Sie sich bei Suizidgedanken anonym Hilfe:
Plattform für psychische Gesundheit, speziell in der Corona-Zeit: «Dureschnufe»
Notfallnummern:
Dargebotene Hand: 143
Psychosoziale Beratung der Pro Mente Sana: 0848 800 858 (auch für Angehörige, Bürozeiten)
Elternberatung der Pro Juventute: 058 261 61 61 (24/7)
Elternnotruf: 0848 354 555 (24/7)Suchmaschine für Therapeutinnen:
Psychologie.ch oder Psychotherapie.ch (Psychologen)
Psychiatrie.ch (psychiatrische Fachärzte)Die Stiftung Pro Mente Sana bietet weitere Notfallnummern sowie einen «Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit» an, in dem ein sinnvoller Umgang mit psychischen Krisen im nächsten Umfeld geübt werden kann.
Illustration: Till Lauer