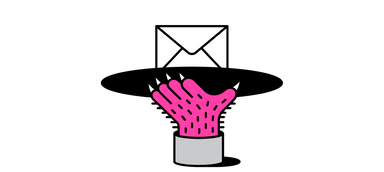
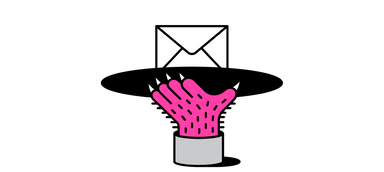
Schweiz will Ukrainer unbürokratisch aufnehmen, Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative – und neue Dienstpflichtvarianten
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (182).
Von Elia Blülle, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 10.03.2022
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Bis gestern Mittwochmittag haben sich 1314 vor dem Krieg geflüchtete ukrainische Staatsangehörige in der Schweiz registriert – 40 Prozent von ihnen sind Kinder und Jugendliche, rund 70 Prozent Frauen und Mädchen. Laut Justizministerin Karin Keller-Sutter will der Bundesrat ihnen und allen weiteren Ukrainern, die ihre Heimat wegen der Kriegshandlungen verlassen müssen, «pragmatisch und unbürokratisch» helfen.
Morgen Freitag wird der Bundesrat die definitive Einführung des Schutzstatus S beschliessen, für den er sich im Grundsatz bereits Ende letzter Woche ausgesprochen hat. Die Schweiz beschreitet damit fast deckungsgleich den Weg der Europäischen Union, deren Rat erstmals die 2001 eingeführte «Temporary Protection Directive» aktiviert. Im Schweizer Asylgesetz verankert wurde der Schutzstatus S vor einem Vierteljahrhundert, nachdem im Zuge der Balkankriege in kurzer Zeit sehr viele Menschen gleichzeitig in die Schweiz geflüchtet waren.
Wie viele Menschen dieses Mal Schutz suchen werden, ist völlig offen und hängt nicht zuletzt von der Dauer des Krieges ab. Momentan rechne sie mit rund 1000 Personen pro Woche, sagte die Staatssekretärin für Migration Christine Schraner Burgener am Montag bei einer Medienkonferenz. Ob die eingangs erwähnte Zahl von 1314 Geflüchteten die Situation adäquat abbildet, ist unklar, weil keine Registrierungspflicht besteht. Seit Juni 2017 dürfen sich Menschen aus der Ukraine ohne Visum während drei Monaten im Schengen-Raum aufhalten.
Insgesamt haben seit dem 24. Februar fast 2,2 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Mehr als die Hälfte von ihnen halten sich laut Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR zurzeit in Polen auf.
Vermutlich wird die Schweiz nicht zu einem primären Fluchtziel. Zum einen, weil hierzulande nur 11’000 Ukrainerinnen leben, wovon 4000 Doppelbürgerinnen sind – während etwa in Italien rund 250’000 Menschen aus der Ukraine leben. Zum anderen, weil erste Erhebungen gezeigt haben, dass 98 Prozent der in die Nachbarstaaten der Ukraine Geflüchteten dort blieben und möglichst bald in ihre Heimat zurückkehren wollten.
Mit dem S-Status werden in die Schweiz Geflüchtete ein Aufenthaltsrecht erhalten, ohne ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Wer hier keine Verwandten oder Bekannten hat oder nicht bei diesen wohnen kann, kommt in ein kantonales Asylzentrum – und dann hoffentlich bald an einen angenehmeren Wohnort. An Angeboten für die private Unterbringung von Geflüchteten mangelt es aktuell nicht: Gemeinsam mit der Kampagnenorganisation Campax halte man rund 30’000 Betten bereit, sagte Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, am Sonntag. Sie spüre eine «fantastische Solidarität» der Bevölkerung. «Wir sind dankbar für jedes zusätzliche Bett, sei es privat, in Hotelzimmern oder leer stehenden Ferienwohnungen.»
Nach einer Wartefrist von einem Monat sollen Ukrainer einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, ihre Kinder sollen unverzüglich die Schule besuchen können. Familiennachzug ist möglich. Der Schutzstatus S befristet den Aufenthalt grundsätzlich auf ein Jahr, er kann jedoch verlängert werden.
Schlechter sind die Aussichten für Menschen, die nicht über einen ukrainischen Pass verfügen, aber ebenfalls aus dem Land fliehen. Drittstaatler sollen in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Immerhin sollen gemäss Bundesrätin Keller-Sutter Personen Schutz erhalten, die schon in der Ukraine Asyl gesucht hatten.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Gletscherinitiative: Nationalrat stimmt Gegenvorschlag zu
Worum es geht: Der Nationalrat sagt Nein zur Gletscherinitiative, die ein Verbot von fossilen Energieträgern ab dem Jahr 2050 fordert. Er setzt stattdessen auf einen direkten Gegenvorschlag. Dieser lehnt ein Verbot ab, will aber – wie das Initiativkomitee – das Netto-null-Ziel bis 2050 in die Verfassung und so die Pariser Klimaziele auf höchster Ebene festschreiben. Besonders umstritten war im Nationalrat die Frage, wie rasch die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen senken soll. Anders als vom Bundesrat vorgeschlagen sprach sich der Nationalrat dafür aus, Zwischenziele festzulegen, die die Bedürfnisse einzelner Wirtschaftszweige berücksichtigen. Damit sollen energieintensive Branchen mehr Zeit für ihre Dekarbonisierung erhalten.
Warum Sie das wissen müssen: Aus klimawissenschaftlicher Sicht muss der Ausstieg aus fossilen Energien so schnell wie möglich erfolgen. Die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat erwartet in den nächsten 20 Jahren einen Technologieschub, der eine kostengünstigere Dekarbonisierung als heute ermöglichen werde. Deshalb lehnt sie eine lineare Senkung der Emissionen ab. Diese würde schon heute viel drastischere Massnahmen erfordern.
Wie es weitergeht: Als Nächstes kommen sowohl die Initiative wie der Gegenvorschlag in den Ständerat. Gleichzeitig arbeitet die Energiekommission des Nationalrats an einem indirekten Gegenvorschlag. Details sind noch keine bekannt. Je nach Ausgestaltung stellen die Initianten in Aussicht, ihre Gletscherinitiative zurückzuziehen.
«Lex Booking»: Nationalrat geht gegen «Knebelverträge» vor
Worum es geht: Hotels sollen künftig Zimmer auf ihrer eigenen Website günstiger anbieten dürfen als auf Buchungsplattformen wie Booking.com. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat der Nationalrat am Dienstag mit 109 zu 70 Stimmen bei 13 Enthaltungen beschlossen.
Warum Sie das wissen müssen: Das Parlament beschäftigt sich bereits seit längerem mit sogenannten Preisbindungsklauseln, die Hoteliers dazu verpflichten, auf ihren eigenen Websites gleich hohe Preise wie auf Buchungsplattformen zu verrechnen. Die jetzige Gesetzesanpassung, auch als «Lex Booking» bezeichnet, geht auf einen Vorstoss von Mitte-Ständerat Pirmin Bischof aus dem Jahr 2016 zurück. Mit der aktuellen Änderung des Gesetzes über unlauteren Wettbewerb (UWG) soll die marktbeherrschende Stellung der grossen Portale beschnitten werden. Heute verfügt Booking.com über einen Marktanteil von 78 Prozent. Booking.com wies in der Vergangenheit den Vorwurf zurück, dass die Hoteliers «Knebelverträge» unterschreiben müssten.
Wie es weitergeht: Das Geschäft geht nun in den Ständerat.
Mindestlohn: Gilt er bald auch für Angestellte aus der EU?
Worum es geht: Kantonale Mindestlöhne sollen auch für Arbeitnehmende gelten, die aus der EU in die Schweiz entsendet werden. Das hat der Nationalrat entschieden. Es war ein seltener Moment, in dem sich SP-Co-Präsident Cédric Wermuth und der Präsident des Gewerbeverbands Fabio Regazzi einig waren. «Ich bin eigentlich gegen Mindestlöhne», sagte Regazzi, «aber es geht hier darum, dass Firmen aus der EU keinen Wettbewerbsvorteil haben.» Wermuth ergänzte, es gehe «darum, die Diskriminierung von Schweizer Unternehmen insbesondere dann zu verhindern, wenn Kantone Mindestlöhne erlassen, die nicht direkt auf entsandte Arbeitnehmende anwendbar» seien.
Warum Sie das wissen müssen: Fünf Kantone haben in den letzten Jahren Mindestlöhne zwischen 19 und 23 Franken eingeführt: die Grenzkantone Genf, Tessin, Neuenburg, Basel-Stadt und Jura. Es ist aber unsicher, ob diese im Fall von aus der EU entsandten Arbeitnehmenden durchgesetzt werden können, da in diesen Fällen nationales und nicht kantonales Recht anwendbar ist. Deshalb droht ein gewisser Lohndruck oder eine Benachteiligung der inländischen Firmen, die sich an die Mindestlöhne halten müssen. Mit dem Beschluss des Nationalrats wird das Entsendegesetz angepasst, um die Durchsetzung kantonaler Mindestlöhne zu ermöglichen.
Wie es weitergeht: Der Nationalrat ist der Erstrat. Die Vorlage muss noch vom Ständerat verabschiedet werden.
Armee: Bundesrat prüft Varianten für neue Dienstpflicht
Worum es geht: Weil der Armee bis Ende Jahrzehnt gegen 30’000 Soldaten fehlen werden, prüft der Bundesrat bis Ende 2024 zwei neue Dienstpflichtvarianten. Das hat er vergangenen Freitag entschieden. Mit der «Sicherheitsdienstpflicht» würden der als attraktiv geltende Zivildienst und der Zivilschutz zu einer Katastrophenschutzorganisation zusammengelegt. Die «bedarfsorientierte Dienstpflicht» wiederum würde die Dienstpflicht auf Frauen ausweiten. Dabei würden nur so viele Personen rekrutiert, wie Armee und Zivilschutz benötigen. Als weitere Massnahme plant der Bundesrat, die Teilnahme am Orientierungstag der Armee auch für Frauen für obligatorisch zu erklären.
Warum Sie das wissen müssen: Der Entscheid ist wegweisend, weil der Bundesrat damit zwei von vier diskutierten Dienstmodellen eine Absage erteilt hat. Bei beiden fehle der klare Bezug zur Sicherheit. So hat die Regierung die Idee einer «Bürgerdienstpflicht» verworfen, die die Dienstpflicht auf Frauen ausgeweitet hätte, die Einsatzmöglichkeiten aber nicht auf Armee, Zivilschutz und Zivildienst beschränkt hätte – auch Leistungen im Gesundheitsbereich, für die Natur und die Umwelt hätten angerechnet werden können. Noch weiter gegangen wäre die «Bürgerdienstpflicht mit Wahlfreiheit», bei der alle diensttauglichen Frauen und Männer frei hätten entscheiden können, welche Art von Dienst sie leisten: Infrage gekommen wären auch Feuerwehrdienst und politische Tätigkeiten.
Wie es weitergeht: Alle Anpassungen der Dienstpflicht bedingen eine Verfassungsänderung. Die Stimmbevölkerung wird also das letzte Wort haben. Die Dienstpflicht ist auch Thema einer anlaufenden Volksinitiative: Der Verein Service Citoyen will, dass alle Schweizerinnen und Schweizer einen allgemeinen Gemeinschaftsdienst leisten – die Idee ähnelt damit der vom Bundesrat verworfenen «Bürgerdienstpflicht mit Wahlfreiheit».
Dissertation der Woche
Akademikerinnen sind im Parlament stark übervertreten: Über 60 Prozent der 2019 gewählten Nationalräte haben einen Hochschulabschluss. Doch hilft ein Studienabschluss auch, um in den eidgenössischen Räten erfolgreich zu politisieren oder zumindest die Entscheidungen der Landesregierung besser zu verstehen? Das ist wohl von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog etwa profitiert im Alltag wohl wenig von ihrer Dissertation, die sie dem Thema Frauenturnen im Kanton Basel-Landschaft im 19. und 20. Jahrhundert widmete. Auch dem Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark hilft sein Wissen über das Scheitern der Ablösung von Zehnten und Grundzinsen in der Helvetik kaum weiter. Der Urner Mitte-Ständerätin Heidi Z’graggen dürfte ihre Dissertation schon mehr bringen, befasste sie sich doch mit der «Professionalisierung von Parlamenten im historischen und internationalen Vergleich».
Aber niemand hat momentan mehr von seiner Dissertation als der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni: «Finanzsanktionen der Schweiz im Staats- und Völkerrecht, dargestellt am Beispiel der Sperrung von Geldern.» So lautet der Titel seiner im November 2008 angenommenen Dissertation («summa cum laude»). Wie kommentiert also der Experte den Kurswechsel der Regierung, die die EU-Sanktionen gegen Russland vorige Woche nach vier Tagen Zögern und Zaudern doch noch übernommen hat? «Dieser kriminelle Aggressionskrieg ist ein existenzieller Angriff auf die europäische Friedensordnung», sagt er und lobt den Bundesrat: «Putins Frevel gehört schärfstens verurteilt und sanktioniert.»
Illustration: Till Lauer