
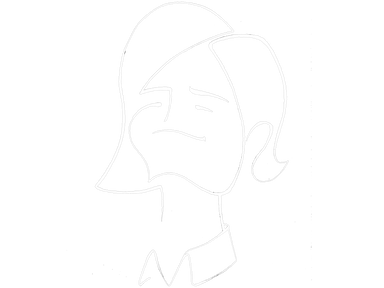
Antisemitismus der Indifferenz
Die Zürcher Stadtratswahlen hinterlassen einen fahlen Nachgeschmack. Bei Tamedia geschehen merkwürdige Dinge. Es geht um dieselbe Frage: den Umgang mit Antisemitismus.
Von Daniel Binswanger, 19.02.2022
Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!
Die Zürcher Journalistenszene wurde diese Woche von einem heftigen Skandal erschüttert. Der Tamedia-Reporter Kevin Brühlmann wurde entlassen und mit sofortiger Wirkung freigestellt.
Offiziell begründet die Chefredaktion die Entlassung mit «unterschiedlichen Auffassungen über Qualität im Journalismus». Brühlmann hat ein Porträt über die jüdische Zürcher Stadtratskandidatin Sonja Rueff-Frenkel veröffentlicht, das üble antisemitische Klischees evozierte und berechtigte Empörung auslöste. Nun wirft allerdings auch seine Kündigung verstörende Fragen auf.
Die Vorgänge bei Tamedia, welche die Republik detailliert rekonstruiert hat, irritieren aus mehreren Gründen: Erstens ist der antisemitisch eingefärbte Artikel von Brühlmann vor der Publikation von nicht weniger als fünf Redaktoren abgenommen worden. Auch ihnen ist offenbar nichts aufgefallen. Warum wird nun der schreibende Journalist bestraft – und werden die verantwortlichen Ressort- und Redaktionsleiterinnen geschont? Das steht im Widerspruch zu banalsten Governanceprinzipien.
Zweitens hat sich Brühlmann umgehend öffentlich für seine Fehlleistung entschuldigt, genauso wie auch die Tamedia. Man kann diese Entschuldigungsgeste unterschiedlich beurteilen, aber sie macht die harsche Maximalsanktion, zu der sich die TX Group nun entschlossen hat, noch wesentlich erklärungsbedürftiger.
Drittens ist belegt, dass Brühlmann schon mit vorhergehenden Recherchen, insbesondere einer Reportage über die Zürcher Baugarten-Stiftung, den Zorn des Verlegers Pietro Supino auf sich gezogen hat. Die Baugarten ist eine finanzstarke Stiftung, die von alteingesessenen Zürcher Familien kontrolliert wird und deren ebenso diskrete wie gemeinnützige Aktivitäten Brühlmanns Artikel mit respektloser, sicher nicht ganz unvoreingenommener Feder in ein kritisches Licht tauchte.
Gemäss den Republik-Recherchen deutet alles darauf hin, dass Brühlmann primär nicht aufgrund seiner in der Tat gravierenden antisemitischen Entgleisung, sondern wegen der Baugarten-Geschichte entlassen wurde. Das würde bedeuten, dass TX-Group-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino hausinterne Zensur übt und in die Publizistik eingreift; dass die Tamedia-Chefredaktion sich nicht vor ihre Journalisten stellt und sich zum willigen Ausführungsorgan der Verlagsetage degradieren lässt; dass man nicht einmal davor zurückschreckt, Antisemitismusvorwürfe zu instrumentalisieren, um sich eines politisch missliebigen Journalisten zu entledigen. Es wäre der medienethische Worst Case – gekleidet in hohle Phrasen über «Qualität im Journalismus».
So beunruhigend diese Vorgänge im mächtigsten Schweizer Verlagshaus auch sind – es sollte nicht vergessen gehen, dass es bei der Brühlmann-Affäre um ein Thema von höchster gesamtgesellschaftlicher Brisanz geht: den Schweizer Umgang mit Antisemitismus. Dies umso mehr, als dieser Medienskandal im unmittelbaren Nachgang zu den Stadtzürcher Wahlen stattfindet, einem Umfeld, das sehr deutlich macht, was für ein massives Problem der Antisemitismus im öffentlichen Diskurs der Schweiz bis heute darstellt – und zwar hauptsächlich deshalb, weil man weiterhin eisern dazu entschlossen ist, ihn als Problem zu ignorieren.
Davon zeugt zunächst einmal das antisemitisch eingefärbte Politikerporträt von Kevin Brühlmann, das er inzwischen zwar ehrlich zu bedauern scheint, das aber nicht den Eindruck macht, ein völlig beliebiger Ausrutscher zu sein. Brühlmann hat ein linkes ideologisches Profil – und er knüpft in seinem Text über Sonja Rueff-Frenkel an spezifische Topoi eines linken Antisemitismus an. Dieser betrachtet «die Juden» als Agenten des internationalen Finanzkapitals, der USA und des Zionismus und gibt seiner Anti-Kapitalismus-Kritik deshalb einen antisemitischen Spin. Warum tut sich in diesem Land die Linke so schwer, sich diesen hässlichen Traditionen zu stellen – und sich entschlossen von ihnen zu befreien?
In Grossbritannien zum Beispiel gab es in den letzten Jahren eine extrem aufgeladene Debatte um linken Antisemitismus in der Labour-Party unter Jeremy Corbyn. Man mag dieser Debatte aus verschiedensten Gründen kritisch gegenüberstehen, aber sie wurde intensiv geführt. In Deutschland ist die Diskussion des linken Antisemitismus im Zuge der Auseinandersetzungen um die propalästinensische Kampagnenorganisation BDS, die zum Boykott des Staates Israel aufruft, ebenfalls in vollem Gang. Sie sucht Antworten auf die Frage, an welchem Punkt die legitime Kritik am Staat Israel in antisemitische Agitation kippt.
Und die Schweiz? Hat wieder einmal Nachholbedarf.
Allerdings ist das Problem natürlich bei weitem nicht auf die kapitalismuskritische Linke beschränkt. Bezeichnenderweise haben bei der Tamedia eine ganze Reihe von Journalistinnen den Text vor seiner Publikation gelesen, ohne dass Einspruch erhoben worden wäre. Weder das Zürich-Ressort des «Tages-Anzeigers» noch die Chefredaktion der Tamedia stehen unter dringendem Verdacht, als ausgeprägt links und kapitalismuskritisch klassifiziert werden zu müssen.
Dennoch hat es auch bei der publizistischen Leitung an minimalster Sensibilität ganz offensichtlich gefehlt. Der deutsch-israelische Historiker Dan Diner redet in einem profunden Essay über die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Holocaust-Erbe von der «eigentümlichen emotionalen wie kognitiven Trägheit», die oft um sich greift, wenn wir uns der Vergangenheit stellen müssen.
Oder ist das Problem weniger die mangelnde Sensibilität als eine alles erdrückende Indifferenz? Manifestiert sich hier wieder einmal die latente, urhelvetische Überzeugung, dass man sich in Sachen Antisemitismus ohnehin nichts vorzuwerfen habe, dass die Schweizer «Weltkriegsinsel» am Holocaust ja in gar keiner Weise beteiligt gewesen sei – und dass es deshalb überhaupt keinen Grund gebe, sich irgendeiner Verantwortung zu stellen? Hier sollten wir den etwas weiteren Zürcher Kontext in den Blick nehmen.
Vor knapp fünf Monaten, aus Anlass der Eröffnung des Kunsthaus-Erweiterungsbaus, hat in Zürich der Bührle-Skandal plötzlich massiv Fahrt aufgenommen und sich bis heute nicht wieder richtig beruhigt. Noch immer ist der Bührle-Leihvertrag nicht veröffentlicht worden, noch immer ist unklar, wie die Überprüfung der Provenienzen der Stiftungsbilder nun angegangen werden soll. Die Behörden scheinen auf Zeit zu spielen.
Allerdings hat der Bührle-Skandal die Zürcher Regierung sehr unsanft mit den vergangenen Versäumnissen ihrer Erinnerungspolitik konfrontiert. Er hat nicht nur während Monaten die Medien dominiert und im Stadt- und Gemeinderatswahlkampf das wohl am meisten diskutierte Thema gesetzt, sondern auch zu vielversprechenden politischen Initiativen geführt. Auf einer entscheidenden Ebene hinterliess das abrupte erinnerungspolitische Erwachen jedoch überhaupt keine Spuren: bei den Zürcher Wahlen selber. Wider alles Erwarten ist der Bührle-Skandal ein elektorales Nicht-Ereignis. Als hätte er nie stattgefunden.
Man kann die Auseinandersetzungen um den Kunsthaus-Erweiterungsbau sicher unterschiedlich beurteilen, aber zwei Aspekte scheinen unstrittig. Erstens herrscht breiter Konsens darüber, dass die politischen Behörden zahlreiche gravierende Fehler gemacht haben bei der Aufgleisung, Aushandlung und Durchführung des Transfers der Stiftungssammlung Bührle in ein öffentlich subventioniertes Museum.
Zweitens ist unbestreitbar, dass der ganze Prozess von Corine Mauch betreut wurde und dass hauptsächlich die Stadtpräsidentin in der Verantwortung steht. Fast die gesamten Schweizer Publikumsmedien – von der NZZ über den «Tages-Anzeiger» bis zum «Blick» – haben diese Kritik immer wieder vorgetragen und damit zum Wahlkampfthema gemacht. Nun aber steht fest: Dem Resultat der Zürcher Wahlen ist das nicht anzumerken. Nicht im Allergeringsten.
Es war immer klar, dass der Bührle-Skandal niemals die Sprengkraft haben würde, um die Wiederwahl von Corine Mauch zu gefährden. Dazu sitzt sie viel zu solide im Sattel. Sie hätte fast einen Drittel ihres bisherigen Stimmenanteils verlieren müssen, um als Stadträtin nicht bestätigt zu werden. Als Stadtpräsidentin war sie ohnehin ungefährdet, da es eine ernst zu nehmende Gegenkandidatur erst gar nicht gab. Nun jedoch zeigt sich: Mauchs aktuelles Resultat ist noch glänzender als vor vier Jahren.
Sie kommt sehr locker auf den ersten Platz unter den Stadtratskandidatinnen, erreicht eine noch etwas höhere absolute Stimmenzahl, distanziert den zweitplatzierten Daniel Leupi noch deutlich stärker als 2018. Es kann kein Zweifel bestehen: Corine Mauch ist durch den Bührle-Skandal überhaupt nicht beschädigt worden. Im Gegenteil: Sie hat ihre Popularität noch einmal deutlich konsolidiert.
Das ist umso erstaunlicher, als sich die Zürcher SP – wenn man als Massstab die Resultate bei den Gemeinderatswahlen nimmt – in einem bedrohlichen Formtief befindet. Ganz offensichtlich hat die Stadtpräsidentin als öffentliche Person von einem Bonus profitiert, der unabhängig ist von der Partei. Es sind ihre Persönlichkeit und ihre Bilanz, die der SP-Politikerin überproportional viele Stimmen eingebracht haben müssen. Dass diese Bilanz bei der Kunsthaus-Erweiterung mehr als umstritten ist, bleibt irrelevant.
Das enttäuschende Abschneiden der AL (die Stimmen verliert) und der Grünen (die viel weniger zulegen als erwartet) bestätigt das Phänomen: Beide Parteien verfolgen im Bührle-Dossier einen dezidiert anderen Kurs als die Zürcher SP und drängen schon seit langen Jahren auf einen historisch verantwortungsvolleren Umgang mit der belasteten Sammlung. Sie positionierten sich damit als eine Alternative zur Zürcher SP, die für ein breites Segment von linken Wählerinnen hätte attraktiv werden können. Auch dieser Effekt lässt sich rein gar nicht feststellen.
Den Zürcher Wählern ist die Bührle-Sammlung letztlich gleichgültig – oder sofern sie irritiert waren, haben sie sich vom überstürzten Last-minute-Kurswechsel der Stadtregierung sofort wieder beschwichtigen lassen. Es ist ihnen gleichgültig, ob der wichtigste Schweizer Waffenlieferant des Naziregimes auf ungebührliche Weise weissgewaschen wird. Es ist ihnen gleichgültig, dass öffentlich subventionierte Zürcher Institutionen sich bis heute dagegen zu sperren scheinen, von NS-Verfolgung betroffenen jüdischen Familien ihr Hab und Gut zurückzugeben. Der Mythos der weissen Weste, die Überzeugung, dass die Schweiz eine Insel der historischen Schuldlosigkeit ist und dass man sich deshalb der Verantwortung erst gar nicht zu stellen hat, scheinen weiterhin von grosser Macht zu sein.
Zwar hat sich der Mediendiskurs stark gewandelt, und das politische System hat darauf reagiert. Vor zwei Tagen nahm der Bundesrat die Motion von SP-Nationalrat Jon Pult (teilweise) an. Es wird nun eine unabhängige Kommission geschaffen, die im Fall von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern Empfehlungen abgibt für Rückgaben oder sonstige «faire und gerechte» Lösungen. Das sind bedeutende Fortschritte, aber wir sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, wie fragil sie bleiben.
Es gibt in der Schweiz, vermutlich noch mehr als in anderen Ländern, einen zähen Antisemitismus der Indifferenz. Nicht explizite Judenfeindlichkeit, sondern ein tief verwurzeltes Gefühl, man sei von diesem Problem ja ohnehin nicht betroffen. Man habe keine Schuld und trage deshalb keine Verantwortung. Man müsse keine Rechenschaft ablegen, weil man von vornherein im Recht sei.
Es ist dieser Antisemitismus der Indifferenz, der die Basis bildete für den Bührle-Pakt zwischen Zürcher Geldadel und Zürcher Sozialdemokratie. Es ist der Antisemitismus der Indifferenz, der in der Tamedia-Redaktion aufpoppt, zu erratischen Entgleisungen und zu zynischen Manövern führt. Es wird noch einen sehr bedeutenden Effort brauchen, bis die Schweiz da wirklich weiterkommt.
Illustration: Alex Solman