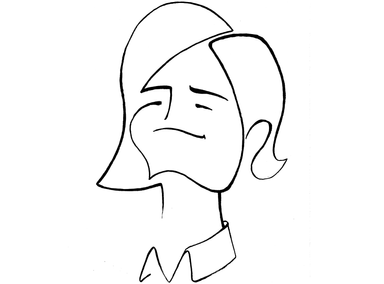
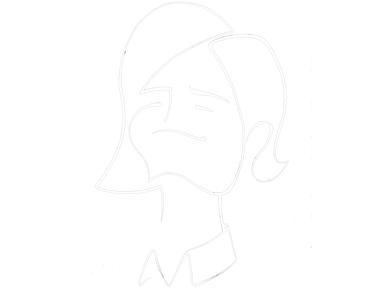
Tyrannei der Minderheit
Die USA gedachten diese Woche des Sturms auf das Kapitol. Der Boden für die nächste Eskalationsstufe ist bereits gelegt.
Von Daniel Binswanger, 08.01.2022
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Wird Trump endemisch werden? Oder wird seine Macht sich schon mit den Midterm-Wahlen 2022 erneut zu einer fast senkrechten Welle auftürmen – der politischen Version einer Omikron-Wand? Das ist die Frage, die der Jahrestag des Kapitol-Sturms quälender werden lässt denn je. Fest steht nur: Genauso wenig wie Covid-19 wird die Trump-Variante des Rechtspopulismus in naher Zukunft verschwinden.
Auch für den Fall, dass der Ex-Präsident 2023 selber nicht mehr kandidieren wird, auch wenn dann eine zwar mildere, aber umso durchsetzungsstärkere Mutante der «Make America Great Again»-Ideologie zum Zug kommen sollte, wird sein Erbe eine tödliche Bedrohung bleiben für die amerikanische Demokratie. Und für die Demokratie rund um den Globus.
Nichts hätte zugleich bedrohlicher und unwirklicher wirken können als das Jubiläum des Angriffs auf den amerikanischen Kongress vor einem Jahr. Es wurden die Opfer gewürdigt, die Schreckensbilder wieder gezeigt, das schockierend häufige «Normalbürger-Profil» der bereits verurteilten Gewalttäterinnen diskutiert. Keine Sekunde aber entstand der Eindruck, eine politische Gemeinschaft finde zusammen in der Zurückweisung eines Angriffs auf ihre Grundfesten und versuche dazu anzusetzen, ihre Wunden zu heilen. Es wird nicht primär der Toten gedacht, nicht die gemeinsame Wertebasis bekräftigt. Es wird eine weitere Schlacht geschlagen im kalten amerikanischen Bürgerkrieg.
Der Kapitol-Sturm beziehungsweise die Ausserkraftsetzung der amerikanischen Demokratie liegt nicht hinter uns, sondern ist eine konkrete Drohung für die nahe Zukunft. Eine grosse Mehrheit der republikanischen Wähler ist überzeugt von der Wahlbetrugslüge, die heute den obersten Glaubensartikel des Trumpismus darstellt. Bereits trifft die republikanische Partei zahlreiche Vorkehrungen, um ethnischen Minderheiten noch gezielter die Teilnahme am Wahlprozess zu erschweren; ihre Kontrolle über das Wahlprozedere und die Validierung der Resultate zu verstärken; im Fall einer Niederlage das Ergebnis noch aggressiver bestreiten zu können als vor gut einem Jahr. Indem die Republikanerinnen die Legitimität der Wahlen untergraben und den Regierungswechsel trotz unzähliger Überprüfungen seiner Korrektheit als Betrug denunzieren, haben sie sich von den Grundlagen des liberalen Verfassungsstaates verabschiedet.
Immer häufiger üben die Republikaner die Macht aus in einer numerischen Minderheitenposition und erobern sowohl die Präsidentschaft als auch die Senatsmehrheit nur deshalb, weil das antiquierte amerikanische Wahlsystem zu Verzerrungen führt, die sie begünstigen. Aus den Konzessionen an föderalen Ausgleich und an den Schutz vor plebejischen Mehrheiten, um die es den amerikanischen Verfassungsvätern ging, ist im Lauf der Zeit die Pervertierung des Demokratieprinzips geworden.
Der Politologe Corey Robin sieht im Angriff auf das Kapitol die Übersteigerung einer Haltung, welche die Republikanische Partei schon lange prägt und die im Jahr 2000 noch einmal eine entscheidende Beschleunigung fand: George W. Bush vollzog damals eine Art legalen Staatsstreich und liess sich vom Supreme Court die Präsidentschaft zuschanzen – obschon er insgesamt klar weniger Stimmen gemacht hatte als Al Gore und sich im entscheidenden Bundesstaat Florida nur mit der hoch umstrittenen juristischen Verhinderung zusätzlicher Nachzählungen durchsetzen konnte.
Natürlich erscheint ein Verfahren vor dem Supreme Court aus heutiger Perspektive wie eine fast unvorstellbar gewordene Idylle der Rechtsstaatlichkeit: besser ein problematischer Richterspruch als ein mordender Mob. Schon damals aber erhob die Grand Old Party die Missachtung des Mehrheitsprinzips und das verfahrenstechnische Unterwandern des Wählerwillens zum Kern ihrer Machtstrategie. Es wurde eine Entwicklung angeschoben, die mit dem Kapitol-Sturm letztlich bloss ihre Fortsetzung fand.
Nur ein Jahr nach dem gewaltsamen Angriff auf die amerikanische Demokratie – ein bisschen wie in einem Albtraum, in dem man in Zeitlupe, und scheinbar, ohne sich bewegen zu können, dem Heraufziehen einer Katastrophe zusehen muss – werden wir zu Zeugen, wie sich das Werk des oligarchischen Machtanspruchs weiter fortsetzt. Die Publizistin und Russland-Expertin Masha Gessen, eine der profiliertesten Kritikerinnen des «soften» Totalitarismus von Wladimir Putin, weist darauf hin, wie schockierend es sei, dass alles sich so normal anfühle. Häufig würden dramatische Epochenbrüche erst im Rückblick als solche erkannt – erst wenn es zu spät ist.
In der Sehnsucht nach einer autoritären Minderheitsherrschaft treffen sich allerdings die beiden hauptsächlichen Klientelgruppen des heutigen Konservatismus: eine Finanzoligarchie, die sich von den Steuer- und Umverteilungsansprüchen des Staates bedroht sieht, und grosse Teile der weissen Unterschicht, die sich von der zunehmenden ethnischen Diversität der USA in die Minderheit versetzt fühlen. Die Allianz dieser Minderheiten ist zur Grundlage des politischen Paktes geworden, der die Republikanische Partei heute trägt.
Die Grand Old Party ist deshalb zu einer extrem radikalen politischen Kraft geworden, die zwar minoritär bleibt, aber dennoch die Voraussetzungen mitbringt, beide Häuser des Kongresses und die Präsidentschaft zu erobern. Es mag den Demokraten gelingen, dies bei den nächsten Wahlen zu verhindern. Die Gefahr, dass sie daran scheitern, ist jedoch real. Die bisherige «Führungsmacht der freien Welt» würde sich zur «illiberalen Demokratie» entwickeln. Viktor Orbán hat eine ganz buchstäbliche Vorbildfunktion bekommen in Teilen der konservativen Bewegung. Der Fox-Starpräsentator und potenzielle Trump-Nachfolger Tucker Carlson hat diesen Sommer sogar seine Show nach Budapest verlegt, um Lobgesänge auf Viktor Orbán, den Verteidiger «der westlichen Zivilisation, der Demokratie und der Familie», anzustimmen.
Präsident Joe Biden hat zum Jahrestag des Kapitol-Sturms nun eine scharfe Rede gehalten, in der er sich gegen den Angriff auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verwahrt. Ex-Präsident Jimmy Carter hat in der «New York Times» einen Aufruf unter dem Titel «Ich habe Angst um unsere Demokratie» veröffentlicht.
Die führenden Stimmen der amerikanischen Politologie zeigen sich alarmiert wie noch nie: etwa Francis Fukuyama, der sagt, Amerikas Rolle als Vorbild für Demokratie sei an einem einzigen Tag zerstört worden und totalitäre Mächte wie Russland und China würden sich die Finger lecken. Oder Harvard-Professor Steven Levitsky, dessen Analyse ebenfalls an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt: «Wir sind in einer schrecklichen Situation, in der eine der beiden grossen Parteien sich nicht mehr an die Spielregeln der Demokratie hält. Keine andere etablierte westliche Demokratie ist mit derselben Bedrohung konfrontiert, nicht in so akuter Weise jedenfalls.»
Natürlich ist es nicht hilfreich, dass Joe Biden nach einem Jahr Präsidentschaft eine gemischte Bilanz vorweist – auch wenn sie weiterhin deutlich positiver sein dürfte, als sie wahrgenommen wird. Für das Afghanistan-Desaster, das er weitgehend geerbt hat, kann er allerdings nur zu Teilen verantwortlich gemacht werden. Das jüngste Scheitern des Umwelt- und Sozialpakets ist in der Tat ein arger Dämpfer, verursacht wurde es aber vom erbitterten republikanischen Widerstand und vom demokratischen Rechtsabweichler Joe Manchin, der die hauchdünne demokratische Senatsmehrheit in Eigenregie zum Absturz bringen kann. Ein Präsident, der nicht beide Kammern hinter sich hat, ist nur sehr begrenzt handlungsfähig, und die Blockademöglichkeiten des Senats tun ein Übriges zur Paralyse des Regierungssystems. Die Republikaner spielen dasselbe zynische Spiel wie schon unter Obama: Sie betreiben maximale Obstruktion – und denunzieren, dass sich nichts bewegt.
Die amerikanische Demokratiekrise strahlt jedoch nicht nur auf Russland und China aus, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt, dass eine so tief gespaltene Nation wie die amerikanische militärisch wohl nur noch reduziert handlungsfähig ist. Auch für die politische Entwicklung in Europa dürfte das amerikanische Vorbild wieder wegweisend werden.
Am greifbarsten wird dies heute in Frankreich, wo Eric Zemmour sich zur Vorbildfunktion des Trumpismus komplexfrei bekennt – auch nach dem Kapitol-Sturm. Ganz offensichtlich hat Zemmour keinerlei Berührungsängste mit der offenen Verachtung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, mag er die amerikanische Vulgarität auch etwas belächeln. Trumps autoritäre Neigung und Xenophobie hingegen passen fugenlos zu Zemmours ideologischem Profil. Und die ungebrochene Herrschaft des Trumpismus über das konservative Amerika ist sein bestes Argument, um die Kraft der Agenda zu beglaubigen.
Etwas vorsichtiger müssen vorderhand noch die Schweizer Trump-Fans aus dem nationalkonservativen Lager operieren. Sich nicht vom Kapitol-Sturm zu distanzieren, wäre vorderhand unschicklich. Man unterstreicht stattdessen das Genie seiner Agenda-Setzungskraft (gerne im grossen Interview mit Trump-Bewunderer Zemmour), gibt sich überzeugt, dass eine jüngere Nachfolgerin, falls Trump sich zurückzieht, sein Werk noch brillanter vollenden könnte – und lässt die republikanische Fortführung der Wahlbetrugslüge ganz einfach aussen vor. Alles kein Problem. Sollte Trump in einem Jahr seine Kandidatur verkünden, werden ihm auch hierzulande seine Fans von gestern wieder begeistert zujubeln. Demokratiepathos ist immer gut für Sonntagspredigten. Aber deshalb von der oligarchischen Agenda abrücken?
Der 6. Januar lässt keinen Zweifel: Eine extrem virulente Mutation des Rechtspopulismus wird bestenfalls endemisch. Der demokratiepolitische Verlauf kann durchaus tödlich sein. Wie bei allen Epidemien wird nur eines helfen: Abwehrkräfte.
Hinweis: Dass sich im Angriff auf das Kapitol eine Haltung übersteigert zeigt, welche «die Republikanische Partei schon immer geprägt hat», ist in dieser Absolutheit nicht gerechtfertigt und überzogen. Die Stelle ist entsprechend angepasst, wir danken für den Hinweis aus der Leserschaft.
Illustration: Alex Solman