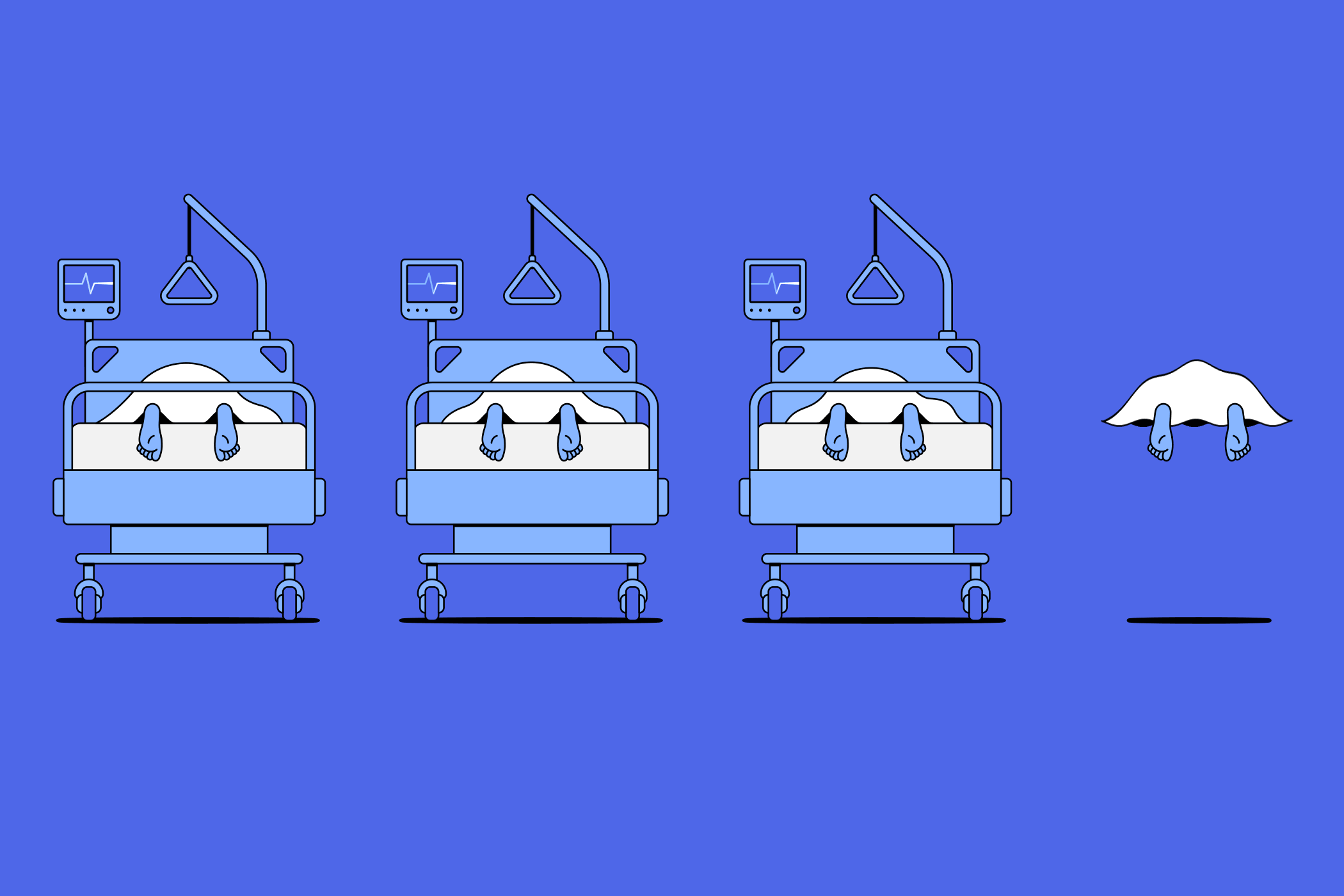
Zu intensiv
Seit heute gelten neue harte Pandemiemassnahmen. Der Grund: Auf den Intensivstationen der Spitäler können zu wenig Betten betrieben werden – weniger als in vergangenen Wellen. Aber warum eigentlich?
Von Lukas Häuptli (Text) und Till Lauer (Illustration), 20.12.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Wann haben Sie letztmals eine Nacht durchgearbeitet? Eine ganze Nacht, sagen wir neun Stunden lang?
Durchgearbeitet, hoch konzentriert, weil halb konzentriert tödlich sein könnte?
Pflegefachpersonen auf den Intensivstationen der Schweizer Spitäler machen das in bemerkenswerter Regelmässigkeit. Tagdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Drei Schichten, die letzte dauert meist von 22 bis 7 Uhr. Die Pflegefachfrauen betreuen da schwerst kranke Patienten, immer mehr sind schwerst kranke Covid-Patienten. Sie steuern die überlebensnotwendige Medikamentenabgabe. Überwachen Herz, Lunge, alles. Rund um die Uhr.
Die Arbeit auf der Intensivstation gilt als eine der anspruchsvollsten in der Pflege überhaupt. Mit der Corona-Pandemie und der steigenden Zahl von Patientinnen ist sie noch anspruchsvoller geworden. Und noch belastender.
Belastender zum Beispiel deshalb, wie eine Pflegefachfrau erzählt: «Stirbt ein Patient, muss alles ruckzuck gehen. Beatmungsgerät abschalten, Katheter entfernen, Toter aus dem Zimmer raus, Toter in den Kühlraum rein. Schliesslich wartet bereits der nächste Schwerstkranke auf das Bett.»
10 Prozent der Betten fallen weg – mindestens
Tag für Tag weist der Bund aus, wie viele der 873 offiziell zertifizierten Betten noch frei sind auf den Intensivstationen oder, wie sie offiziell heissen, Intensivpflegestationen (IPS) der Schweizer Spitäler. Ende letzter Woche waren es 149. Die Zahl ist gegenwärtig eine der ganz harten Währungen in der politischen und gesellschaftlichen Debatte darüber, wie schlimm oder nicht schlimm die Corona-Lage in der Schweiz ist.
Fälschlicherweise, denn die statistische Genauigkeit trügt. Das Problem auf den Intensivstationen ist nicht die Zahl der freien Betten. Sondern die Zahl der Pflegefachfrauen, welche die Patienten in diesen Betten betreuen können.
Es sind, so viel steht fest, zu wenige. Und es werden immer weniger. Auf fast allen Intensivpflegestationen fehlt gegenwärtig spezialisiertes Pflegepersonal, auf manchen Stationen fehlen auch die spezialisierten Ärztinnen.
Wegen des personellen Notstands müssen zahlreiche Spitäler jetzt gar einen Teil ihrer zertifizierten Intensivbetten schliessen. Das hat eine Umfrage der Republik bei einem guten Dutzend Kliniken in der Schweiz ergeben.
Da heisst es zum Beispiel:
«Als Folge personeller Engpässe müssen mitunter kurzfristig Betten gesperrt werden.» (Universitätsspital Zürich)
«Aktuell sind mehrere zertifizierte Betten geschlossen, da uns trotz der Personalverschiebungen aus dem Bereich der Anästhesie für den Vollbetrieb der Betten das Personal fehlt.» (Inselspital Bern)
«In der Klinik, die mit 22 zertifizierten Betten über eine grosse IPS verfügt, können aufgrund des Fachkräftemangels zurzeit leider nicht alle Betten betrieben werden. Die Klinik ist dazu gezwungen, die Kapazität teilweise um zwei bis vier IPS-Betten zu reduzieren.» (Hirslanden Zürich)
«Wir verfügen über total 36 zertifizierte Intensivplätze. Davon können wir aktuell 27 betreiben.» (Kantonsspital St. Gallen)
Die Liste liesse sich beliebig verlängern. Unter dem Strich fallen derzeit rund 10 Prozent der 873 zertifizierten Intensivpflegestation-Betten wegen fehlendem Pflegepersonal weg, wie eine Hochrechnung der Republik ergibt. Womöglich sind es gar mehr.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt Hans Pargger, Chefarzt der Intensivstation des Universitätsspitals Basel und Präsident der Kommission, welche die Intensivbetten in der Schweiz zertifiziert. Das Personal reiche lediglich für 750 bis 800 Betten auf Intensivpflegestationen, sagte er gegenüber Tamedia. «Alles, was darüber hinausgeht, hat bereits Abstriche bei den Betreuungsstandards oder die Verschiebung von geplanten Eingriffen zur Folge.»
Gegenwärtig liegen auf den Intensivstationen der Schweizer Spitäler über 700 Patienten; mehr als 40 Prozent von ihnen sind schwerst kranke Covid-Patientinnen. Die grosse Mehrheit von ihnen ist nicht geimpft. Wegen der hohen Auslastung und des fehlenden Personals müssen Ärzte mittlerweile auch Triage-Entscheide fällen und dringliche Operationen verschieben, wie unter anderem ein Beitrag der «Rundschau» von SRF zeigt.
Christina Schumacher von der Berner Sektion des Schweizerischen Berufsverbands für Pflegefachpersonal sagt dazu: «Vor allem die hohe Zahl der ungeimpften Covid-Patienten und -Patientinnen bringt das System der Intensivstationen an den Anschlag.»
«Das Personal ist müde und frustriert»
Währenddessen verschärft sich der Pflegenotstand fast täglich.
Einerseits werden immer mehr Covid-Patienten auf die Intensivstationen eingeliefert, deren Betreuung noch aufwendiger ist als diejenige der anderen Patientinnen.
Andererseits fallen mehr und mehr Pflegefachpersonen aus. Die einen müssen in Quarantäne, die anderen erkranken, die dritten kündigen. «Aufgrund von Kündigungen und Krankheitsausfällen hat sich der Personalmangel auf der Intensivstation im Vergleich zum Vorjahr verschärft», sagt Petra Ming, Sprecherin des Berner Inselspitals. Zudem: «Nach bald zwei Jahren Pandemie verschärft sich die Lage auch wegen der allgemeinen Erschöpfung des Personals», sagt Anita Kuoni vom Kantonsspital Baselland.
Noch deutlicher wird Dorit Djelid, Sprecherin des Spitalverbands H+: «Es ist kein Ende des Tunnels in Sicht. Das Personal ist müde und frustriert. Die Bevölkerung könnte Solidarität zeigen, indem sie sich vorbehaltlos impfen liesse. Doch das macht sie nur ungenügend.»
Seit Ausbruch der Pandemie haben 10 bis 15 Prozent aller Intensiv-Pflegefachpersonen in der Schweiz gekündigt. Selbst die Pflegeinitiative, welche die Stimmberechtigten am 28. November 2021 wuchtig angenommen haben, wird am Personalnotstand kurz- und mittelfristig wenig ändern. Bis deren Forderungen nach zusätzlichen Ausbildungsplätzen und besseren Arbeitsbedingungen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe umgesetzt sind, wird es Monate dauern.
Fünf Jahre Studium
Wer sich – trotz alldem – vorstellen könnte, als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann auf einer Intensivstation zu arbeiten, sollte ein paar Fakten kennen:
Es braucht dafür ein dreijähriges Studium an einer Fachhochschule oder einer höheren Fachschule sowie ein zweijähriges berufsbegleitendes Nachdiplomstudium. Letztes Jahr schlossen rund 250 Personen dieses Zusatzstudium ab. Der Anfangslohn liegt zwischen 5000 und 7000 Franken, dazu kommen Schichtzulagen von ein paar hundert Franken pro Monat.
Wie überall in den Spitälern leisten festangestellte Pflegefachpersonen auf den Intensivstationen regelmässig Spät-, Nacht- und Wochenenddienste. Das ist wenig familien- und freundeskreisverträglich.
Wegen der physisch und psychisch äusserst anspruchsvollen, anstrengenden und belastenden Arbeit auf den Intensivstationen betreut eine spezialisierte Pflegefachfrau grundsätzlich einen einzigen Patienten. Das ergibt für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung einen Bedarf von 2,5 Vollzeitstellen. Grundsätzlich. Wegen des Personalmangels kommen mittlerweile auf eine Pflegende bis zu drei Patientinnen – und die Pflegende ist längst nicht mehr immer eine Spezialistin, sondern oft eine Pflegefachperson ohne Zusatzausbildung oder ein Student, der diese noch nicht abgeschlossen hat.
Die letztes Jahr ausgebildeten Intensivpflegerinnen reichen angesichts des Bedarfs der Spitäler nirgends hin. Deshalb suchen die Kliniken weiter nach spezialisierten Arbeitskräften. Und sie locken mit zusätzlichen Anreizen. Sie erhöhen die Löhne (wie etwa das Kantonsspital Baselland) oder gewähren zusätzliche Freitage (wie die Hirslanden-Kliniken).
Weil sie so dringend zusätzliches Personal brauchen, konzentrieren die Spitäler ihre Suche fast ausschliesslich auf den Temporär-Arbeitsmarkt. «Bei uns treffen jeden Tag zahlreiche Anfragen für diplomiertes Intensivpflegepersonal ein», sagt Conny Bacher von der Stellenvermittlungs-Firma Careanesth. Und die Geschäftsführerin einer anderen Vermittlungsfirma, die ihren Namen nicht in den Medien lesen will, sagt: «Spitäler suchen für ihre Intensivstationen zum Teil sehr kurzfristig Pflegepersonal. Es kann sein, dass eine Pflegeperson innert ein paar Stunden nach der Anfrage mit ihrer Arbeit auf der Intensivstation anfangen soll.»
Meist bleibt die Suche allerdings erfolglos: «Wegen der Pandemie funktioniert auch der Temporär-Arbeitsmarkt nicht mehr», sagt Anita Kuoni, Sprecherin des Kantonsspitals Baselland. Und Michael Bommel, Chef der Vermittlungsfirma Medical Jobs Schweiz, sagt: «Es ist nahezu aussichtslos, Pflegefachpersonen für eine Intensivstation zu finden.»
Das gilt für die Suche in der Schweiz, das gilt aber auch für die Suche im Ausland. Da hatten die Spitäler in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich Pflegepersonal angeworben. Allein in den letzten Jahren migrierten mehr als 20’000 Personen aus dem Ausland in die Schweiz, um hier als Pflegefachleute zu arbeiten. Bekannt sind diese Zahlen, weil die Fachabschlüsse aus den Herkunftsländern der Migrierenden in der Schweiz anerkannt werden müssen; der Bund hat das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) mit der Beurteilung der entsprechenden Gesuche beauftragt.
Mittlerweile stammt rund ein Drittel der etwa 80’000 Pflegefachleute aus dem Ausland. Das ist auch Folge davon, dass in der Schweiz schlicht zu wenig entsprechende Fachkräfte ausgebildet werden.
3100 Pflegefachpersonen aus dem Ausland – allein im ersten Corona-Jahr
Jetzt zeigt sich, dass die Zahl der ausländischen Pflegefachpersonen in der Schweiz während der ersten Phase der Pandemie stark gestiegen ist. 2020, im ersten Corona-Jahr also, bewilligte das Schweizerische Rote Kreuz rund 3100 Gesuche von Ausländern um Anerkennung ihrer Abschlüsse. Das waren rund 20 Prozent mehr als 2019, wie ein Auswertung des SRK zeigt.
Die meisten der neu anerkannten Pflegefachfrauen stammten aus Frankreich (rund 1750 Personen), gefolgt von Deutschland (rund 450), Italien (300), Belgien (knapp 150) und Portugal (100). Andere kamen aber auch aus Rumänien, Brasilien, Indien, Kasachstan oder Burkina Faso.
«Die Zunahme der Gesuche von ausländischen Pflegefachpersonen ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen», sagt Marc Bieri vom Schweizerischen Roten Kreuz. «Wegen der Pandemie haben Spitäler und Heime deutlich mehr Bedarf an zusätzlichem Personal.»
Die Nachfrage nach Pflegepersonal aus dem Ausland ist in der Pandemie weiter gewachsen. Doch offensichtlich ist das Angebot begrenzt. Darauf deutet, dass im laufenden Jahr die Zahl der entsprechenden Gesuche wieder leicht gesunken ist, aber immer noch bei fast 3000 lag.
Marc Bieri sagt dazu: «Während der Corona-Pandemie hat jedes Land versucht, seine Pflegefachpersonen zu halten.» In der Tat haben zahlreiche Staaten in den letzten Monaten die Löhne ihres Pflegepersonals erhöht und deren Arbeitsbedingungen verbessert – aus Angst, dass sie in andere Länder abwandern.
Das heisst: Der internationale Kampf um das rare Gut «Pflegepersonal» ist endgültig entbrannt.
Der sieht zum Beispiel so aus: Die Schweiz holt einen Teil ihres Pflegefachpersonals aus Deutschland, Deutschland wiederum aus Polen, Polen aus der Ukraine und die Ukraine aus Moldawien. Oder so: Die Schweiz rekrutiert Personal in Frankreich und Frankreich in Togo. Mal ist die Kette länger, mal kürzer, immer aber fehlen am Ende der Kette die Menschen. Meist ist das dort, wo die Gesundheitsversorgung sowieso nur schlecht funktioniert.
Das Phänomen wird beschönigend als «Care-Migration» beschrieben. Und weniger beschönigend als «Medical Braindrain». Die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert es seit Jahren, ihre Mitgliedstaaten haben 2010 einen «Verhaltenskodex für die grenzüberschreitende Anwerbung von Gesundheitsfachkräften» verabschiedet. Der Kodex enthält allerdings lediglich Empfehlungen, ist entsprechend unverbindlich und hat in der Praxis bis jetzt kaum etwas bewirkt.
Und die Schweiz?
«Das Thema der Migration von Gesundheitspersonal steht seit mehreren Jahren auf der internationalen Agenda», sagt Katrin Holenstein vom Bundesamt für Gesundheit. «Die Schweiz trägt sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene dazu bei, diese Herausforderung anzugehen.»
Auch das tönt ziemlich unverbindlich. Und ändert nichts daran, dass das Schweizer Gesundheitswesen noch immer überdurchschnittlich viele im Ausland ausgebildete Pflegefachleute beschäftigt, wie die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, festhält.
Der harte Kampf um das Pflegepersonal zeigt sich in der Schweiz derzeit auch daran, dass sich zahlreiche Intensivpfleger lieber temporär als fest anstellen lassen. So können sie auf höhere Löhne und sozial kompatiblere Arbeitszeiten pochen, wie eine Pflegefachfrau erzählt. Darauf zum Beispiel, dass sie ausschliesslich am Tag arbeiten können. Den Spitälern bleibt nichts anderes übrig, als auf die Bedingungen der Arbeitnehmenden einzugehen. Die Folge: Die Nachtschichten müssen die verbliebenen Festangestellten übernehmen.
Sie erinnern sich? Nachtarbeit. Neun Stunden. Hoch konzentriert. Weil halb konzentriert tödlich sein kann.