
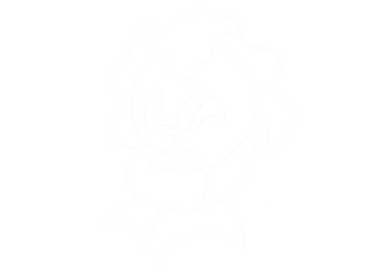
Sieg der Askese
Historisch ist der fette Körper ein Symbol von Widerstand und Subversion. Warum ist er heute schambesetzt?
Von Daniel Strassberg, 26.10.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
«Erst kommt das Fressen, dann die Moral.» Als Bertolt Brecht die «Dreigroschenoper» schrieb, bedachte er nicht, dass das Essen selbst moralische Fragen aufwerfen kann. Und damit auch politische, etwa im Hinblick auf die globale Verteilung der Nahrungsmittel (Hunger), auf den Einfluss auf das Klima (Methanausstoss der Kühe) und auf das Übergewicht in der westlichen Welt (Gesundheitskosten). Vor dem globalen Hunger und der Klimaerwärmung können wir die Augen notfalls verschliessen. Vor dem Übergewicht nicht, insbesondere vor dem eigenen nicht. Der Übergewichtige trägt buchstäblich schwer an seiner Schuld.
Im letzten halben Jahr habe ich 11 Kilo abgenommen, und ich versuche, noch mal so viel wegzukriegen (der BMI liegt nach wie vor über 30). Es war ein ziemlich schwieriges Unterfangen, wie man sich unschwer vorstellen kann. Ich habe dieses heautontimorumenon (Kants Ausdruck für Selbstquälerei) nicht aus gesundheitlichen Gründen auf mich genommen, obschon mein Hausarzt mir den baldigen Tod vorausgesagt hat, wenn ich nicht abnähme. Nein, es war nicht die Todesangst, es war die Scham, die mich antrieb.
Scham ist schlimmer als der Tod, das wusste schon Kafka: «‹Wie ein Hund!› sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben», lautet der letzte Satz des «Prozesses». Und so habe ich mich gefühlt: Ich ging nicht mehr in die Badeanstalt, konnte mich im Spiegel kaum mehr ansehen und kaufte nur noch Kleider, die meine Figur verdeckten. Schon wieder gelogen: Ich kaufte sie nicht, ich musste sie eigens anfertigen lassen.
Als ich etwa 8 Kilo abgenommen hatte, begann ich mich allerdings zu fragen, wofür ich mich eigentlich schäme. Oder andersrum gefragt: Weshalb lacht man jemanden für sein Übergewicht aus? Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, dass Übergewicht jene «Behinderung» ist, für die Kinder am häufigsten ausgelacht, ausgeschlossen und gemobbt werden.
Weshalb also gelten der Dicke und noch mehr die Dicke als lächerlich?
Die erste intuitive Antwort, dass sie ihr Unglück selbst verschuldet haben, ist wenig plausibel, denn niemandem würde es je einfallen, einen Querschnittgelähmten auszulachen, der ohne Helm Fahrrad gefahren und dabei gestürzt ist. Nein, Selbstverschulden reicht nicht, um diese seltsame Mischung aus Abscheu und Lächerlichkeit zu erklären, die Übergewichtige begleitet. Dazu müssen wir ein wenig in die Geschichte eintauchen.
Im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erfand ein gewisser Menippus von Gadara – im heutigen Jordanien – eine neue Literaturgattung, die seither als menippeische Satire bekannt ist. Die wohl bekannteste ist der «Satyricon» von Petron, der 1969 von Federico Fellini verfilmt wurde. Von Menippus selbst sind keine Werke erhalten, aber Lukian von Samosata, der Grossmeister der menippeischen Satire, machte ihn zum Protagonisten eines seiner bekanntesten Werke: «Menippus oder das Totenorakel».
Menippus möchte das Geheimnis des guten Lebens ergründen und lässt sich deshalb ins Totenreich schmuggeln, um von den verstorbenen Geistesgrössen zu erfahren, wie man richtig zu leben hat. Doch er wird bitter enttäuscht: Im Jenseits herrscht keineswegs jene Harmonie und Schönheit, die in den Schriften der griechischen Philosophen in Aussicht gestellt wurde. Im Gegenteil, es wird gefressen, gesoffen und herumgehurt. Nur Sokrates bleibt standhaft, aber er erweist sich dafür als nervtötender Besserwisser.
Einzig der blinde Seher Teiresias weiss vernünftigen Rat: Das beste und vernünftigste Leben ist das der Ungelehrten. Gib die Narrheit auf, den überirdischen Dingen nachzugrübeln und den Ursprung und letzten Zweck der Dinge erforschen zu wollen; verachte die künstlichen Schlüsse der Sophisten und halte dich überzeugt, dass alle diese Dinge eitle Possen sind. Hingegen sei dein einziges Streben darauf gerichtet, die Gegenwart dir zu Nutzen zu machen, so viel du kannst. Im Übrigen gehe an den meisten Dingen mit Lachen vorüber und halte nichts für wichtig genug, um dich darum zu bemühen.
Teiresias propagiert – fast zweitausend Jahre vor Nietzsche – das Lachen als Lebenshaltung; kein hämisches Auslachen, sondern ein politisches, widerständiges Lachen, das sich vor allem gegen das platonische Schönheitsideal wendet. Im Gastmahl klärt die Priesterin Diotima Sokrates auf:
Es muss nämlich der, welcher auf dem richtigen Wege auf dies Ziel hinstrebt, in seiner Jugend sich den schönen Körpern zuwenden, und zwar zuerst, wenn sein Führer ihn richtig leitet, einen solchen schönen Körper lieben. Um des Urschönen willen muss er von den vielen Schönen ausgehen und so stufenweise innerhalb desselben immer weiter vorschreiten, bis er schliesslich das allein wesenhafte Schöne erkennt.
Den wohlproportionierten Körper des schönen Jünglings liebt man nicht um seiner selbst willen, sondern weil er Ausgangspunkt auf dem Weg zur Wahrheit ist. Dazu darf der schöne Körper aber nichts Übermässiges, Schmutziges oder Hervorstechendes aufweisen – deshalb der kleine Penis. Und er hat keine Körperöffnungen, die mit der Umgebung in Austausch stehen können. Der schöne Körper ist glatt und geschlossen.
Nietzsche hat klar erkannt, dass gegen die Lebensfeindlichkeit der Ideale nur der Spott hilft:
Und gerade weil wir im letzten Grunde schwere und ernsthafte Menschen und mehr Gewichte als Menschen sind, so thut uns Nichts so gut als die Schelmenkappe: wir brauchen sie vor uns selber – wir brauchen alle übermüthige, schwebende, tanzende, spottende, kindische und selige Kunst, um jener Freiheit über den Dingen nicht verlustig zu gehen, welche unser Ideal von uns fordert.
Später richteten sich die menippeischen Satiren nicht mehr gegen die platonische Philosophie und ihr Schönheitsideal, sondern gegen die christliche Askese und ihre Körperfeindlichkeit. Im Mittelalter entstand daraus eine eigentliche Gegenwelt: Satirische Evangelien, satirische Predigten, satirische Gottesdienste und satirische Festtage feierten den Unsinn, das Lachen, die Masslosigkeit, die Völlerei und die Sittenlosigkeit. Die übergewichtigen Helden dieser Gegenwelt waren zugleich Sinnbilder der Lebensfreude und des Widerstandes gegen die Kirche.
Es war zwar nicht so, dass man um die Gefahren der Völlerei nicht wusste, regelmässig verenden die Protagonisten der Satiren im Laufe einer Fresserei. Aber darum ging es ihnen ja: Während die platonische Philosophie und die Kirche die Ewigkeit und das Jenseits predigten, verkörperten die Dicken den Wandel, das Entstehen und Vergehen, die Geburt und den Tod. Die Ähnlichkeit der Dicken mit den schwangeren Frauen zeugt davon, Obelix und Bud Spencer sind davon noch schwache Reminiszenzen. Das Lachen galt demnach weniger der politischen Macht als ihrer verlogenen Ideologie, die das Leben und den Genuss ins Jenseits verschieben wollte.
Jedenfalls kam die Kirche, unter dem Druck des Volkes, nicht mehr darum herum, diese Gegenwelt zu akzeptieren und ihr einen Platz einzuräumen: Die Fastnacht wurde ein fester Bestandteil des Kirchenjahres.
Als letztes menippeisches Werk gilt François Rabelais’ «Gargantua und Pantagruel» oder wie der volle Titel lautet: «Die schrecklichen und entsetzlichen Abenteuer und Heldentaten des hochberühmten Pantagruel, König der Dipsoden, Sohn des grossen Riesen Gargantua. Neu zusammengestellt von Meister Alcofrybas Nasier».
Und so klingt das bei Rabelais:
Und sie drangen ihm [dem Riesen Gargantua, der soeben in Paris angekommen ist] also beschwerlich zu Leib, dass er zuletzt gezwungen war, sich auf die Türme von Notre-Dame zu retirieren und niederzulassen. Wie er nun da sass und dies viele Volk um sich her sah, sprach er laut: «Ich glaub, die Schlingel meinen, dass ich ihnen hie mein Pflastergeld und meinen Willkomm zahlen soll. Ist billig; sollen ihren Wein han, aber par ris, per risum, spottweis.» – Da lupft’ er lächelnd seinen schönen Hosenlatz, zog sein Ablaufrohr an die Luft herfür und bebrunzelte sie so haarscharf, dass ihrer 260’018 elend ersoffen, ohn die Weiber und kleinen Kinder.
Das Bild «Der Kampf zwischen Karneval und Fasten» von Pieter Bruegel dem Älteren aus dem Jahre 1559 markiert das Ende eines fruchtbaren Dialogs zwischen der offiziellen Kirche und ihrer kritischen Gegenwelt. Das ausschweifende Leben kam als politischer Protest nicht mehr vor, nur asketische Lebensformen, wie die der pietistischen Sekten in Deutschland und der Puritaner in England, konnten noch als politische Kritik durchgehen.
Im aufstrebenden Bürgertum hatte der männliche Körper der Produktion, der weibliche der Reproduktion zu dienen. Dafür musste er fit bleiben, groteske Übertreibungen und vulgäres Treiben hatten keinen Platz mehr, das war der Gesundheit abträglich. Die Medizin war besorgt, dass die Produktions- und Reproduktionsmaschinerie nicht stillsteht, dafür musste sie den Körper gründlich vermessen und erforschen. Entsprechend veröffentlichten Ärzte in der Zeit der beginnenden Industrialisierung Hunderte von Fibeln mit Ratschlägen für das gesunde Leben, die ausgewogene Ernährung und den hygienischen Sex.
Der Körper hat sich vom Ausdrucksmittel zum Kapital gewandelt, dessen Besitz das Überleben sichert.
Seither ist Fettleibigkeit kein Zeichen des Widerstandes und der Lebensfreude mehr, sondern eine krankhafte Anomalie, die der ärztlichen Kunst überantwortet wird. Im Jahre 1832 erfindet der Statistiker Adolphe Quetelet den BMI (Body-Mass-Index) und schliesst damit die Normalisierung des Körpers ab. Der Körper hat als Ort des politischen Widerstandes ausgedient.
Natürlich kann niemand leugnen, dass Übergewicht ein erhebliches gesundheitliches Risiko darstellt. (Obwohl meist verschwiegen wird, dass leichtes Übergewicht das Leben verlängert und Übergewicht ohne Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck kein Risiko darstellt.) Aber die Faszination, die Fettleibigkeit auslöst und die in zahlreichen voyeuristischen Fernsehshows wie «The Biggest Loser» eifrig zelebriert wird, die Vehemenz, mit der sie bekämpft wird, und die Heftigkeit der Abscheu, die sie auslöst, legen den Verdacht nahe, dass die Fettleibigen eine unbewusste Erinnerung an die Zeiten wachrufen, als das Lachen und der Exzess noch einen Widerstand gegen die Obrigkeit darstellten.
Der gesunde Arbeiter- und Soldatenkörper als politisches Kapital feierte im Faschismus und im sowjetischen Kommunismus seinen letzten grossen Höhepunkt. Seither wären Normierung und Disziplinierung des Körpers für Arbeit und Reproduktion eigentlich nicht mehr nötig. Maschinen übernehmen immer mehr die körperliche Arbeit, und die Reproduktionsmedizin ist auf einen gesunden weiblichen Körper zunehmend nicht mehr angewiesen. Tatsächlich schien in der Zeit nach 1968 die Befreiung des Körpers möglich geworden zu sein, nun allerdings weniger durch die Todsünde der Völlerei – obschon der Film «La grande bouffe» von Marco Ferreri aus dem Jahre 1973 auch diese Möglichkeit durchspielte – als durch die der hippiekommunären Unzucht.
Aber um den Widerstand des Körpers zu brechen, musste dem unbotmässigen Treiben dennoch ein Ende gesetzt werden, und wieder kam die Medizin zu Hilfe. Mit dem Aufkommen des HI-Virus verbot sich ungeregelter Sex von selbst, und bald löste er dieselbe Empörung und Abscheu aus wie einst die Fettleibigkeit.
Die sexuelle Befreiung ist danach in ihr Gegenteil umgeschlagen: Der nackte Körper blieb zwar sichtbar, aber er wurde entsexualisiert. Statt zu einem Hort der widerständigen Lust wird er zum Ort der Normalisierung und Disziplinierung. Er muss schlank sein, um auf dem Markt bestehen zu können. Die enthemmte Sexualität wurde als symbolisches Kapital nach kurzer Zeit in das Herrschaftsdispositiv zurückgeholt – im Gegensatz zur Fettleibigkeit, die nach wie vor ausgeschlossen bleibt. Dazu eine nette Anekdote: Kürzlich öffnete in Tokio das erste Nacktrestaurant seine Tore. Wer sich allerdings bei der Gewichtskontrolle am Eingang als übergewichtig erweist, wird nicht eingelassen.
Illustration: Alex Solman