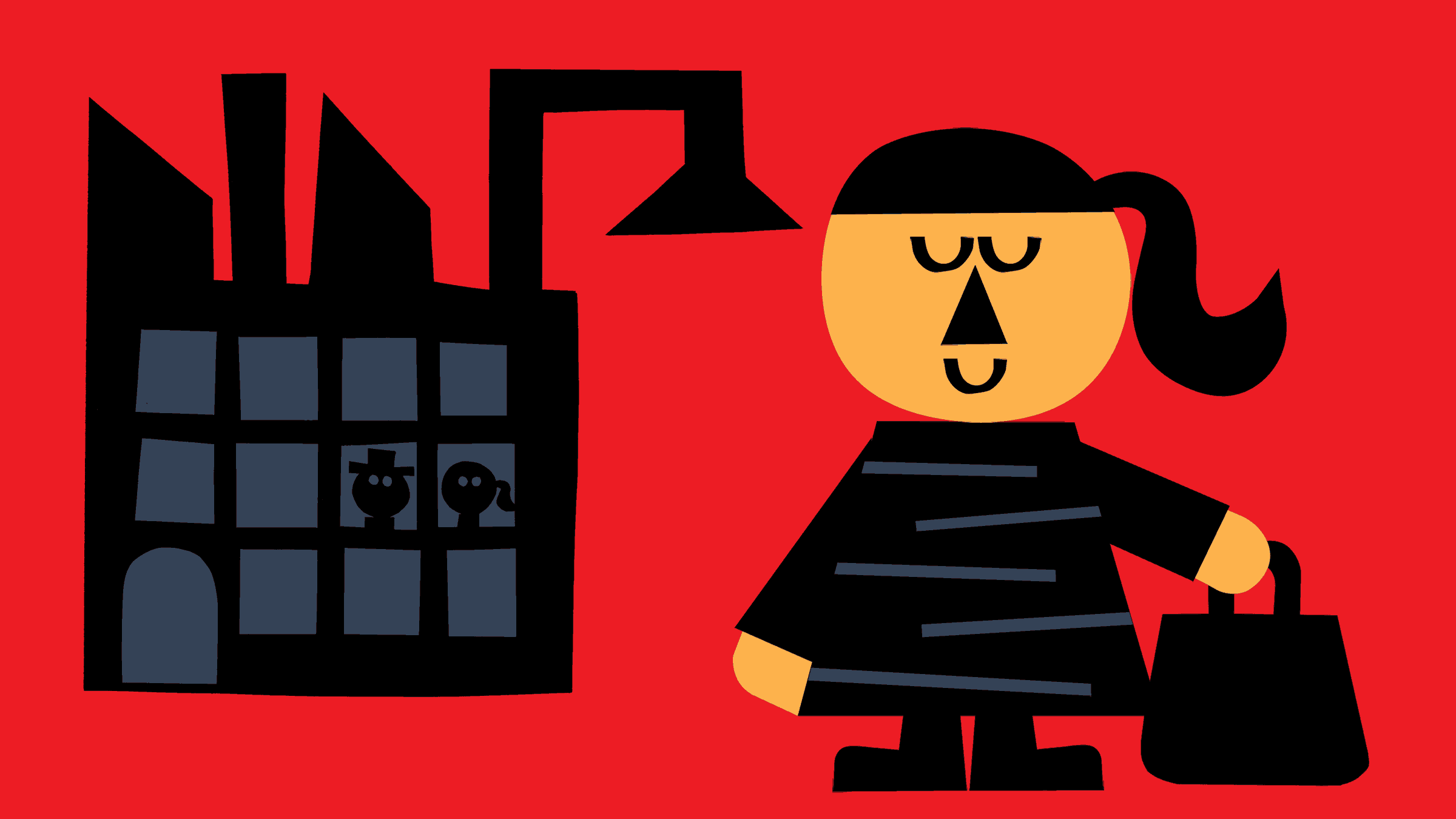
Warum Sie mit Arbeit niemals reich werden
Es liegt nicht an Ihnen: Die nüchternen Gründe.
Von Olivia Kühni (Text) und Adam Higton (Illustration), 15.09.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie ist unabhängig, werbefrei und komplett leserfinanziert. Fast 30'000 Menschen machen die Republik heute schon möglich. Sie wollen mehr wissen? Testen Sie die Republik 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich:
Es gibt in der protestantisch und bäuerlich geprägten Schweiz kaum einen heiligeren Glauben als den an die Meritokratie: die Herrschaft derjenigen, die es verdienen. Oder etwas direkter: Fleiss zahlt sich aus. Leistung wird sich lohnen. Wer hart arbeitet, wird reich.
Der folgende Satz grenzt in diesem Land an Blasphemie, und genau darum muss er ausgesprochen werden: Nein, Lohnarbeit wird Sie nicht reich machen. Egal, wie viel, wie hart, wie clever Sie arbeiten. Und auch nicht, wenn Sie sehr gut verdienen.
Sie sind leider nicht gemeint, wenn «Eat the Rich» an einer Mauer prangt oder wenn Politikerinnen versprechen, Superreiche oder Grossvermögen stärker zu besteuern.
Und hier folgt, warum.
1. Womit Ihr Lohn vor allem zu tun hat
Lohnarbeit bedeutet, dass Sie Ihre Arbeitskraft an jemanden verkaufen, der Sie dafür bezahlt. Sie geben Ihre Zeit, und dafür bekommen Sie Geld. Wir alle glauben gerne, die Höhe dieses Lohns habe mit unserer Leistung zu tun, vor allem, wenn wir ordentlich verdienen. Das stimmt manchmal, und die meisten Menschen geben sich sicher die meiste Zeit ziemlich Mühe. Nur: Noch viel mehr hat Ihr Lohn damit zu tun, in welcher Branche und für welche Firma Sie arbeiten.
Anders gesagt: Es kommt nicht so sehr darauf an, wie gut Sie schwimmen – es kommt vor allem darauf an, in welchen Fluss Sie steigen.
Ein 45-jähriger Bäcker in der Nordwestschweiz verdient laut der im ganzen Land regelmässig erhobenen Lohnstatistik ungefähr 6500 Franken im Monat. Der Ingenieur mit Fachhochschulabschluss, der die Maschinen für den Bäcker herstellt, ungefähr 9800 Franken. Dieser Unterschied hat mit sehr vielem zu tun: mit der allgemeinen Arbeitsmarktlage, mit Gewohnheit, Ausbildungsunterschieden und Diskriminierungen (Frauen und Nichtschweizer verdienen oft weniger), vor allem auch mit Machtverhältnissen und Arbeitskampf. Noch entscheidender aber ist dies: Niemand kann und wird Ihnen für eine Stunde Ihrer Arbeit mehr bezahlen, als er selbst in dieser Stunde einnimmt. Das wäre eine fast schon naturgesetzliche Unmöglichkeit; Ihr Arbeitgeber wäre innert kürzester Zeit bankrott. Das bedeutet: Wie viel Geld Sie bekommen, hängt vor allem davon ab, wie viel Geld Ihr Arbeitgeber mit seinem Business verdienen kann.
Nehmen wir an, Ihre Firma nimmt im Monat von all ihren Kundinnen 200’000 Franken ein. Nachdem Miete und Strom, alle Rohmaterialien, Versicherungen, Steuern und so weiter bezahlt sind, bleiben noch 100’000 Franken Gewinn in der Kasse. Dann wird Ihre Firma, wenn die Eigentümer aussergewöhnlich bescheiden sind und keinen Rappen für sich behalten, all ihren Mitarbeiterinnen zusammen monatlich maximal 100’000 Franken an Lohn ausbezahlen können – mehr ist schlicht nicht da.
Tatsächlich sind es üblicherweise eher 70’000 Franken, die sie im genannten Beispiel ausbezahlt: In Schweizer Unternehmen fliessen durchschnittlich jeweils etwa 70 Prozent des Gewinns über die Löhne an die Mitarbeiter. (So viel beträgt in der Schweiz die sogenannte Lohnquote, ein im internationalen Vergleich hoher Wert.) Die übrigen 30 Prozent des Gewinns gehen an die Eigentümer. Dafür, dass sie ihr Kapital dieser Firma zur Verfügung stellen, es also nicht anderswo investieren oder verprassen. Das dürfen Sie je nach politischer oder persönlicher Haltung skandalös, einigermassen angemessen oder zumindest unvermeidlich finden. Eine Tatsache bleibt davon unberührt: Über Ihrem Monatslohn hängt immer ein Deckel, ganz egal, wie hart Sie schuften. Das, was Ihre Firma in demselben Monat verdient.
Das kann mehr oder weniger sein – mehr dazu gleich –, aber es ist immer begrenzt. Sie können in der Schweiz mit Lohnarbeit durchaus materiell gut leben, Sie können ohne Zweifel ein zufriedener Mensch sein und ein gelungenes Leben führen. Nur: Wirklich reich werden Sie damit nicht.
Das liegt daran, dass Sie als Lohnarbeiterin ein Mensch sind. Und dass Sie darum immer nur an einem Ort zu einer Zeit wirken können.
Ganz im Gegensatz zum Kapital.
2. Sie haben keinen Hebel
Weil die Schweiz ein Land mit einer mächtigen meritokratischen Erzählung ist, ein Land auch, in dem Arbeit und Bescheidenheit hochgeschätzt sind, messen viele Menschen Einkommensunterschieden eine hohe Bedeutung zu. Sie stellen «Niedrigverdiener» den «Gutverdienerinnen» gegenüber. Manche sehen dann die Differenz als Belohnung für gute Taten, andere empfinden sie als Ungerechtigkeit. Und viele fänden es richtig, wenn alle mit viel Lohn vergleichsweise mehr als heute zum gemeinsamen Staat beitragen.
So etwa schlägt die 99-Prozent-Initiative auf ihrer Website an prominenter Stelle vor, mit den erwarteten Mehreinnahmen aus den Kapitalsteuern nicht alle Arbeitseinkommen zu entlasten, sondern lediglich «tiefe und mittlere».
Dieser Blick ist durchaus folgerichtig in einem Land, das seinen Staat viel stärker mit Steuern auf Einkommen als mit Steuern auf Vermögen finanziert. (Im Kanton Bern beispielsweise zu 67 Prozent.) Er zielt aber bei aller guten Absicht am tatsächlichen Spektakel vorbei: Der wirklich grosse Unterschied besteht nicht zwischen denen, die mit ihrem Job etwas mehr, und denen, die damit etwas weniger verdienen. Sondern zwischen denen, die nur von ihrer Erwerbsarbeit leben, und denen, die das nicht oder nur teilweise müssen. Oder, in den Worten der Berner Patrizierin Elisabeth de Meuron: «Syt dihr öpper oder nämet dihr Lohn?»
Natürlich, es gibt beachtliche Lohnunterschiede. Mit dem Verkauf hochkomplexer Maschinen lässt sich tendenziell mehr Geld verdienen als mit dem Verkauf von Brot. Wer die heiklen finanziellen Geheimnisse seiner Kundinnen hütet, wird dafür in der Regel mehr verlangen können als ein Coiffeur fürs Haareschneiden. Wer wohlhabenden Kunden Versicherungen verkauft, kann dafür im Allgemeinen mehr verbuchen als eine Firma, die Hemden reinigt. Darum – und wegen der einen oder anderen Verzerrung und Ungerechtigkeit – verdienen Maschinenbauingenieurinnen üblicherweise mehr als Bäcker, Banker mehr als Coiffeusen und Versicherungsmathematikerinnen mehr als Reinigungsangestellte. (Und überall, wo etwas halb oder ganz illegal ist, haut es die Margen richtig hoch: Schweigen kostet.)
Das am wenigsten verdienende Zehntel der Vollzeit-Arbeitnehmer in der Schweiz bekommt im Schnitt monatlich weniger als 4100 Franken netto. Das einkommensstärkste Zehntel mehr als 10’700 Franken. Das sind grosse Unterschiede. Doch wirklich dramatisch werden sie erst, wenn Sie das Spielfeld wechseln: von der Erwerbsarbeit zum Kapital.
In dem Moment also, wo Sie nicht mehr einfach angestellte Bäckerin sind. Und auch nicht Eigentümerin einer Bäckerei. Sondern dann, wenn Sie eine ganze Reihe von Bäckereien hochziehen – eine Kette von Filialen, von denen jede den Restgewinn nach Abzug der Löhne an Sie abliefert. So, als würden Sie überall eine dünne Schicht Rahm abschöpfen. So, als hätten Sie sich durch einen gespenstischen Zauber vervielfacht und würden an Dutzenden, Hunderten Orten gleichzeitig wirken. Sie haben sozusagen nicht mehr nur ein Leben, sondern Tausende gleichzeitig: Das ist die Magie des Kapitals.
Ein Unternehmen zu gründen, es allenfalls gar an die Börse zu bringen oder zu verkaufen, ist Ihre einzige Chance auf Reichtum, falls es für Sie auf dem üblichen Weg – erben oder gut heiraten – nicht geklappt hat. Sie finden diese Aussage blasphemisch? Die Welt von Jane Austen und Gustave Flaubert ist nicht ganz so weit entfernt, wie die meritokratische Mittelschicht oft glaubt: Jeder zweite Vermögensfranken in der Schweiz ist heute vererbtes Geld. Und die Lage spitzt sich zu. 1996 gaben Bürgerinnen noch insgesamt 36 Milliarden Franken an ihre Erbinnen weiter; 2020 waren es geschätzte 95 Milliarden Franken. (Das ganze Ausmass und die Details der Erberei hat Kollege Elia Blülle hier sehr schön analysiert.)
Falls Sie weder geerbt, gut geheiratet noch ein erfolgreiches Unternehmen gegründet haben, können Sie kaum mehr reich werden. Immerhin aber zumindest etwas wohlhabend – indem Sie versuchen, klug zu investieren. Beispielsweise in Wohneigentum. Wenn Sie das richtig und vorsichtig und an guter Lage tun und stetig etwas Hypothekarschulden abzahlen, werden die allgemeine Stabilität der Schweiz und die Zeit für Sie arbeiten. Auch hier schuften Sie also nicht alleine, sondern Sie haben einen kleinen Hebeleffekt: einerseits durch das Geld, das Ihre Bank zuschiesst. Andererseits durch den stetigen Einsatz aller Bürgerinnen, der die Schweiz zu einem sicheren und wohlhabenden Ort macht – und Ihre Immobilie zu einer soliden Anlage.
Der Haken ist nur: Auch dafür brauchen Sie ein wenig Kapital, also Erspartes. Wenn Sie tatsächlich nur von Ihrer Lohnarbeit leben, ist das sehr schwierig aufzutreiben: weil sehr viele Menschen Ende des Monats kaum mehr etwas auf dem Konto haben.
Und zwar zu Ihrer eigenen Überraschung auch dann nicht, wenn Sie eigentlich ganz gut verdienen. Aber auch das ist nicht wirklich Ihr Fehler. Es liegt nicht – oder zumindest nicht nur – an Ihnen.
3. Sie füllen die Kasse von anderen
Für die meisten Menschen, insbesondere für Familien, sind die Wohnkosten der mit Abstand grösste Posten in ihrem Haushaltsbudget. (Hinzu kommen Kinderbetreuung und Krankenversicherung, dazu später.)
Ausgerechnet beim Wohnen aber stehen Sie als Lohnarbeiterin wiederum Leuten gegenüber, die auf der lukrativeren Seite des Spielfelds unterwegs sind als Sie. Bei Immobilien zeigt sich noch deutlicher als überall sonst die faszinierende Wirkungsmacht von Vermögen.
Gewohnt werden muss immer. Mietliegenschaften in einem stabilen und wohlhabenden Land wie der Schweiz gehören deshalb wenig überraschend zu den beliebtesten Investitionsobjekten sehr vermögender Menschen und Investmentgesellschaften. In Zeiten sehr niedriger Zinsen – in der Schweiz ist das Geld derart im Überfluss vorhanden, dass seit einiger Zeit sogar Zinsen bezahlen muss, wer sein Vermögen auf dem Bankkonto lagert – gilt das noch mehr als zuvor.
«Im 18. Jahrhundert war die mit Abstand grösste Vermögensklasse das Farmland», stellte «The Economist» 2020 fest. «Im 19. Jahrhundert eroberten diesen ersten Platz die Fabriken, die die industrielle Revolution vorantrieben. Heute sind es die Wohnimmobilien.» Das Magazin schätzt, dass weltweit 170 Billionen Dollar – also 170’000 Milliarden – in Wohnliegenschaften angelegt sind. Gleichzeitig ist attraktiver Boden knapp. Darum sind die Immobilienpreise an Standorten wie Berlin, London, San Francisco, Zürich oder Genf im letzten Jahrzehnt explodiert.
Es ist keine Polemik, sondern nüchterne ökonomische Tatsache: Hätten städtische Eigentümer, Genossenschaften und eine beachtliche Zahl anständiger Privateigentümerinnen nicht stoisch im Wohnungsmarkt von Zürich oder Genf ausgeharrt, könnten viele Menschen, die nur von ihrer Erwerbsarbeit leben, dort nicht mehr wohnen. Doch insbesondere Mieter, die neu Wohnraum suchen, haben oft keine Chance auf einen günstigen Vertrag.
Das bringt Sie als Lohnarbeiter in einen ärgerlichen Teufelskreis. Sie leben in Ihrer teuren Mietwohnung und steuern damit monatlich etwas zum Vermögensaufbau Ihrer Hauseigentümerin bei – nach dem gleichen Prinzip, wie die Bäckereifiliale langsam und stetig die Kassen ihrer Eigentümer füllt. Sicher: Vielleicht sind Sie damit durchaus zufrieden, weil Sie gerne in einer Mietwohnung leben und weil Mieten auch einiges an Arbeit, Ärger und Risiko einspart. Vielleicht aber würden Sie lieber selber ein kleines Vermögen aufbauen und Wohneigentum kaufen. Doch dann begegnen Sie wieder dem alten Problem: Sie haben als reiner Lohnarbeiter wenig Chancen.
Erstens werden Sie bei der Immobiliensuche wiederum auf Menschen treffen, die – geerbt oder gut geheiratet – deutlich mehr Geld bieten können als Sie, falls Sie tatsächlich immer nur von Ihrem Erwerbseinkommen gelebt haben. Sie kommen gar nicht erst ins Rennen. Vielleicht haben Sie aber Glück und treffen auf eine gute Gelegenheit.
Dann kommt das Problem, dass Sie ausreichend Startkapital brauchen – was als Lohnarbeiterin, eben, Erspartes bedeutet. Das aufzubauen, fällt Ihnen aber ja gerade deshalb schwer, weil Sie Monat für Monat stattdessen die Kassen Ihrer Vermieterin füllen. Das Ergebnis dieses ewigen Hamsterrads: Nur geschätzte 10 Prozent aller Mieterinnen bringen genug Geld zusammen, um Wohneigentum zu kaufen.
Allerdings: Das liegt nicht nur an der Immobilien-Bonanza rundherum. Sondern auch an politischer Dummheit. Denn das System im Mittelklasseland Schweiz sorgt dafür, dass Mittelschichtsfamilien oft wenig davon haben, wenn sie mehr verdienen.
4. Die Politik baut Ihnen eine Klippe
Vor einigen Jahren sorgte eine Studie der Universität St. Gallen für einige Aufregung unter Ökonominnen: Die Untersuchung stellte fest, dass obligatorische öffentliche Abgaben – Steuern, Krankenversicherung, AHV-Beiträge und so weiter – vor allem Haushalte mit mittleren Einkommen so sehr belasten, dass sie am Schluss weniger zum Leben übrig haben als Niedrigverdiener. Erst wenn man richtig gut verdient – das einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung –, schenkt der hohe Lohn ein.
Man muss diese Studie relativieren, wie es die Autorinnen auch selber deutlich tun. Der grössere Teil dieser Umverteilung ist ein Umschichten an sich selber in verschiedenen Lebensphasen: als Lohnarbeiterin mit mittlerem Lohn gibt man in seinen einkommensstärkeren Jahren Geld ab, das man in weniger erträglichen Zeiten wieder zurückbekommt – bei frischer Mutterschaft, Krankheit, Arbeitslosigkeit, im Alter. Das bedeutet, dass der Staat weit weniger zwischen verschiedenen Haushalten umverteilt, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Tatsache ist aber: Dort, wo er es tut, geschieht es tatsächlich oft auf denkbar ungeschickte Weise. Nämlich so, dass sich zusätzliche Erwerbsarbeit nicht wahnsinnig lohnt.
Wenn Sie als Lohnarbeiter ähnlich leben wie die meisten Menschen im Land und wenn Sie Kinder haben, dann sind Ihre grössten fixen Budgetposten nach der Miete die Steuern, die Kinderbetreuung und die Krankenversicherung. Wie die Politik Erwerbstätigen dabei Frust beschert, lässt sich besonders gut am Beispiel der Kinderbetreuung aufzeigen.
Weil man in der Schweiz die Eigenverantwortung schätzt und «das Giesskannenprinzip» verabscheut, ist die Kinderbetreuung im Vorschulalter nicht für alle öffentlich finanziert (da gäbe es verschiedene Modelle), sondern gilt grundsätzlich als Privatsache. Weil sich die Notwendigkeit wie auch die beachtlichen Kosten der Kita-Betreuung aber doch nicht einfach wegschweigen lassen – in den Städten nutzt sie mehr als jede zweite Familie –, behilft man sich mit verschiedenen kantonalen Subventionssystemen. Diese funktionieren unterschiedlich, haben aber fast alle eines gemeinsam: eine eingebaute Klippe. Also eine Einkommensschwelle, über der Sie keine Subventionen mehr erhalten.
Das hört sich vorbildlich fair an – bloss kein Giesskannenprinzip. Aber nur so lange, bis Sie die- oder derjenige sind, für den oder die es gerade nicht mehr reicht.
In der Stadt Zürich beispielsweise liegt die Klippe für einen Paarhaushalt mit zwei Kindern ungefähr bei einem gemeinsamen steuerbaren Einkommen von 130’000 Franken. Kommen Sie drüber, bezahlen Sie für drei Tage in der Kita je nach Alter Ihrer zwei Kinder zwischen 2900 und 3500 Franken. Bei einem gemeinsamen steuerbaren Einkommen von 84’000 Franken sind es immer noch mindestens rund 1700 Franken. Genau dort aber – bei 84’000 Franken – liegt das mittlere steuerbare Haushaltseinkommen von verheirateten Paaren in der Stadt Zürich.
Das heisst: Bei Lohnarbeitern mit einem mittleren Einkommen gehen beachtliche Teile ihres Lohnes nicht nur für die Miete drauf, sondern auch für die Kinderbetreuung. Hinzu kommt noch die Krankenversicherung. Hier liegt die Klippe für die staatliche Prämienverbilligung bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern im Kanton Zürich etwa bei einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von rund 86’000 Franken. (In Bern wären es 83’000 Franken, in Glarus 89’000 Franken.) Auch hier also stolpern Sie – politisch gewollt – schnell über die Grenze.
Kein Wunder also, kommen Sie auf keinen grünen Zweig, sobald Sie eines Tages Kinder haben. (Wenn Sie in einem Einelternhaushalt leben, erhalten Sie zwar mehr Unterstützung, verdienen aber auch deutlich weniger. Und haben Sie keine Kinder, zahlen Sie dafür deutlich mehr Steuern.)
Dass das übrigens in unterschiedlichem Ausmass im ganzen Land gilt, zeigen die Zahlen der regelmässig wiederholten landesweiten Haushaltsbudgeterhebung. Ein mittlerer Haushalt mit Kindern hat laut Bundesamt für Statistik nach Abzug aller obligatorischen staatlichen Ausgaben von seinem monatlichen Bruttoeinkommen von 11’817 Franken noch 8550 Franken übrig. Nach Abzug der Miete, aller Versicherungen und Konsumkosten bleiben im Schnitt knapp 2000 Franken für Vorsorge und Sparen. Wer auf eine Fremdbetreuung der Kinder angewiesen ist, um dieses Einkommen zu erreichen, fällt schnell gegen null.
Nicht zuletzt dieses System sorgt übrigens dafür, dass Mütter als Zweitverdienerinnen oft nicht mehr als 60 Prozent erwerbstätig sind: Stocken sie auf, zahlt sich der zusätzliche Stress wegen der hohen Kita-Kosten und der zusätzlichen Steuern kurzfristig kaum aus, wie unter anderen ein Ökonomenteam von Avenir Suisse aufgezeigt hat. Noch mehr Hamsterrad für die ganze Familie – und trotzdem kaum mehr auf dem Konto.
Mit anderen Worten: Statt von den wirklich Reichen zur Mitte umzuverteilen, sorgt die Schweizer Politik also dafür, dass nicht nur Niedrigverdienerinnen, sondern auch Lohnarbeiter mit mittlerem und hohem Einkommen kaum etwas Nennenswertes zur Seite legen können.
Das wissen auch die Schlaueren unter den Jusos, wenn sie zur 99-Prozent-Initiative schliesslich doch vorschlagen, mit den erhofften Zusatzeinnahmen nicht nur die Steuern auf «tiefen und mittleren Arbeitseinkommen» zu senken. Sondern stattdessen beispielsweise in gebührenfreie Kitas oder ins Gesundheitssystem und Prämienverbilligungen zu investieren. (Den Verdacht, dass ihre Initiative nicht nur die wirklich Reichen trifft, werden sie trotzdem nicht ganz los.)
Also – was sollen Sie tun?
Vergessen Sie das Märchen, dass möglichst viel möglichst harte Arbeit Sie reich machen wird. Arbeiten Sie stattdessen aus Freude und Überzeugung (oder auch nicht) – und sorgen Sie mit kluger Politik dafür, dass dieses Land die Erwerbstätigen etwas öfter tatsächlich entlastet, statt einfach nur die Mittelschicht umzurühren.
Geniessen Sie das Leben, es ist Ihr einziges. Machen Sie gelegentlich Pause. Und gönnen Sie anderen ihr Erbe und ihre gute Heirat.
Wenn Sie mögen, sprayen Sie trotzdem einmal selber genüsslich «Eat the Rich» an die Wand.
Einfach, weil es ein wirklich guter Slogan ist.