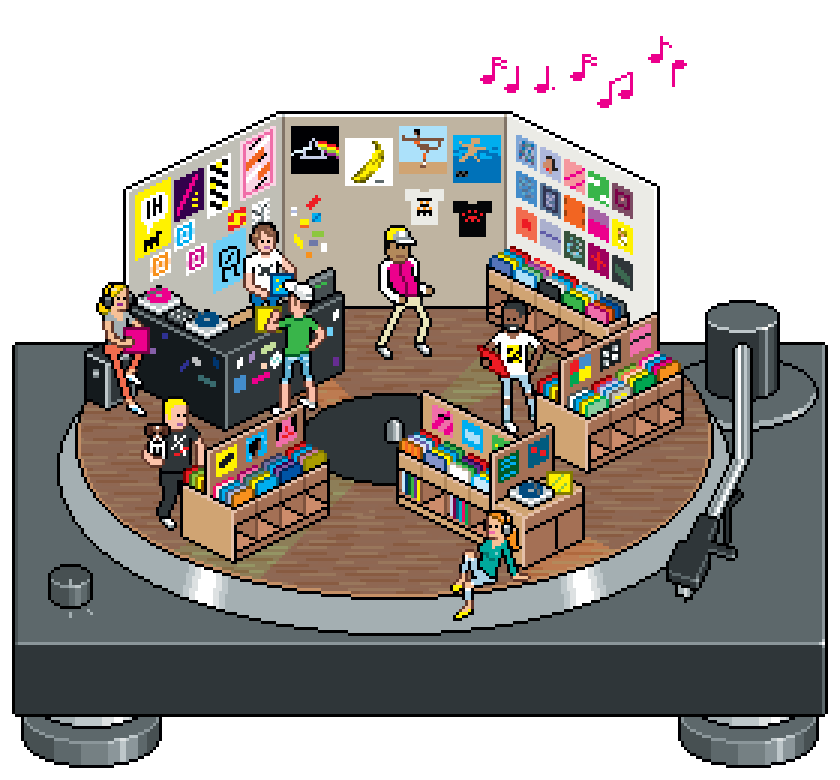
Das wird dir gefallen
Streaming statt Plattenladen: Wie nichts zuvor hat die Technologie den Pop verändert. Wenn wir wollen, dass die Popmusik überlebt, müssen wir unser Konsumverhalten radikal überdenken. «No one can hear you stream», Teil 1.
Von Tobi Müller (Text) und Quickhoney (Illustration), 08.09.2021
Erinnert sich noch jemand an den Plattenverkäufer im Plattenladen? Wir benutzen hier bewusst die männliche Form, denn ihn zu gendern, wäre unpassend. Sein Ruf ist ähnlich ramponiert wie jener des Boomers und des alten weissen Mannes. Mehr Boomer geht gar nicht als diese schlecht gelaunten Dudes, die in der vordigitalen Zeit über die Ware und das coole Wissen wachten. Ihre Hochachtung musste man sich erarbeiten, mit dem Kauf der richtigen Alben und mit den richtigen Kommentaren an der Kasse. Mit etwas Glück wurde man nach ein paar Jahren mit Namen gegrüsst.
Heute ist der Plattenverkäufer ein ehemaliger Plattenverkäufer. Virginie Despentes hat in drei Teilen den Gesellschaftsroman seines Abstiegs geschaffen, «Das Leben des Vernon Subutex», ein internationaler Bestseller. Die französische Autorin schreibt gnadenlos, genau, lustig. Aber nicht hämisch, ihre Sympathie gehört ihrem Helden. Die meisten anderen denken wohl: Plattenläden braucht kein Mensch mehr. Gut, dass das vorbei ist.
Auch wenn es für Nostalgie tatsächlich nicht viele Gründe gibt: Musikstreaming, die vorerst endgültige Abschaffung des Plattenverkäufers, ist ein Erdbeben. Das Ausmass der Zerstörung zeigt sich allerdings nicht sofort. Denn das neue Angebot ist teuflisch gut.
«Sitting with the devil, this is what I learnedHilltop Hoods – «An Audience with the Devil»
apart from the ways a human soul can be burned»
Heute leuchtet alles in Farbe, meistens aber in Grün, wie das Logo des Marktführers Spotify. Und Streaming bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer und wie sie alle heissen sieht auf den ersten Blick tatsächlich wie Fortschritt aus. Es kostet im Vergleich zum Erwerb einer Plattensammlung lächerlich wenig. Wer die Werbung aushält, hört sogar umsonst.
Zudem gibt es auf allen Plattformen so gut wie alles. Die Grösse des Archivs, auf das wir sofort zugreifen können, liegt jenseits des Vorstellbaren. Schätzungen zufolge lagern über 60 Millionen Songs bei Spotify und rund 70 Millionen bei Apple. Kein Laden kann da mithalten, keine Radiostation, keine Sammlerin, kein Supernerd.
Was hat das Streaming mit der Musik gemacht? Mit denen, die Musik machen? Und denen, die sie hören? Zur Übersicht.
Sie lesen: Teil 1
Das wird dir gefallen
Toll auch, dass wir dazu nicht zwei, drei, vier Abos brauchen wie bei den Videostreamingdiensten. Was bezahlt eine Mittelklassefamilie mit Eltern, Teenager und Primarschulkind im Durchschnitt, damit alle den Film, die Serie oder das Sportereignis schauen können, das sie möchten? 50, 60, 70 Franken pro Monat? Bei Spotify gibt es alles für knapp 17 Franken bei zwei Konten und für knapp 21 bei sechs. Streaming erleichtert den Zugang zu Musik und setzt die soziale Schwelle historisch tief. Auch Weltgegenden, die jahrzehntelang ausgeschlossen wurden, weil die physischen Tonträger zu teuer waren, sind heute Teil des globalen Poprauschens. Rund eine Milliarde User streamen Musik. Irgendwas hat wohl funktioniert.
Auf Deutsch heisst es zwar Nutzerin oder Nutzer. Aber viele sagen User. Das ist ein erster Hinweis auf das, was nicht so gut funktioniert. User, das sind eben auch Drogenabhängige. Wir kommen nicht los vom Streaming, es ist harter Stoff. Und wie bei jeder Droge verdienen auch beim Streaming ganz wenige Leute ganz viel Geld, während die Lieferanten nicht vom Fleck kommen, egal ob Anbauer oder Musikerin.
«Supreme clientele, put the world on top of me»Ghostface Killah – «Be Easy»
Vielleicht hilft eine kleine Übung, um die Dramatik besser zu verstehen. Stellen wir uns einmal vor, wir wären in einem Plattenladen, aber unter den Bedingungen einer Streamingplattform:
Ich betrete den Plattenladen mit Gepäck – Schlafsack, Laptop, Zahnbürste und leichte Wechselsachen. Denn ich weiss, dass ich die Musik nur im Laden selbst hören kann …
Einspruch: Wieso denn nur im Laden selbst hören, das ist doch Unsinn! Gerade Spotify und alle andern Streamingdienste ermöglichen höchste Mobilität. Mit dem Smartphone lässt sich Musik streamen, wo immer es ein bisschen Netz oder WLAN gibt. Letztlich überall.
Antwort: Ja, aber der Vergleich funktioniert anders. Spotify ist eine Plattform, die beides integriert, den Laden und das Abspielgerät. Das Smartphone ist ja nicht das eigentliche Abspielgerät. Der eigentliche Player ist die Software bei Spotify. Und Spotify ist auch der Laden, der die Musik verkauft. Ob wir «nur» mit unseren Daten bezahlen oder mit einer monatlichen Abogebühr, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Musik den Laden, also die Plattform, also Spotify, nicht verlassen darf.
Die sogenannte Interoperabilität, die alte Selbstverständlichkeit, Tonträger auf beliebigen, verschiedenen Geräten abspielen zu können, ist im Streamingzeitalter zum ersten Mal nicht mehr gegeben. Was wir bei Spotify hören, selbst in der «Library» im Offline-Modus, können wir in kein anderes Programm verschieben. Wir können zwar die Songs lokal speichern, doch die Files haben einen Kopierschutz. Deshalb bleiben wir immer auf der gleichen Plattform, wenn wir Musik hören.
Zumindest das ist bei Videodiensten genau gleich: Was auf Netflix läuft, bleibt auf Netflix, was wir auf Amazon Prime Video bezahlen, kann nur da angeschaut werden. Deshalb der Schlafsack und die Zahnbürste in der kleinen Gedankenübung, Streaming einmal unter analogen Bedingungen durchzuspielen. Wir checken ein, aber nie mehr aus. Ist das noch ein Hotel oder schon ein Knast?
«You can check out any time you like,Eagles – «Hotel California»
but you can never leave»
Okay, spulen wir zurück: Ich betrete den Plattenladen mit Gepäck – Schlafsack, Laptop, leichte Wechselsachen. Ich weiss, dass ich die Musik nur im Laden selbst hören kann. An der Kasse lasse ich meine persönlichen Daten, und die Zahlungsverbindung natürlich. Kameras registrieren nun, in welchen Fächern ich stöbere und welche Schallplatte (oder CD) ich herausnehme und genauer betrachte. Ich gehe mit einem Stapel zum Tresen, um mir eine Auswahl anzuhören. Dabei zeichnet ein Zähler auf, wie lange ich welche Stücke höre. Aufgezeichnet wird auch, ob ich einzelne Lieder ansteuere, ganze Alben wähle oder mir eine der vielen Compilations anhöre, die wie von Geisterhand immer zuoberst auf dem Stapel liegen, obwohl ich diese Platten gar nie hervorgeholt habe. Ich stehe nicht auf mid-afternoon work tunes, aber diese Stimmungsmacher liegen immer schon da.
Alle meine Entscheidungen und die Spuren meines Verhaltens landen in einer Datenbank, die ich nicht einsehen kann. Damit handelt der Laden, das ist sein Geschäftsmodell. Da ich die Musik nur in diesem Laden hören kann, verbringe ich sehr viel Zeit da. Gut, habe ich meinen Laptop dabei, damit ich weiter arbeiten kann. Und eine Decke sowie ein Kissen, denn diese eine Compilation eignet sich nun doch ganz gut zum Einschlafen, wie ich zugeben muss. Am Morgen weckt mich wieder eine stimmungsbasierte Musikliste, «Easy Breakfast Breeze» heisst sie – bisschen wie ein Avocado-Smoothie, aber gesungen. Ich bin sofort angenehm wach und doch entspannt. Nice.
Nur etwas ist seltsam: Ausser mir ist niemand hier. Wo sind die anderen Kunden und Kundinnen? Im Frühjahr 2021 sollen immerhin 350 Millionen bei Spotify unterwegs gewesen sein.
«Aren’t you lonely, up there in Utopia?»Katy Perry – «Chained to the Rhythm»
Spotify gibt es in Österreich und der Schweiz seit 2011, in Deutschland, dem weltweit drittgrössten Markt, dauerten die Verhandlungen ein Jahr länger. Apple Music und Youtube Music zogen später nach. Der kleinere, ursprünglich französische Anbieter Deezer ging bereits 2007 online, doch die Expansion startete in den Zehnerjahren. Streaming hat sich als Technologie recht rasch durchgesetzt. Weil der Service extreme Personalisierung erlaubt, haben wir in unseren Geschmacksblasen das Erdbeben nicht gespürt. Streaming wurde innerhalb von nur ein paar Jahren zur zweiten Natur, die Grundeinstellung unseres Musikkonsums.
Und so hören wir zunehmend in völliger Vereinzelung Musik, in algorithmisch ausgerechneten Gebieten, die nur wir selbst bewohnen. Zu den erfolgreichsten Formaten auf Spotify gehören die personalisierten Playlists. Sie heissen immer etwas anders, die Startseite ist in ständiger Entwicklung. Eine der beliebtesten Listen ist «Discover Weekly», auf Deutsch «Dein Mix der Woche». Die Liste hält nicht nur Neuheiten bereit, sondern auch «Juwelen früherer Jahrzehnte». Jetzt wird der Datensatz sofort subjektiv: In der Regel kenne ich mehr als die Hälfte der Vorschläge nicht, oft deutlich mehr, obwohl ich beruflich teilweise mit Musik zu tun habe. Aber ich langweile mich kolossal. Jede Auswahl tendiert zur akustischen Watte, zu Ohrenschmeicheleien, zu Hintergrund, zu potenzieller Werbung.
Meine Vorlieben schliessen keineswegs alles Zarte, Weiche und Aufzugskompatible aus. Aber die schroffen, sperrigen Sachen, die ich ebenso höre, fehlen in diesen Listen. So wenig wir in den meisten Fällen über die konkreten Technologien und über die Überwachung im Plattformkapitalismus wissen, so sicher ist: Am wichtigsten für die Monetarisierung unserer Daten ist die Dauer unseres Aufenthaltes. Unsere Zeit, ihr Gold. Endless scrolling, lange oder offene Listen, ein Feed ohne Fassboden. Für die Datenernte bietet Musik das allerbeste Feld: Weil die Userinnen mehr Zeit mit Musik verbringen als mit News, weil sie immer wieder zu gewisser Musik zurückkehren, während ein Artikel eine viel kürzere Halbwertszeit hat.
Noch eine kleine, kurze Übung: Haben Sie einen Lieblingsbeitrag auf Republik.ch oder sogar eine Serie, die Sie mehr als einmal gelesen haben? Vermutlich ja schon, weil es hier immer wieder längere Texte gibt, für die in anderen Medien weder Zeit noch Platz wäre. Aber haben Sie jemals einen Text schon dreimal gelesen? Eben.
«We don’t talk anymore,Charlie Puth – «We Don’t Talk Anymore»
we don’t talk anymore,
we don’t talk anymore,
like we used to do»
Bei einem Song, einem Album, einer Playlist kommen wir nach dem dritten Mal erst so richtig in Schwung. Pop ist ein Traum für die Datengewinnung – wir kehren immer wieder zurück, ach, wir gehen gar nie weg. Zudem greifen wir meistens direkt auf Spotify zu, nur selten über den Umweg eines sozialen Netzwerks wie Facebook, Instagram oder Twitter. Auch das ist im Datenkapitalismus wertvoll. Aber nichts schraubt den Wert unserer Datenspuren so sehr in die Höhe wie die Verweildauer. Und der Wert steigt und steigt. Spotify ist auf dem Papier in der Steueroase Luxemburg eingetragen, das Kapital kommt längst aus der ganzen Welt. Das nominelle Hauptquartier liegt in Stockholm, wo auch Gründer Daniel Ek begann. Die inoffizielle Zentrale ist aber woanders: Heute arbeitet das «schwedische Start-up» auf 14 Stockwerken im One World Trade Center in New York City. Der Mietvertrag läuft bis 2034. Mit Musik hat das alles nur bedingt zu tun.
Man muss allerdings aufpassen, wenn man sagt, die Musik sei nicht das Zentrum der Streaming-Idee bei Spotify. Ein junges europäisches Forschungsteam mit Sitz in Schweden hat es 2018 in seinem akademischen Bestseller «Spotify Teardown – Inside the Black Box of Streaming» so gesagt: Spotify sei in erster Linie ein Datenbroker. Daraufhin setzte der Konzern alle Hebel in Bewegung, um dem Team um Maria Eriksson und Rasmus Fleischer die Forschungsgelder abzudrehen (ohne Erfolg). Spätestens seit 2015, schreiben die Autorinnen, investiere Spotify vor allem in Technologie, die unser Verhalten studiert, aufzeichnet und diese Erkenntnisse an Dritte weiterverkauft. Maria Eriksson sagt im Gespräch: «Obwohl ich fünf Jahre über Spotify geforscht habe, kann ich nicht ganz genau sagen, wie die Empfehlungsalgorithmen funktionieren. Und hätte ich es gewusst, wäre heute schon wieder alles anders.»
Das ist bei Facebook oder Google genauso: Die zentralen Algorithmen dazu, wer was warum im Feed sieht, verändern sich ständig, vermutlich gibt es nicht einmal bei den Techkonzernen selbst Leute, die das im Detail überblicken. Der Kern des Geschäftsmodells ist eine Blackbox. Erst recht, wenn Empfehlungsalgorithmen mit maschinellem Lernen arbeiten, einer Form der künstlichen Intelligenz, die sich selbst laufend optimiert. In solchen Algorithmen konkurrieren mitunter sogenannte adversarial networks, die wechselseitig ihre Resultate überprüfen.
Diese neue Generation von Algorithmen kann viel mehr als die alten Empfehlungsalgorithmen, die wir erstmals vor rund 25 Jahren bei Amazon sahen, als der Onlineriese noch in erster Linie ein Buchhändler im Netz war. Die Sprache ist nicht mehr ganz die gleiche wie damals, aber der Grundsatz ist geblieben. Amazon erklärt die Funktionsweise selbst am besten: «Kunden, die Dorothee Elmiger gekauft haben, kauften auch Bücher von Christian Kracht, Deniz Ohde, Christine Wunnicke … (Seite 1 von 20).» Diese vergleichende Technologie heisst kollaboratives Filtern: Die grössten Schnittmengen der Kaufentscheidungen von vielen führen zu den Empfehlungen. Wer über grosse Datensätze wie Amazon verfügt, benötigt zwar viel Rechenleistung. Aber eine Raketenwissenschaft ist das nicht.
Maschinelles Lernen dagegen ist avancierter. Was wir in den hoch personalisierten Listen bei Spotify sehen und hören, betrifft wirklich nur noch uns selbst. «Dancing With Myself»: Billy Idols Pop-Punk-Hit und das postapokalyptische Video sahen 1982 die Gegenwart ganz gut voraus.
«With a record selectionBilly Idol – «Dancing With Myself»
and a mirror direction
I’m dancing with myself»
So narzisstisch optimiert und toll sich personalisierte Listen anfühlen, für die Musik sind sie verheerend. Besser: für die Musikerinnen und Musiker. Statt 20 oder höchstens 200 Bands und Künstlerinnen wie früher hören wir nun 2000 oder mehr verschiedene Acts. Die meisten klingen ähnlich. Aber von unserer derart dezimierten Aufmerksamkeit kann kaum mehr jemand leben. Und Aufmerksamkeit ist Geld.
Wie viel genau Spotify pro einzelnen Stream an die Labels ausschüttet, variiert je nach Land erheblich, in dem gestreamt wurde. Ausserdem gibt es unterschiedliche Vereinbarungen zwischen der Plattform und den Labels, die nicht öffentlich sind. In der Schweiz verdient man pro Stream im Schnitt 0,0040 Cent, bereits in Deutschland sind es nur 0,00286 Cent und in Brasilien 0,0011 Cent, weil die Abos in den jeweiligen Ländern teurer beziehungsweise günstiger sind. Um 4000 Euro zu verdienen, müssten allein in der Schweiz eine Million Zugriffe verzeichnet werden, eine sehr hohe Zahl und ein tiefes Monatseinkommen. Das schafft so gut wie niemand (mehr zu den Abrechnungsmodellen lesen Sie morgen im zweiten Teil).
Die Effekte sind längst sichtbar: Es gibt im Streamingzeitalter kaum mehr einen funktionierenden Mittelbau im Pop. Sogar im Superstar-Segment gibt es wenig Nachwuchs, der dann auch da bleibt. Die Stars der grossen Tourneen waren in der Regel über fünfzig, als es noch grosse Tourneen gab. Und die Teenager von heute hören an Partys ausserhalb ihres engen Freundeskreises zum Teil die Musik, die sie in der Primarschule gehört haben. Weil die wenigstens alle kennen.
Was hat uns überhaupt so weit gebracht, dass wir hyperpersonalisierte Listen so attraktiv finden? Das ist kein Naturgesetz, wir finden ja auch Bücher nicht nur dann gut, wenn niemand sie liest ausser wir selbst. Im Gegenteil, die meisten finden es gerade gewinnbringend, wenn man damit rechnen kann, dass die Hälfte das Buch gelesen hat, über das bei einem Tischgespräch geredet wird. Warum ist das im Pop anders? Warum mögen wir Musik, die nur ganz genau unseren Geschmack trifft? Diesen Typus der radikalen Abgrenzung – mein Geschmack ist einzigartig! – gab es schon immer, aber nur in den schlimmsten Phasen der Pubertät. Danach wurde es lächerlich. Was ist also anders gelaufen im Pop als in der Literatur?
«Hey, hey, I wanna be a rockstarNickelback – «Rockstar»
Mmh, hey, hey, I wanna be a rockstar»
Streaming ist nicht an allem schuld. Dass wir den eigenen Musikgeschmack für so wichtig halten und am liebsten mit Kopfhörern nach innen horchen, ist das Resultat einer langen Entwicklung. Sie beginnt, wie fast immer bei der Unterhaltungstechnologie, im Krieg und reicht schon über hundert Jahre zurück. Es ist die Geschichte einer fortschreitenden Individualisierung, deren Technologien im Pop ein breites Testfeld für Friedenszeiten vorfanden. Blenden wir kurz zurück.
Der deutsche Ingenieur Hans Bredow baut im Ersten Weltkrieg für die demoralisierte Truppe des Grabenkriegs einen mobilen Radiosender, der in den Feuerpausen Musik spielt. Auch der Feind schätzt die Unterbrechung im Schützengraben. Bredow erhält allerdings bald einen Rüffel von der Kommandostelle, das sei «Missbrauch von Heeresgerät». Die Kommandostelle bemerkte nicht, was der Ingenieur ahnte: Musik kann innere Konflikte besänftigen. Noch hören alle dasselbe, sogar auf beiden Seiten der Front.
Doch auch die erfolgreichste Ich-Maschine des Jahrhunderts kommt aus dem Militär, nämlich der Kopfhörer. Die US-amerikanische Navy bestellt 1910 bei Nathaniel Baldwin 100 Kopfhörer, die zwei Muscheln haben und von einem Bügel zusammengehalten werden. Baldwin stellt seine baldy phones in der eigenen Küche her und hat Mühe, den Auftrag für die Flotte rechtzeitig fertigzubekommen. In Berlin-Gesundbrunnen baut die Firma Beyer 1937 den ersten dynamischen Kopfhörer, er heisst Beyer DT 48; DT steht für «dynamisches Mess-Telefon» und verrät damit, wofür der Kopfhörer zunächst gebraucht wird: für Übertragungstechnik, für Funk.
Im Luftkrieg um England wird bald darauf die Stereophonie erfunden. Das Geheimnis der deutschen Luftwaffe, das sie unabhängig von Tageslicht macht und gegen schlechtes Wetter wappnet: zwei verschiedene Funksignale, die von deutsch besetztem Boden in Richtung England geschickt werden, kreuzen sich exakt am Punkt des gewünschten Bombenabwurfs. In den Kopfhörern der Piloten piepst rechts das lange, links das kurze Signal des Morsecodes. Am Zielort fügen sich der Morsestrich (lang) und der Morsepunkt (kurz) zu einem anhaltenden Ton zusammen. Das ist das Zeichen, die Fracht auszuklinken. Hätten die Briten die «stereophone Fernsteuerung» der deutschen Bomber nicht aus Zufall geknackt, wäre der Luftkrieg vielleicht verloren gegangen, mit furchtbaren Folgen für die Weltgeschichte.
«The king is still in London,Roma Campbell-Hunter, Hugh Charles – «The King is Still in London»
in London, in London,
and he would be in London Town
if London Bridge was falling down»
Der Kopfhörer schafft jedoch die Voraussetzung dafür, dass Pop nach dem Krieg so mobil und mit dem zivil genutzten Stereoeffekt später auch so intensiv erfahren werden konnte. Die dritte technologische Bedingung verdankt sich ebenso dem «Missbrauch von Heeresgerät»: das Tonband oder Tape. Schon wieder sind es deutsche Ingenieure, die im Zweiten Weltkrieg die Qualität des Tonbands so stark verbessern, dass der Feind die nächtlich abgespielten Symphoniekonzerte und Frontberichte für Liveübertragungen hält. Kurz nach Kriegsende entdeckt ein US-amerikanischer Offizier die optimierten Geräte in Bad Nauheim und verschifft zwei davon nach Kalifornien. Erst 1963 präsentiert die Firma Philips dann den ersten «Taschen-Recorder». Dazu gibt es ein neues Speichermedium: die Tonbandkassette.
Sie klingt grauenhaft, längst nicht so gut wie die hochwertigen breiten Bandmaschinen von Schweizer Firmen wie Studer Revox oder Nagra. Doch die Qualität der kleinen, handlichen Kassette wird bald besser. Laut Philips ist das Gerät «ideal für Vertreter und Reporter», doch die Geschichte sollte eine noch idealere Zielgruppe für den Kassettenrekorder finden: Popfans.
Die Musik kommt jetzt auf die Strasse. Und der Rekorder kann, wie es der Name sagt, «recorden», also aufnehmen und überspielen. So entstehen die ersten Mixtapes. Vom Radio aufgenommen oder von der Vinylschallplatte auf die Kassette überspielt. Es sind die ersten personalisierten Playlists. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass man sie selbst erstellt hat.
In den Achtzigerjahren steigt der Verkauf von Leerkassetten sprunghaft an, die Musikindustrie spricht erstmals von «Raubkopien». Hauptgrund ist der Walkman, das Gerät der Dekade. Der 1979 in Japan, 1980 auch in Europa vorgestellte Walkman von Sony verbindet die zwei bekannten Technologien und macht sie kleiner: Tape und Kopfhörer. Der Player passt in die Gesässtasche einer Jeans, der Hörer hat einen leichten Metallbügel und kleine Muscheln, die von etwas Schaumgummi umhüllt sind. Die Werbekampagnen betonen alle die Jugendlichkeit, die Mobilität, die Urbanität. Kaum jemand über dreissig trägt einen Walkman, und niemand über vierzig.
In den Achtzigerjahren sind die Jugendlichen mit dem nach innen gekehrten Blick oft ein Ärgernis für die Öffentlichkeit. Sie spazieren durch die Stadt mit ihrem eigenen Soundtrack, die Umwelt wird zur Kulisse degradiert, aus den kleinen Kopfhörern dringt ganz schön viel Schall nach aussen: Das sind die Standardvorwürfe. Als Jugendlicher fühlt es sich toll an, musikalisch selbstbestimmt durch die Strassen zu gehen, «im eigenen Film» zu sein und nicht auf die Erwachsenen zu achten. Ein Walkman ist ein stiller Mittelfinger in Richtung Autoritätspersonen: Redet ruhig, ich höre gar nicht zu. Die Debatte für und wider den Walkman trägt Züge eines üblichen Generationenkonflikts. Aber neu ist der Grad der Individualisierung, der mit dem Walkman getestet wird. So verschieden wurde bis dato noch nicht Musik gehört.
«Are you one of the new wave boys?David Bowie – «Teenage Wildlife»
Same old thing in brand new drag»
Mit der Lancierung der schamlos überteuerten und im Preis nie gesenkten Compact Disc versucht die Musikindustrie ab 1982 ein letztes Mal, den Kundinnen vorzuschreiben, was sie in welcher Reihenfolge hören sollen. Doch die Gewinnspannen sind in den Neunzigerjahren, als die CD die Vinylschallplatte endgültig überholt, so obszön, dass leider niemand mehr Mitleid hat, als illegales Filesharing von digitalen MP3-Dateien in den frühen Nullerjahren den Tonträgermarkt zerstört.
Apple wird auch deshalb zur teuersten Firma der Welt, weil der iTunes Store und der iPod die digitale Personalisierung vorantreiben und den Markt dominieren. Wir müssen nicht mehr ganze Alben kaufen, es sind jetzt auch einzelne Songs im Angebot bei iTunes. Und der iPod und andere MP3-Player greifen blitzschnell auf die stetig wachsende Musiksammlung zu, die wir nun sogar in eine Hemdtasche stecken können. Mit dem Zufallsmodus, dem sogenannten shuffle mode, ist es möglich, jedes Mal völlig neue Mixtapes zu hören.
Der Kassettenrekorder ab 1963, der Walkman ab 1979 und iTunes wie iPod seit den frühen Nullerjahren lehren uns seit fast sechzig Jahren, dass Musikkonsum extrem individuell sein kann. Mobilität und Individualisierung sind also schon lange Teil der Pop-DNA. Aber Audiostreaming treibt diese Entwicklung in ungeheurem Tempo auf die Spitze. Es gibt so viele algorithmisch erstellte Playlists, wie es User gibt. Und noch viel mehr.
Die eigentliche Frage ist, wer von dieser restlosen Personalisierung von Pop profitiert. Es sind nicht die Userinnen, sondern die Anbieter, Plattformen wie Spotify und die wenigen verbliebenen Majorlabels. Die Hörer hingegen vereinzeln, die Musikerinnen verarmen.
Man darf den guten alten Plattenverkäufer also doch vermissen: das konkrete, lokale Gespräch über Musik, die Verständigung darüber, was mehr Leute gut finden als man selbst, den Streit über Geschmack, der dann doch ganz viel Weltanschauung enthält. Mit Mitgefühl oder mit Nostalgie hat das nichts zu tun. Es geht letztlich nur darum, ob Sie wollen, dass Pop überlebt. Oder ob Ihnen eine Playlist für jede Stimmung, jede Alltagssituation genügt. Ihre Entscheidung.
Abgewirtschaftet hat der Plattenverkäufer übrigens mitnichten. Er heisst jetzt nur anders. Er ist ein Algorithmus. Und er weiss alles, wirklich alles über Sie.
Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor in Berlin. Er schreibt vor allem über Pop- und Theaterthemen. Im September erscheint sein Buch «Play Pause Repeat. Was Pop und seine Geräte über uns erzählen» bei Hanser Berlin.

