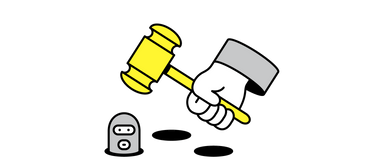
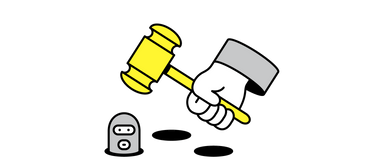
Wenn Investoren auf ihre Menschenrechte pochen
Sind Staaten und multinationale Konzerne uneins, entscheiden oft private Schiedsgerichte. Wie das funktioniert und warum das öffentliche Interesse dabei nicht selten den Kürzeren zieht.
Von Susi Stühlinger, 01.09.2021
Journalismus, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Und der das Gemeinsame stärkt: die Freiheit, den Rechtsstaat, die Demokratie. Lernen Sie uns jetzt 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich kennen:
Irgendwie sind es Gerichte und irgendwie doch nicht. Sie arbeiten im Verborgenen, abseits der Blicke der Öffentlichkeit. Was sie tun, hat weitreichende Folgen. Sie können Regierungen bedrängen, Volkswirtschaften an den Rand des Ruins treiben – und sind neuerdings auch ein lukratives Geschäftsmodell für Spekulanten: Schiedsverfahren zwischen Staaten und ausländischen Investoren, genannt Investor-State dispute settlement (ISDS).
Silvia Steininger forscht unter anderem zum Thema ISDS und Menschenrechte am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Die Republik hat mit ihr über diese in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannten Verfahren gesprochen – und über dringend notwendige Reformen.
Ort: Unklar
Zeit: Geheim
Fall-Nr.: Geheim
Thema: Investitionsschutz
Silvia Steininger, Sie haben die Rolle der Menschenrechte in investitionsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Staaten und multinationalen Unternehmen untersucht. Sind solche Verfahren menschenrechtsfreundlich?
Es kommt drauf an, wessen Menschenrechte gemeint sind. Ich habe festgestellt, dass Menschenrechte in diesen Fällen zwar durchaus eine Rolle spielen – aber oft nicht wirklich den Menschen zugutekommen.
Sondern?
Sehr häufig sind es die Investoren, die auf ihre Menschenrechte pochen. Ich habe beobachtet, dass die entsprechenden Argumente, wenn sie von Konzernen vorgebracht werden, in den Schiedsverfahren oft aufgegriffen werden – häufig geht es um das Recht auf Eigentum. Wenn sich die Gegenseite auf Menschenrechte beruft, etwa zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, finden diese nicht so oft Gehör. Die Menschenrechte der potenziellen Opfer ausländischer Investitionstätigkeit, der lokalen Bevölkerung, kommen überhaupt nicht vor – weil die Betroffenen in diesen Verfahren gar keine Stimme haben.
Das klingt schwierig, lassen Sie uns darauf zurückkommen. Zunächst aber ganz von vorne: Was genau ist das Investor-State dispute settlement?
Es sind Schiedsverfahren zwischen einem Investor – oft sind es multinationale Unternehmen – und einem Staat. Das ISDS ist Teil des Investitionsschutzrechts, das aus mehr als 3000 bi- und multilateralen Verträgen besteht. Damit räumen Staaten ausländischen Investorinnen gewisse Rechte ein – zum Beispiel zum Schutz vor Enteignungen. Diese Rechte können Unternehmen gegen den Staat mittels ISDS einklagen. Natürlich gibt es Länder auf dieser Welt, wo Investoren Gefahr laufen, nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen behandelt zu werden und wo das ISDS aus Investorensicht eine Notwendigkeit ist.
Kritikerinnen werfen dem ISDS vor, damit werde eine Art Paralleljustiz zugunsten multinationaler Konzerne geschaffen. Sind diese Investitionsschiedsgerichte überhaupt Gerichte?
Es kommt darauf an, was man als Gericht definiert. In gewisser Weise sind die Tribunale schon Gerichte: Es gibt zwei Parteien, die einen Konflikt miteinander haben, und es gibt ein Verfahren, an dessen Ende eine Art Urteil – ein Schiedsspruch – steht. Aber im Gegensatz zu konventionellen Gerichten gibt es beim ISDS keine festen Richter. Die Schiedsrichterinnen, genannt Arbitrators, werden von den jeweiligen Parteien ernannt.
Wie läuft das ab?
Es kursieren Listen mit potenziellen Arbitrators, das sind Privatpersonen, oft Anwälte – gut bezahlte Anwälte. Der Staat sucht sich jeweils eine Person aus, das Unternehmen die andere, und auf die dritte einigt man sich dann gemeinsam. Faktisch ist es so, dass es weltweit eine Elite von etwa fünfzig Personen gibt, die für einen Grossteil der Verfahren als Arbitrators tätig sind. Und die ein gewisses Interesse daran haben, auch weiterhin für diese sehr lukrativen Jobs ernannt zu werden.
Sie implizieren, dass die ISDS-Arbitrators nicht wirklich neutral sind.
Die Arbitrators sind eben keine Richter, die unabhängig sind, sondern von den Parteien ernannte Individuen. Das bedeutet: Oft ist ein eigenes wirtschaftliches Interesse mit dabei. Ausserdem kommt es vor, dass die Personen, die in einem Fall als Schiedsrichter fungieren, in einem ähnlichen Fall als Anwalt für eine Firma tätig sind, die ebenfalls in ein Verfahren vor einem ISDS-Tribunal involviert ist. Da besteht ein Konflikt: Die Person kann in ihrer Funktion als Arbitrator nicht komplett neutral sein, wenn sie gleichzeitig in einem parallelen Verfahren als Anwalt einer Partei auftritt.
Es gibt also Personen, die sind in einem Fall Rechtsvertreter eines multinationalen Unternehmens. Und in einem ähnlich gelagerten Fall amten sie als vom Staat eingesetzter Schiedsrichter über Investitionsstreitigkeiten, in die dasselbe Unternehmen verwickelt ist?
Ja, das kommt vor. Zwar nicht im selben Verfahren, wohl aber beim gleichen Thema: Zum Beispiel kann eine Rechtsvertreterin, die einen Konzern in einem Land im Kampf gegen striktere Tabakregulierung unterstützt, in einem anderen Land über die Zulässigkeit strikterer Tabakregulierungen als Schiedsrichterin entscheiden. Hinzu kommt, dass die Verfahren nicht öffentlich und sehr intransparent sind.
Was heisst intransparent?
Die Parteien entscheiden selbst, wie transparent oder intransparent sie die Verfahren haben wollen. In der Regel ist nur das endgültige Schiedsurteil einsehbar, nicht aber die dazugehörigen Akten. Manchmal bleibt sogar das Schiedsurteil selbst unter Verschluss. Ausserdem: Vor ordentlichen Gerichten gibt es einen Instanzenzug. Nach einem ISDS-Tribunal kommt erst einmal gar nichts, der Schiedsspruch bindet die Parteien final. Und es gibt auch kaum eine Möglichkeit, die Verfahren neu aufzurollen. Etwa dann, wenn im Nachhinein herauskommt, dass ein Schiedsspruch durch gefälschte Expertengutachten oder Bestechung beeinflusst wurde.
Das heisst, die Schiedssprüche sind endgültig und können kaum mehr angefochten werden?
Ja. Die Schiedsgerichte haben die Macht, staatliche Gesetze, die Verfassung, alle möglichen Arten von nationalen Regulierungen auf die Vereinbarkeit mit dem Investitionsschutz zu überprüfen. Das ist ein enormer Eingriff in die nationalstaatliche Souveränität. Zwar gibt es auch andere internationale Gerichte, die staatliche Regulierungen überprüfen können – wie etwa der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Aber im Gegensatz zu diesem sind die ISDS-Schiedsgerichte eben keine öffentlichen, internationalen Gerichte, sondern privat mandatierte Tribunale, deren Schiedssprüche vollstreckt werden müssen. Bei der Umsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben nationale Richterinnen dagegen sogar einen gewissen Spielraum.
Diese Tribunale entscheiden also darüber, ob ein Staat bestimmte Gesetze erlassen darf oder nicht – zum Beispiel strengere Umweltschutzgesetze?
Genau das ist das Problem: dass multinationale Unternehmen mit unfassbaren finanziellen Ressourcen das Recht bekommen, gegen staatliche Massnahmen zu klagen – vor privaten Schiedsgerichten. Das hat massive Auswirkungen auf staatliche Schutzpflichten. Der Staat hat ja auch andere völkerrechtliche Verträge unterschrieben; zum Beispiel Verträge über Menschenrechte oder im Bereich Klimaschutz. Was macht der Staat jetzt, wenn er weiss: Eigentlich müsste ich die Menschenrechte schützen oder mich für das Klima einsetzen? Aber wenn ich das tue, verletze ich gleichzeitig meine investitionsschutzrechtlichen Pflichten.
Bedeutet das, dass das ISDS die Staaten mitunter zögern lässt, neue Regelungen im Bereich der Umwelt- oder Menschenrechte zu treffen?
Die Angst, vor ein Schiedsverfahren zu kommen, kann die Entscheide der Staaten beeinflussen. Wenn sich ein Konflikt zwischen Menschenrechten oder Umweltschutz und Investitionsschutz anbahnt, muss damit gerechnet werden, dass sich die Staaten eher für den Schutz der Investorenrechte entscheiden. Es findet eine Priorisierung von wirtschaftlichen Interessen gegenüber menschenrechtlichen oder umweltrechtlichen Interessen statt. Zudem wirken die Schiedssprüche auch über die Landesgrenzen hinweg. Wenn eine Investorin in einem Staat erfolgreich geklagt hat, werden andere Staaten, die erwogen hätten, ähnliche Gesetze einzuführen, vermutlich davon absehen.
Warum vermögen diese Verfahren die Staaten dermassen einzuschüchtern?
Die Schadenssummen, die der Staat im Falle einer Niederlage an den Investor bezahlen muss, sind teilweise unglaublich gross. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat Deutschland aufgrund seines Beschlusses zum Atomausstieg verklagt. Die mögliche Schadenssumme beläuft sich auf 6 Milliarden Euro inklusive Prozesszinsen. Hinzu kommen die Anwaltskosten. Deutschland hat im Schiedsverfahren gegen Vattenfall über die letzten Jahre mehr als 21 Millionen Euro allein für Anwälte ausgegeben. Das alles zusammen ist schon für Deutschland sehr, sehr viel Geld. Für kleine Staaten im globalen Süden, wo diese Summe mehrere Prozente des Bruttoinlandprodukts ausmacht, ist es wirklich bedrohlich – die können sich das Risiko, vor ein Schiedsgericht gezerrt zu werden, eigentlich gar nicht leisten.
Wenn es doch zum Verfahren kommt: Sie erwähnten zu Beginn unseres Gesprächs, dass sich Staaten zu ihrer Verteidigung auf Menschenrechte stützen. Können Sie ein Beispiel nennen?
Als Argentinien in den Nullerjahren unter der Finanz- und Wirtschaftskrise litt, ergriff das Land verschiedene Massnahmen, etwa in den Bereichen wie Wasser, Energie und Entsorgung, was in rund zwanzig Klagen von ausländischen Investoren resultierte. Da war zum Beispiel die Wiederverstaatlichung der zuvor privatisierten Wasserversorgung. Argentinien hat bei den Investorenklagen dagegen immer wieder argumentiert: Wir haben das gemacht, um die Menschen in unserem Land zu schützen, um ihnen das Recht auf Wasser zu ermöglichen.
Und wie hat das geendet?
Da gab es ganz unterschiedliche Entscheidungen. Während ein Tribunal fand: Ja, das ist einleuchtend, befand ein anderes: Menschenrechte tun hier überhaupt nichts zur Sache. Gerade weil die Tribunale nur im Einzelfall entscheiden, ist es von Fall zu Fall unterschiedlich, was am Ende dabei herauskommt. So gesehen sind die Verfahren, die jetzt aufgrund der Corona-Pandemie anhängig gemacht werden, wirklich interessant – um zu sehen, ob es ein gewisses Umdenken, eine gewisse Veränderung in der Rechtsprechung gibt, zugunsten menschenrechtlicher Aspekte.
Erklären Sie.
In der Pandemie geht es, mehr noch als in einer Finanzkrise, um eine Notstandssituation, in der staatliche Massnahmen getroffen werden, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Heute sehen wir bereits die ersten Klagen, die gegen die jeweiligen Staaten vorbereitet werden. In Peru etwa wurden die Autobahnzölle ausgesetzt, um den Transport medizinischer Güter zu gewährleisten. Ein anderes Beispiel ist die Begrenzung des Flugverkehrs. Das trifft bestimmte ausländische Investoren, denen die entsprechende Infrastruktur gehört, natürlich enorm. Da werden wir nun sehen, ob die Schiedsrichter bereit sind, die jeweiligen Verträge so auszulegen, dass die staatlichen Schutzpflichten gegenüber der Bevölkerung Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen haben.
Also gibt es doch Hoffnung?
Wir sehen zunehmend Fälle, in denen die Arbitrators für die Problematik sensibilisiert sind. Und wo versucht wird, durch eine Interpretation der Verträge menschenrechtliche Aspekte mit zu berücksichtigen. Die Tribunale sehen zusehends ein, dass die Frage der Menschenrechte nicht so einfach zur Seite zu wischen ist. Allerdings glaube ich, dass die Rolle der Arbitrators dabei überschätzt wird.
Wie meinen Sie das?
Trotz aller berechtigten Kritik an den Arbitrators: Die haben dieses System nicht geschaffen. Ihr Job ist es, die bestehenden Verträge auszulegen. Sie können nicht einfach ihr Ermessen überschreiten und auf einmal etwas in die Investitionsschutzabkommen hineinlesen, das dort gar nicht drinsteht. So gesehen sind die Staaten gefragt, die dieses System geschaffen haben, es aufrechterhalten und fördern – und die keine Regelungen treffen, etwa zur Verhinderung missbräuchlicher Verfahren und Spekulation.
Spekulation?
Wir erleben zurzeit eine Explosion von Verfahren, die nicht von den Unternehmen selbst finanziert werden, sondern von Hedgefonds. Die spekulieren heute nicht mehr nur mit Staatsschulden und anderen Kreditprodukten, sondern haben auch die Investitionsschiedsverfahren für sich entdeckt, weil man dabei unglaublich viel Geld machen kann. Also bezahlen sie jetzt Unternehmen, um Investitionsschutzverfahren anzustossen. Dieses Modell boomt, denn die Renditen, die locken – bei Staaten, die sich nicht entsprechend verteidigen können –, sind hoch.
Und gegen all die Missstände wird nichts unternommen?
Es gab ein Zeitfenster, vor einigen Jahren, als die Massenproteste gegen TTIP und CETA – die Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada – stattgefunden haben: Daraufhin wurde ein breit abgestützter Reformprozess angestossen, bei dem ursprünglich auch die grundlegende Problematik von Investitionsschutzverträgen hätte mit einfliessen sollen. Aktuell zeigt sich jedoch ein ernüchterndes Bild: Es gibt zwar verschiedene Reformvorschläge, aber eine systematische Reform wird von vielen Staaten, insbesondere im globalen Norden, nicht gewünscht.
In der EU gibt es Pläne, einen Europäischen Investitionsschiedsgerichtshof zu errichten. Was würde das bringen?
Das wäre immerhin ein permanenter Gerichtshof, wo keine privaten Arbitrators amten würden, sondern Richterinnen, die von den Mitgliedstaaten ernannt würden. Und wo die Urteile auch eine gewisse Präzedenzwirkung haben könnten. Allerdings ist das ein rein europäisches Projekt, von dem die restlichen Regionen der Welt nicht betroffen sind. Und die Schiedsverfahren stehen ja erst am Ende der Konflikte zwischen Investitionen und Menschenrechten. Das Problem beginnt viel früher. Aktuell versucht man das Ganze aufzuhübschen, indem man einen Gerichtshof etabliert. Zum einen sagt man: Wir brauchen eine Verbesserung des Systems. Zum anderen schützt man dieses System noch immer und schliesst weiterhin Investitions- und Handelsverträge ab, etwa mit China. In diesen Verträgen werden die Menschenrechte gar nicht erwähnt.
Welche Optionen bleiben den Staaten des globalen Südens? Sich aus den Investitionsschutzabkommen zurückzuziehen, ist kaum möglich. Ecuador, das diesen Weg vor zwanzig Jahren nach einem Schiedsurteil zugunsten des Ölkonzerns Chevron gegangen ist, krebst wieder zurück.
Das ist die Krux am Ganzen. Einfach nicht mitzumachen, ist unter dem gegenwärtigen globalen Wirtschaftssystem keine Option. Zumal gerade die Länder des globalen Südens häufig einfach auf Investitionen angewiesen sind. Und selbst wenn ein Land diesen Weg wählt: Die meisten Verträge haben sogenannte sunset clauses, die es den Investoren erlauben, den jeweiligen Staat selbst nach einer Aufkündigung der Verträge noch nach fünfzehn, dreissig oder fünfzig Jahren vor ein Schiedsgericht zu bringen.
Also gar keine Lichtblicke?
Es gibt kleine Fortschritte: Gewisse Staaten wie Brasilien, Indien und Südafrika haben das ISDS zugunsten eines State-to-State dispute settlement abgeschafft. Das heisst: Der Investor muss sich erst an seinen Heimatstaat wenden, und der klagt gegen den Gaststaat. Dann gab es auch einige Fälle, in denen Investitionsschiedsgerichte sogenannte Gegenklagen zugelassen haben. Mit denen können sich Staaten zur Wehr setzen, wenn Investoren menschen- oder umweltrechtliche Standards verletzt haben. Und einzelne Staaten schliessen auch neue Investitionsschutzabkommen mit harten Menschenrechtsverpflichtungen für Investoren ab. Wie etwa Marokko und Nigeria im Jahr 2016 – aber halt nicht Deutschland, Frankreich oder die USA.
Illustration: Till Lauer