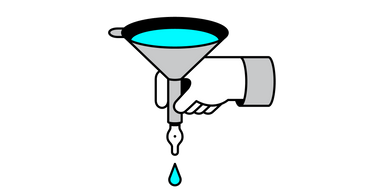
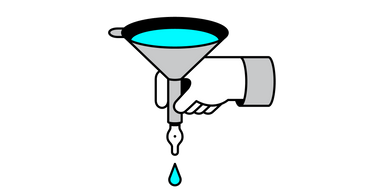
Ex-Glencore-Händler gesteht Bestechung, Staatskrise in Tunesien und EU lockt Forscher von Schweizer Unis
Woche 30/2021 – das Nachrichtenbriefing aus der Republik-Redaktion.
Von Philipp Albrecht, Christian Andiel, Reto Aschwanden, Ronja Beck und Christof Moser, 30.07.2021
Keine Lust auf «Breaking News» im Minutentakt? Jeden Freitag trennen wir für Sie das Wichtige vom Nichtigen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie das wöchentliche Nachrichtenbriefing der Republik!
Tunesien: Staatspräsident reisst die Macht an sich
Darum geht es: Staatspräsident Kais Saied hat am Sonntag den Ministerpräsidenten Hichem Mechichi abgesetzt, das Parlament für 30 Tage suspendiert und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Sicherheitskräfte umstellten das Parlament und andere Institutionen. Auf den Strassen von Tunis gab es Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen. Das Büro des Nachrichtensenders al-Jazeera wurde von Polizisten gestürmt.
Warum das wichtig ist: In Tunesien begann vor gut zehn Jahren der Arabische Frühling. Seither ist das Land auf dem Weg zur Demokratisierung. Allerdings gab es in dieser Zeit neun verschiedene Regierungen, was eine nachhaltige Stabilisierung des Landes erschwerte. Kritiker bezeichnen das Vorgehen des 2019 mit grosser Mehrheit gewählten, parteilosen Präsidenten als Putsch. Allerdings begrüssten viele Tunesierinnen die Entmachtung des Ministerpräsidenten und des Parlaments, weil sie dadurch den Einfluss der Islamisten geschmälert sehen. Die mächtige Gewerkschaft UGTT rief alle politischen Kräfte auf, die Verfassung zu respektieren. Die Menschen leiden schon länger unter einer schweren Wirtschaftskrise, die von einer stark steigenden Zahl von Corona-Ansteckungen noch verschärft wurde. In den letzten Wochen kam es immer wieder zu gewaltsamen Protesten. Manche richteten sich gegen die grösste Partei des Landes, die konservativ-islamische Ennahda, die den Parlamentspräsidenten stellt. Allerdings gingen auch Ennahda-Anhänger auf die Strasse, um gegen die Regierung zu protestieren.
Was als Nächstes geschieht: Der abgesetzte Ministerpräsident Mechichi erklärte, er wolle die Lage nicht weiter erschweren und seine Verantwortung abgeben. Die Ennahda ruft zu einem nationalen Dialog auf. Bis Ende August gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Momentan scheint keine Partei ein Interesse an einer weiteren Eskalation zu haben. Allerdings zeichnen sich in der weitgefächerten Parteienlandschaft auch keine stabilen Mehrheiten ab.
Corona blüht unter den fünf Ringen
Darum geht es: Die Olympischen Spiele in Tokio werden immer mehr zu «Corona-Spielen». Die Ansteckungszahlen in Japans Hauptstadt steigen exponentiell. Bis Ende Juni überstieg die Zahl der Neuinfektionen pro Tag nie die Zahl 500, seit Mitte Juli liegt dieser Wert bei über 1000 pro Tag, gestern erreichte er mit 3865 einen neuen Rekord. Damit stieg der Tagesschnitt im Vergleich zur Vorwoche auf über das Doppelte. Bei Olympia selbst waren bis gestern 193 Infizierte gemeldet, darunter 20 Athletinnen. Die Kritik im Land wird zunehmend schärfer, nachdem schon vor Beginn der Spiele mehr als 80 Prozent der Bevölkerung gegen die Austragung waren. «Die Leute sind extrem sauer auf das IOC und die japanische Regierung», sagte der Tokioter Politikwissenschaftler Koichi Nakano im deutschen Sender ZDF.
Warum das wichtig ist: Mit den Olympischen Spielen 2020 wollte sich Japan fulminant als eine der führenden Wirtschafts- und Kulturnationen präsentieren. Dann sollte es nach der Verschiebung um ein Jahr das ganz grosse Fest zur überwundenen Pandemie werden. Jetzt schreibt der englische «Guardian»: «Die Japaner geben Milliarden öffentlicher Gelder für eine Party aus, an die sie selbst nicht einmal gehen können.» Die Stadien sind leer, die Wettkampfstimmung entsprechend absurd, dafür tummeln sich Zehntausende in der Stadt und jubeln und feiern. Dabei ist für Tokio bis zum 22. August, also gut zwei Wochen nach der olympischen Schlussfeier, der Corona-Notstand ausgerufen: die Bürgerinnen sollen zu Hause bleiben, Restaurants dürfen keinen Alkohol ausschenken und müssen abends früher schliessen. Der Imageschaden für Tokio und Japan ist enorm, schon im Vorfeld gab es eine Reihe an Skandalen und erzwungenen Rücktritten von Funktionären wegen Fehlplanungen, frauenfeindlicher oder antisemitischer Aussagen. Auch wirtschaftlich geht die Sache nicht auf, Sponsoren haben die Eröffnungsfeier boykottiert, nationale Medien fordern den sofortigen Abbruch der Spiele. Auch am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und an seinem Boss Thomas Bach wächst die Kritik, weil es aus rein wirtschaftlichen Gründen an der Austragung festhält – und weil die Folgen Japan zu tragen hat und nicht der Weltverband mit Sitz in Lausanne. Zudem liess das IOC Athletinnen per Unterschrift erklären, dass sie «auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung» teilnehmen. Auch Todesfälle sind dabei eingeschlossen.
Was als Nächstes geschieht: Wie sich die Infektionszahlen entwickeln, ist unsicher, angesichts der häufig nicht befolgten Maskenpflicht in den und um die olympischen Stätten bleibt Olympia der perfekte Superspreader-Event. Zudem gibt es zunehmend Probleme mit der enormen Hitze. Bei 36 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit sagte Tennisspieler Daniil Medwedew zum Referee: «Wenn ich sterbe, wer ist dann verantwortlich?» Beachvolleyballerinnen müssen auf 50 Grad heissem Sand spielen. Doch egal, was passiert, das IOC wird nicht wanken, Japan wird die Sache durchziehen – und am 24. August beginnen an gleicher Stätte die Paralympics.
Ex-Glencore-Händler hat Behörden in Nigeria bestochen
Darum geht es: Ein langjähriger Glencore-Angestellter hat zugegeben, während Jahren in Nigeria Beamte der staatlichen Ölgesellschaft NNPC bestochen zu haben. Dank den Zahlungen soll Glencore einfacher an lukrativere Ölsorten gekommen sein. Am Montag wurden bei einem New Yorker Gericht Dokumente eingereicht, wonach sich der Brite, der bis 2019 bei Glencore angestellt war, nach Verhandlungen mit dem US-Justizministerium schuldig bekannt hat. Die USA ermittelten schon seit 2018 gegen mehrere Glencore-Angestellte. Mindestens 7 weitere Personen sollen ebenfalls in die Bestechungen involviert sein.
Warum das wichtig ist: Die Nachricht kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für das Unternehmen. Mit dem Südafrikaner Gary Nagle hat gerade erst ein neuer Chef das Ruder des viertgrössten Rohstoffkonzerns der Welt mit Sitz in Zug übernommen. Sein Vorgänger Ivan Glasenberg führte Glencore fast 20 Jahre lang mit wenig Rücksicht auf Umwelt und Personal. Die Kombination aus Menschenrechtsverletzungen und hohen Investitionen in fossile Energien hat in der jüngsten Vergangenheit dazu geführt, dass die Aktie für Investoren unattraktiv wurde. Erst letztes Jahr hat der norwegische Staatsfonds, einer der weltweit grössten Investoren, seine Glencore-Beteiligung verkauft und das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Dass ein Ex-Angestellter nun zugegeben hat, Behörden im Namen von Glencore bestochen zu haben, könnte die Bemühungen des neuen Chefs behindern, der den Konzern in allen Bereichen nachhaltiger gestalten muss.
Was als Nächstes geschieht: In einer Mitteilung bezeichnete Glencore das Verhalten des Ex-Angestellten als «inakzeptabel». Das interne Ethik- und Compliance-Programm sei in den letzten Jahren erheblich verbessert worden. Ruhiger wird es damit für Glencore aber voraussichtlich nicht. Noch offen ist etwa, was mit den 7 anderen in die Bestechungen involvierten Personen geschieht. Ausserdem laufen noch weitere Untersuchungen wegen Korruption in den USA, Brasilien, Grossbritannien und der Schweiz.
Nach Aus für Rahmenabkommen: EU lockt Schweizer Wissenschaftlerinnen
Darum geht es: Spitzenforscherinnen an Schweizer Hochschulen, die für ihre Projekte im Rahmen des EU-Forschungsprogramms «Horizon» Förderbeiträge beantragt hatten, erhielten laut Recherchen des «Tages-Anzeigers» vom Europäischen Forschungsrat (ERC) das Angebot, an eine Hochschule in der Europäischen Union zu wechseln, um weiter von EU-Mitteln profitieren zu können. In der Schweiz gab es empörte Reaktionen. «So dreist versucht die EU, Top-Forscher abzuwerben», titelte der «Blick».
Warum das wichtig ist: Ende Mai hat die Schweiz das Rahmenabkommen mit der EU einseitig für gescheitert erklärt. Eine der gravierendsten Folgen: Die EU hat die Schweiz beim fast 100 Milliarden Euro schweren «Horizon»-Forschungsprogramm bis auf weiteres zum «nicht assoziierten Drittstaat» herabgestuft. Dies bedeutet für Forscher in der Schweiz, dass sie sich nur noch für europäische Forschungsprogramme bewerben können, wenn der Bund einspringt und die Kosten übernimmt. Dafür sind 6 Milliarden Franken budgetiert. Von einem Drittland aus können Schweizer Forscherinnen sowie Unternehmen europäische Projekte allerdings nicht mehr koordinieren. Bereits zwischen 2014 und 2016 war die Schweiz nicht Teil von «Horizon». Damals brach die Beteiligung der Schweiz an EU-Forschungsprojekten ein.
Was als Nächstes geschieht: Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) hat die Schweizer Regierung in einem Brief aufgefordert, mit der EU so rasch wie möglich Verhandlungen über die volle Teilnahme an «Horizon» aufzunehmen. Auch die Vereinigung der Schweizer Universitäten schlug in einer Stellungnahme Alarm. Die Schweiz sei als Wissenschaftsstandort auf die europäische Zusammenarbeit angewiesen.
Zum Schluss: Unangemessen kurze Hosen im Beachhandball
Bis vor einer Woche wussten viele Leute nicht, dass es eine Sportart namens Beachhandball gibt. Sogar der üblicherweise gut unterrichtete «Guardian» musste in einer Fussnote einräumen, dass in einem Artikel zum Thema zunächst von Beachvolleyball die Rede gewesen war. So gesehen haben die Funktionäre der Europäischen Handballföderation EHF (die auch für Beachhandball zuständig ist) einen PR-Coup gelandet. Dummerweise war es schlechte PR. Das Regelwerk schreibt nämlich vor, dass das Beinkleid von Beachhandballerinnen an der Seite maximal 10 Zentimeter breit sein dürfe. Doch das norwegische Frauenteam hatte keinen Bock auf Bikinihöschen und trat im Spiel um Rang 3 an den Europameisterschaften in Shorts an. Die Disziplinarkommission der EHF sanktionierte diese «unangemessene Bekleidung» mit einer Busse von 1500 Euro. Und katapultierte damit die Randsportart ins Zentrum des medialen Interesses. Popstar Pink verkündete ihren gut 31 Millionen Followern auf Twitter, sie sei stolz auf die Norwegerinnen, die gegen diese «sexistischen Regeln» protestierten, und bot an, die Busse zu bezahlen. Eine Bestätigung der Überweisung steht aus. Was aber offiziell verkündet wurde: Die EHF spendet das Bussgeld. Und zwar einer «Sportstiftung, welche die Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Sport unterstützt».
Was sonst noch wichtig war
Schweiz I: Eine Arbeitsgruppe des Nachrichtendienstes verlangt, man müsse die «Kultur des Dienstes von Sexismus befreien». Zuvor hatte eine Personalumfrage gezeigt, dass die Angestellten sehr unzufrieden sind, besonders die Leitung kam schlecht weg. Schon im Mai war bekannt geworden, dass Geheimdienstchef Jean-Philippe Gaudin gehen muss.
Schweiz II: Im Pandemiejahr 2020 wurden 10 Prozent mehr Krankentaggelder ausbezahlt als noch 2019. Ähnlich hohe Auszahlungen sind fürs laufende Jahr zu erwarten, das zeigen Zahlen von Swica, der Branchenführerin im Bereich der Krankentaggeldversicherung.
Deutschland: Der Verlag C. H. Beck will seine Gesetzeskommentare nicht länger unter den Namen von Nationalsozialisten herausbringen. Bisher war etwa der Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch als «Palandt» – Otto Palandt war Präsident des Reichsjustizprüfungsamts – bekannt. Künftig sollen auf dem Titelblatt die Namen der Herausgeber oder Koordinatoren der aktuellen Auflagen stehen.
Ungarn: Letzten Samstag haben an der «Budapest Pride» mehrere zehntausend für LGBTQ-Rechte demonstriert. Laut den Veranstaltern haben noch nie so viele an diesem Marsch teilgenommen. Die Regierung Orbán hat in letzter Zeit mehrere Gesetze beschlossen, die sich gegen nicht heterosexuelle Menschen richten.
Bosnien-Herzegowina: Ab Ende Juli stehen die Leugnung von Völkermord und die Verherrlichung von Kriegsverbrechern unter Strafe. Das hat der Hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina kurz vor Ablauf seiner Amtszeit verfügt. Der serbische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium reagierte empört und betonte einmal mehr, in Srebrenica habe kein Völkermord stattgefunden.
Russland: Die Website von Alexei Nawalny ist gesperrt worden. Zudem verfügte die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau auch die Sperrung von 49 weiteren Websites von Organisationen und Personen, die mit Nawalny in Verbindung stehen.
Grossbritannien: Die Tabakfirma Philip Morris hat angekündigt, im Laufe der nächsten 10 Jahre den Zigarettenverkauf im Land einzustellen. Die englische Regierung möchte das Land bis 2030 rauchfrei machen.
USA: Vor einem Kongressausschuss haben die Anhörungen zum Sturm aufs Kapitol am 6. Januar begonnen. Polizisten schilderten teilweise unter Tränen, mit welchem Hass der Mob auf sie losging.
Ecuador: Ein Gericht in Quito hat Julian Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft aberkannt. Bei der Erteilung seien verwaltungsrechtliche Fehler gemacht worden.
Afghanistan: China hat am Mittwoch eine Delegation der Taliban zu Gesprächen empfangen. Die Taliban sind in Afghanistan auf dem Vormarsch und haben im letzten Monat bereits diplomatische Kontakte mit Russland, Turkmenistan und dem Iran geknüpft.
Korea: Nord- und Südkorea haben ihre direkten Verbindungskanäle wieder geöffnet, die vor einem Jahr gekappt worden waren. Die beiden Staatschefs Kim Jong-un und Moon Jae-in wollen «so schnell wie möglich das Vertrauen wiederherstellen und die Beziehungen verbessern».
China: In Hongkong wurde erstmals ein Angeklagter nach dem neuen Sicherheitsgesetz verurteilt. Tong Ying-kit wurde wegen Aufruf zur Sezession und Terrorismus zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Menschenrechtler sehen im Urteil ein klares Signal, dass regimekritische politische Positionen zu Verbrechen erklärt werden.
Australien: In Sydney unterstützen Soldaten die Polizei bei der Durchsetzung des Lockdowns. Australien war lange glimpflich durch die Pandemie gekommen, doch nun verbreitet sich die Deltavariante im Land.
Olympische Spiele: Die Schweizer Mountainbikerinnen holten sich in Tokio gleich alle drei Medaillen: Jolanda Neff siegte vor Sina Frei und Linda Indergand. Es ist das erste Mal, dass Schweizerinnen an Olympischen Spielen alle drei Podestplätze besetzen. Schweizer Männern war dies zuletzt 1936 in Berlin im Bodenturnen gelungen.
Die Top-Storys
Fechter unter Verdacht Der US-amerikanische Fechter Alen Hadzic darf an den diesjährigen Olympischen Spielen teilnehmen. Im olympischen Dorf schlafen darf er aber nicht. Grund für die Spezialbehandlung: Mehrere Fechterinnen haben gegen Hadzic Beschwerde wegen sexueller Übergriffe eingereicht. Eine Recherche von «Buzzfeed News» offenbart, wie die Karriere des Fechters seit Jahren von Vorwürfen der sexualisierten Gewalt begleitet wird – und immer weitergeht.
And still I rise Gleich noch mal nach Tokio, dieses Mal zu einer bewundernswerten Teilnehmerin: Die Turnerin Simone Biles ist eine der eindrücklichsten Sportlerinnen unserer Zeit. Erst recht, seit sie diese Woche wegen mentaler Probleme ihre Wettkampfteilnahme an den Olympischen Spielen abgebrochen hat. Ihre Ehrlichkeit ist genauso ein Markenzeichen wie ihre unfassbaren Sprünge. Das zeigt ein Porträt der «New York Times» über die Ausnahmeathletin, die am glücklichsten ist, wenn sie freihat.
Ausflug in die Arktis Das Eis in der Arktis schmilzt. Nur wie schnell? Eine Expedition von 300 Wissenschaftlern soll Klarheit bringen. Die NZZ hat die Arbeit von Schweizer Schneeforscherinnen im Eis dokumentiert. Wie sie arbeiteten und was sie dabei rausfanden, lässt sich in der eindrücklich animierten Geschichte nacherleben.
Illustration: Till Lauer