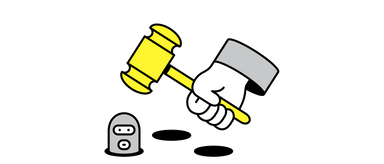
Die Sündenböcke von Moria
Sechs Afghanen sind laut griechischen Gerichten Schuld am Brand des Lagers für Geflüchtete. Die Verfahren waren höchst fragwürdig, und zwar nicht nur deshalb, weil der wichtigste Zeuge spurlos verschwunden ist.
Von William Stern, 30.06.2021
Ihnen liegt etwas am Rechtsstaat? Uns auch. Deshalb berichten wir jeden Mittwoch über die kleinen Dramen und die grossen Fragen der Schweizer Justiz.
Lesen Sie 21 Tage zur Probe, und lernen Sie die Republik und das Justizbriefing kennen!
Am 8. September 2020 brannte das Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos ab. Moria war zu diesem Zeitpunkt längst zum Synonym der gescheiterten Migrationspolitik der Europäischen Union geworden. Im Lager, das ursprünglich für knapp 3000 Personen errichtet worden war, drängten sich im Sommer 2020 über 20’000 Geflüchtete. Zum Zeitpunkt des Brandes im Herbst waren es noch immer 12’000 Menschen. Infolge der Covid-Pandemie wurde es abgeschottet: Quarantänezonen wurden eingerichtet, Ausgangssperren eingeführt.
Eine Woche nach dem Brand verhaftete die griechische Polizei sechs junge Afghanen – für den griechischen Migrationsminister Notis Mitarachi war schon da klar, dass es sich bei den Festgenommenen um die gesuchten Brandstifter handelt. Bei Menschenrechtsorganisationen und Rechtsexpertinnen löste dies tiefe Besorgnis aus: Die Vorverurteilung durch ein Regierungsmitglied, so die Befürchtung, deute darauf hin, dass sich das Verfahren verpolitisieren würde – kein gutes Vorzeichen für eine unabhängige Urteilsfindung.
Ohne grosse mediale Resonanz verurteilte das Jugendgericht auf Lesbos im März dieses Jahres zwei der sechs Angeklagten zu fünf Jahren Haft. Das Urteil wurde angefochten. Mitte Juni standen nun die anderen vier Beschuldigten in Chios vor Gericht. Was sich im Gerichtssaal genau abgespielt hat, wissen nur die unmittelbaren Verfahrensbeteiligten.
Ort: District Court Chios
Zeit: 11. Juni 2021, 9 Uhr Lokalzeit
Fall-Nr.: A.B.M. A2020/2059
Thema: Brandstiftung, Gefährdung des Lebens, Zerstörung von Privateigentum, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung
Am 11. Juni fanden sich im Gerichtssaal des District Court in Chios folgende Personen ein: die vier Angeklagten, drei Richter, vier Geschworene, zwei Verteidigerinnen, vier Polizisten, eine Handvoll Zivilpolizisten und insgesamt mehr als ein Dutzend Zeuginnen und Zeugen.
Die wichtigste Person fehlte.
Zeuge D. war nicht mehr auffindbar. Zwei Wochen nach dem Brand hatte der Afghane die Insel verlassen, trotz Reisebeschränkung wegen Covid. Gemäss Verteidigung mit einem positiven Asylbescheid in der Tasche. Mittlerweile, so die Vermutung, befindet sich D. in Deutschland. D. war die einzige Person, die die vier Angeklagten identifiziert hatte. In einem schriftlichen Statement, das er bei der Polizei gemacht hatte, gab er an, gesehen zu haben, wie seine afghanischen Landsleute das Feuer im Camp legten.
Die Verhandlung auf der Insel Chios konnte von der Republik nicht verfolgt werden. Eine Liveübertragung, wie sie in der Pandemie mancherorts üblich ist, fand nicht statt. Mehr noch: In einem kurzfristigen Entscheid verwehrte das Gericht den vor Ort anwesenden Journalistinnen den Zutritt zum Gerichtssaal. Die Begründung: Die griechischen Corona-Beschränkungen erlaubten maximal fünfzehn Personen im Raum. Cafés und Restaurants waren zu diesem Zeitpunkt bereits wieder geöffnet, die Tourismussaison nahm in Griechenland langsam Fahrt auf.
Prozessbeobachter unerwünscht
Einer der wichtigsten Grundsätze des Prozessrechts ist das Öffentlichkeitsprinzip. Urteile müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein, damit sie bekannt werden und nachvollzogen werden können. Werden Urteile im Geheimen gefällt, so liegt der Verdacht der Kabinettsjustiz nahe. Ausnahmen bilden das Jugendstrafrecht sowie Fälle, bei denen begründete Annahmen für eine Verletzung der Intimsphäre der beteiligten Personen vorliegen.
Auf dieses Prinzip stützt sich die Berichterstattung von Journalisten aus den Gerichtssälen, aber auch die Arbeit von sogenannten Prozessbeobachterinnen. Annina Mullis ist eine von ihnen. Die Berner Anwältin arbeitet in diesen Wochen als unabhängige Rechtsberaterin auf den griechischen Inseln. Mit einem Mandat der Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz (DJS) und der European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) hätte sie den Prozess gegen die vier Afghanen verfolgen sollen.
Angemeldet war die Bernerin mit einem kombinierten Bestätigungsschreiben der DJS und der ELDH, das die Verteidigung beim Gericht eingereicht hatte. Mullis erzählt, wie sie und andere Prozessbeobachter bereits bei der Ankunft auf Chios gezielt von der Polizei kontrolliert worden seien. Kurz vor Prozessbeginn erfuhren sie dann, dass sie nicht in den Gerichtssaal eingelassen würden. Stattdessen verfolgten die angereisten Beobachterinnen den Prozess vor den Toren des Gerichts.
Drinnen verteidigte Natasha Dailiani, Anwältin beim Legal Centre Lesvos, zusammen mit einer Kollegin die vier Angeklagten. Das Verfahren, sagt sie nach dem Prozess im Gespräch mit der Republik, sei in derart vielen Punkten unfair gewesen, sie wisse gar nicht, wo anfangen. «Es ist Usus, dass die Verteidigung den Hauptbelastungszeugen befragen kann. Dass sich das Gericht zufriedengibt mit einem schriftlichen Statement des Zeugen, das erst noch voller Ungereimtheiten ist, ist eine grobe Missachtung der Verfahrensregeln.» Auch sei die Anklage den Beschuldigten nicht in ihrer Sprache vorgelegen.
Und zu schlechter Letzt, so Dailiani, seien drei der vier Angeklagten ohnehin vor dem falschen Gericht gestanden: «Sie waren minderjährig und hätten deshalb vor ein Jugendgericht gehört.» Auch eine Woche nach der Verhandlung schwingt in der Stimme der Anwältin hörbar Empörung und Unverständnis mit.
Kriminalisierung an Europas Grenzen
Ein Hauptbelastungszeuge, der nicht vor Gericht erscheint, ein Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, Angeklagte, bei denen zumindest grosse Zweifel bestehen, dass sie überhaupt dem Erwachsenenstrafrecht unterstehen: Was ist da los?
Die deutsche Migrationsforscherin Valeria Hänsel, die den Prozess ebenfalls vor Ort verfolgte, ist überzeugt: «Wir hatten es mit einem politischen Verfahren zu tun. Die griechische Justiz hatte kein Interesse daran, den Fall wirklich aufzuklären. Es ging bloss darum, Sündenböcke für den Brand im Lager Moria zu präsentieren.» Hänsel, die zum Thema Grenzregime in der Ägäis promoviert, sagt, in den letzten Jahren habe man in Griechenland eine zunehmende Kriminalisierung von Geflüchteten beobachten können.
Das lässt sich auch empirisch belegen. Eine Forschungsgruppe der Universität Göttingen, der auch Hänsel angehört, untersuchte 48 Fälle von Schleuserprozessen in Griechenland. Hänsels Befund: «Alle 48 Angeklagten wurden verurteilt, im Schnitt wurden 48 Jahre Haftstrafe ausgesprochen. Die Dauer der Verfahren belief sich auf durchschnittlich 27 Minuten.»
In weniger als einer halben Stunde langjährige Haftstrafen aussprechen: Das tönt nach einer Massenabfertigung, die man in einem autoritären Regime ohne unabhängige Justiz erwarten würde. Griechenland jedoch ist Mitglied der EU und hat die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) unterzeichnet. Die EMRK garantiert unter Artikel 6 das Recht auf ein faires Verfahren.
Doch was sich in Griechenland abspielt, spottet nach Ansicht vieler Beobachterinnen dieser verbrieften Garantien. Menschenrechtsorganisationen, Journalistinnen und Bürgerrechtler werfen den griechischen Behörden seit längerem systematische Rechtsverletzungen im Umgang mit Geflüchteten vor: willkürliche Festnahmen, Polizeigewalt, unüblich lange Untersuchungshaft. Und die Covid-Pandemie, sagt Hänsel, habe es den Behörden noch einmal erleichtert, autoritäre Massnahmen gegenüber Geflüchteten zu legitimieren.
Drei Tage nach dem Prozess sitzt die Berner Anwältin Mullis in einem Café in Chios beim Mittagessen. Am Telefon erklärt sie Sinn und Zweck der Prozessbeobachtung: «Es geht um die Einhaltung von rechtlichen Standards. Wenn ich als Verteidigerin am Gericht bin, achte ich natürlich auch auf Verfahrensrechte, aber ich bin nicht neutral, weil ich immer die Interessen meiner Mandantinnen vertrete.» Als Prozessbeobachterin hingegen könne sie den Verfahrensablauf aus einer fachlichen, nicht involvierten Perspektive bewerten.
Statt die Verhandlung im Gerichtssaal zu verfolgen, teilte Prozessbeobachterin Mullis die Informationen, die sie in den Gerichtspausen vom Verteidigungsteam und von den Zeuginnen erhielt, via Twitter. «Bei der Prozessbeobachtung geht es auch darum, eine Öffentlichkeit herzustellen», sagt Mullis. Eine Justiz, die im Geheimen befragt, beratschlagt und urteilt, sei eine Gefahr für die Demokratie und anfällig für Machtmissbrauch. «Das Konzept des öffentlichen Strafverfahrens basiert darauf, dass sich das Gericht gegenüber der Bevölkerung verantworten muss.» Nach dem Ende der Verhandlung verfasst Mullis üblicherweise einen Prozessbericht zuhanden ihrer Auftraggeber.
«Ein vernichtendes Urteil, das leider so zu erwarten war»
Über den Nutzen ihrer Anwesenheit macht sich die Juristin keine Illusionen: «Ich mache seit 2012 regelmässig Prozessbeobachtungen, ich war in Griechenland, in der Türkei und in Ungarn. In der Türkei etwa wurde ich noch nie ausgeschlossen, aber ich hatte nie wirklich den Eindruck, dass es die Richter gross kümmert, dass ich im Saal sitze.»
Aber auch wenn die Anwesenheit von Prozessbeobachterinnen Richter kaltlassen mag: Für Angeklagte kann sie einen Unterschied machen. «Gerade bei politisch motivierten Verfahren, bei denen die Angeklagten einer instrumentalisierten Justiz ausgeliefert sind, erleben sie die Anwesenheit von Prozessbeobachterinnen oft als unterstützend», sagt Mullis.
Ob die Anwesenheit von Mullis und anderen Prozessbeobachtern am Verlauf und am Ausgang des Verfahrens gegen die vier mutmasslichen Brandstifter von Moria etwas geändert hätte, ist Spekulation.
Nach mehr als zehn Stunden Verhandlung entschied die Jury (drei Richter, vier Geschworene) am Tag darauf einstimmig: Die vier Angeklagten sind schuldig zu sprechen wegen Brandstiftung, Gefährdung von Menschenleben und Zerstörung von Privateigentum. Die Anträge der Verteidigung auf mildernde Umstände wurden allesamt abgelehnt. Das Strafmass: zehn Jahre Haft. «Ein vernichtendes Verdikt», sagt Migrationsforscherin Hänsel am Telefon, «aber eines, das leider so zu erwarten war.»
War es ein fairer Prozess, Frau Mullis?
«Nach allem was wir wissen: nein», sagt die Prozessbeobachterin. «Gestützt auf die Aussagen der Verteidigerinnen und auf die vor dem Gerichtsgebäude gesammelten Eindrücke, muss ich zum Schluss kommen, dass der Prozess nicht den Vorgaben eines fairen Verfahrens entsprach.» Im Zentrum von Mullis’ Kritik stehen vor allem drei Punkte. «Erstens: dass die hauptbelastende Aussage nur schriftlich vorlag. Zweitens: die mit der Abwesenheit des Zeugen einhergehende Verletzung des Fragerechts. Und drittens: der faktische Ausschluss der Öffentlichkeit.»
Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.
Illustration: Till Lauer