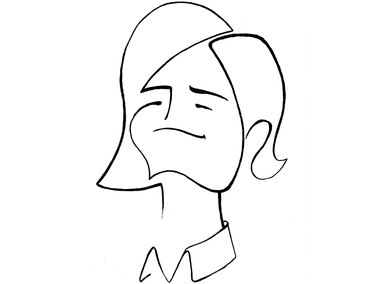
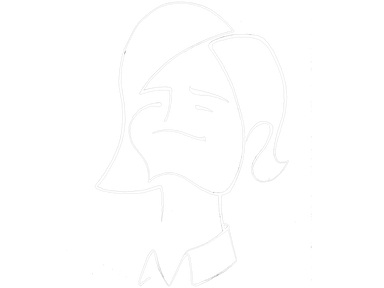
Keine falschen Hemmungen mehr
Wie der Nationalrat in der Schweizer Corona-Politik agiert, zeigt: Die Distanzen zwischen dem bürgerlichen Mainstream und dem radikalen Rechtspopulismus sind kurz geworden.
Von Daniel Binswanger, 06.03.2021
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
Der optimistische Erklärungsansatz lautet folgendermassen: Was sich diese Woche im Nationalrat zugetragen hat, muss auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass das Schweizer Politiksystem mit der Jahrhundertpandemie bis heute überfordert ist. Dass es seit dem Zweiten Weltkrieg kaum mehr ernsthaft Krisen erprobt hat und deshalb nur begrenzt krisenfähig ist. Dass die Gesamtbilanz beschämend bleibt, die Gereiztheit deshalb immer explosiver wird – und nun eine hoffentlich abschliessende Krönung findet in einer Amok-Geste des Parlaments. Corona bringt die Schweizer Institutionen – den Föderalismus, das Kollegialitätsprinzip, die dezentralisierten Verantwortlichkeiten – zwar an den Rand, aber bald schon kehren wir zurück zum politischen Courant normal.
Wie gesagt: Das ist die optimistische These.
Die potenziell realistischere Bewertung lautet anders. Was hier geschehen ist, lässt sich durch den epidemiologischen Ausnahmezustand höchstens teilweise begründen. Die bürgerlichen Parteien der Schweiz – nicht nur die SVP, sondern auch die FDP und zu sehr substanziellen Teilen die Mitte – haben zum Generalangriff auf ihre eigenen Regierungsvertreter geblasen, der in dieser Form ohne Beispiel ist. Und sie haben es nicht getan, um bedrohte staatspolitische Prinzipien wie zum Beispiel die Gewaltenteilung oder die Grundrechte zu verteidigen, sondern um den primärsten und destruktivsten Populismus zu bedienen. Ohne den Hauch einer Hemmung.
Hier ist eine Grenze überschritten worden: Das Kräftegleichgewicht und die Art und Weise, wie in diesem Land Politik gemacht wird, könnten sich grundsätzlich zu verschieben beginnen. Unabhängig von der Pandemie – und auch wenn diese schon lange wieder vorüber sein wird. Die Medien haben den Nationalrat zwar mit Schelte überzogen – aber es wurde selten benannt, was die grosse Kammer mit ihrer «Erklärung» wirklich gefordert hat.
Den Bundesrat zu kritisieren, ist sicherlich legitim, genauso wie die Forderung nach einer aggressiveren Impfstrategie und der konsequent umzusetzenden Implementierung von landesweiten Massentests, die gestern ja endlich angekündigt wurde. Doch der Nationalrat tat etwas anderes. Er forderte nicht nur die zwingende Öffnung der Gaststätten am 22. März. Diese Öffnung hat der Bundesrat ja schon lange beschlossen, er knüpft sie jedoch an die Bedingung, dass das Infektionsgeschehen mindestens stabil sein muss, bevor sie erfolgen kann. Was der Nationalrat de facto gegen den Bundesrat durchsetzen will, ist der Zwang zur Öffnung bei steigenden Fallzahlen.
Öffnen zum Anheizen der dritten Welle? Natürlich wäre das ein derartiger Irrsinn, dass keiner der grossen Wortführer sich explizit dazu bekennen mag. Genau das ist aber die politische Substanz der nationalrätlichen «Erklärung». Unter der Prämisse, dass die Fallzahlen nicht steigen, würde das grossspurige «Druckmittel» praktisch folgenlos bleiben. Lockerungen in den Anstieg sind nach Überzeugung unserer Volksvertreter ganz offensichtlich die angezeigte Methode, um den Volkszorn abzuholen. Oder wie etwa FDP-Präsidentin und Nationalrätin Petra Gössi immer wieder betonte: Wir sind die Volksvertreter, wir müssen ins Parlament bringen, wie es im Volk am Brodeln ist.
Natürlich sind Petra Gössi und ihre Mitstreiter durchaus zurechnungsfähige Persönlichkeiten. Sie machen das Kalkül, dass es reichen wird, ein bisschen deklarative Symbolpolitik zu betreiben. Und dass spätestens der Ständerat verhindern wird, dass im Parlament die «Öffnungsforderungen» tatsächlich durchgesetzt werden und es dann dafür auch geradestehen müsste. Alles halb so wild und gar nicht so gemeint? Ganz so einfach ist es nicht.
«Als sich die Lockdowns verlängerten, haben Populisten den Widerstand gegen die Regierungsstrategien befeuert. Häufig verhärtete sich das Schüren der Unzufriedenheit zu einer Zurückweisung der Autorität von Wissenschaft und Behörden.» Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? So beschreibt der «Economist» diese Woche eine fatale politische Dynamik, die er in vielen westlichen Ländern am Werk sieht. Der Titel des Essays: «Wie Rechtsextremismus eine globale Bedrohung wird».
Natürlich können wir die Kirche vorderhand im Dorf lassen. Die nationalrätliche Mehrheit für den Öffnungszwang besteht nicht aus QAnon-Anhängern – im Gegensatz zum amerikanischen Repräsentantenhaus, wo Verschwörungstheoretikerinnen dieser Art zwar nicht eine Mehrheit bilden, jedoch schon ihren festen Platz haben. Aber wir werden zu Zeugen von breitflächigen Radikalisierungen, die bis vor kurzem kaum vorstellbar waren und alles andere als unschuldig sind. Ist den Damen und Herren Nationalrätinnen wenigstens bewusst, in welch verblüffendem Wandlungsprozess sie sich befinden?
Erstens wäre es ein extrem barbarischer Akt, ein paar Wochen bevor ein signifikanter Impfschutz erzielt worden ist, verfrüht zu öffnen und noch einmal hohe Opferzahlen zu provozieren. Umso mehr, als es ausgerechnet die Öffnungsturbos sind, welche die Hilfsleistungen für bedrängte Betriebe und Arbeitnehmer auf Sparflamme halten und damit die Notlage der breiten Bevölkerung erst richtig anheizen.
Zweitens dürfte es ein Novum sein in der Schweizer Politik, dass sich die bürgerlichen Traditionsparteien einer so radikalen Agenda anschliessen. Dass die SVP die Pandemie zum Anlass nimmt, wieder in der Fundamentalopposition ihr Glück zu suchen, ist eine mässige Überraschung. Aber dass sie dabei Schulter an Schulter steht mit Petra Gössi, Martin Landolt, Gerhard Pfister – auch wenn die letzteren beiden sich dabei verzweifelt winden und wilde taktische Manöver machen? Mit den politischen Kräften, die bei allen rechtsbürgerlichen Solidaritätsreflexen doch staatspolitische Minimalstandards hochhielten und sich für den ungefilterten Primärpopulismus bisher in der Regel zu gut geblieben sind? Das ist neu in diesem Kino.
Es gibt nicht mehr allzu viel, worauf wir uns in den nächsten Jahren in der Schweizer Politik verlassen sollten. Jedenfalls nicht auf ein bürgerliches Führungspersonal, das sich, wenn es gerade opportun erscheint, auch schon mal in die Rolle der coronapolitischen Todesschwadronen wirft. Weil es eben «brodelt im Volk».
Die Grenzen zwischen dem bürgerlichen Mainstream und dem radikalen Rechtspopulismus sind porös geworden – und die Durchlässigkeit dürfte weiter zunehmen. Oder, wie der «Economist» schreibt: «Die Distanzen werden kurz.»
In den USA ist die ganze konservative Bewegung zu einem eigenen melting pot geworden: Das republikanische Establishment zerfliesst in einem Magma aus corporate interests, wilden Verschwörungstheorien und Komplizenschaft mit dem Kapitol-Sturm. Eingesetzt hat diese Entwicklung natürlich lange Jahre vor der Pandemie. Sie wird nicht enden, wenn das Virus besiegt ist.
Und so verschieben sich nun sanft und unaufhaltsam auch bei uns die politischen Standards. Gestern Abend fand eine SRF-«Arena» statt mit dem Titel «Corona-Diktatur Schweiz – wirklich?». Auch absurde Propaganda muss im öffentlich-rechtlichen Fernsehen jetzt offenbar ganz ernsthaft und breit diskutiert werden. Wenn alle bürgerlichen Parteien ein solches Framing benutzen, steckt es das Feld der legitimen Debatten ab. Wie wäre es mit: «Klimawandel – eine Lüge?». Oder: «Weltherrscher Bill Gates – wirklich?».
Noch sind wir nicht ganz so weit. Aber die Distanzen werden kurz. Und eines wissen wir bereits über das neobürgerliche Demokratieverständnis in der Schweiz: Wenn es brodelt im Volk, gibt es keine falschen Hemmungen mehr.
Illustration: Alex Solman