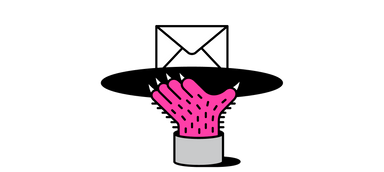
Nationalrat will schnellere Corona-Öffnungen, etwas weniger Geldwäsche und Geld für Onlinemedien
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (137).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler, Elia Blülle und Cinzia Venafro, 04.03.2021
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Es war noch früh am Morgen, als gestern Mittwoch unter der Bundeshauskuppel schon heftig gestritten wurde.
Das Resultat nach einem heftigen Wortgefecht zwischen SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher und SP-Vertreterin Prisca Birrer-Heimo: Der Nationalrat fordert den Bundesrat auf, die Corona-Massnahmen schneller zu lockern. Aber zwingen will er ihn dazu (noch) nicht.
Mit einer Erklärung, die mit 97 zu 90 Stimmen verabschiedet wurde, fordert der Nationalrat, dass Gastro-, Freizeit-, Kultur- und Sportbetriebe bereits ab dem 22. März wieder öffnen dürfen. Zudem soll die Fünf-Personen-Regel für Innenräume gekippt werden.
Bloss: Die «Erklärung» hat keinen bindenden Charakter, die Regierung kann sie erhören oder auch nicht. Birrer-Heimo sprach denn auch von einem «politischen Schaulaufen». An diesem mochten die Grünen nicht teilnehmen: Sie schwänzten die Debatte demonstrativ und rannten erst zur Abstimmung in den Saal, um gegen die Erklärung zu votieren.
Entscheidend für die Verabschiedung der unverbindlichen Formulierung war die Mitte-Fraktion: Sie sei ein deutliches Zeichen an den Bundesrat, der bisher «stur» Tausende von Briefen aus der Bevölkerung ignoriert habe, sagte Martin Landolt von der Partei die Mitte. In der Tat gibt es Druck auf die Regierung, namentlich von rechts: Eine von der SVP und bürgerlichen Jungpolitikern lancierte Petition mit rund 300’000 Unterschriften fordert, die Corona-Massnahmen seien ab dem 22. März zu lockern.
Egal, wie die Pandemie sich entwickelt.
So weit will das Parlament vorerst nicht gehen. Doch bereits nächsten Montag könnte die grosse Kammer den Öffnungsturbo per Gesetz einschalten: Dann berät der Nationalrat darüber, eine Öffnung ab 22. März ins Covid-19-Gesetz zu schreiben.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Transparenzinitiative: Nationalrat ist für Gegenvorschlag
Worum es geht: Der Nationalrat will mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Am Mittwoch hat er einem Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative zugestimmt. Die ausgearbeitete Vorlage würde Politikerinnen und Parteien künftig zwingen, Zuwendungen von über 15’000 Franken öffentlich zu deklarieren. Die Initiative sieht eine Schwelle von 10’000 Franken vor.
Warum Sie das wissen müssen: Aktuell müssen Parteien und Politikerinnen Spenden in der Schweiz nicht deklarieren. Dadurch werden Korruption und Hinterzimmerdeals begünstigt, was die NGO Transparency International seit Jahren kritisiert. Ihr Geschäftsführer, Martin Hilti, sagte 2019 zur Republik: «Der grosse Skandal in der Schweiz ist, dass wir trotz wiederkehrender kleinerer Skandale als einziges Land in Europa keine Transparenz kennen über die Finanzierung von Parteien, Wahlen und Abstimmungen.»
Wie es weitergeht: Mit dem Gegenvorschlag will der Nationalrat den Rückzug der Initiative bewirken. Sollte der Ständerat den Vorschlag in seiner jetzigen Form ebenfalls akzeptieren, stünden die Chancen gut, dass das Initiativkomitee einlenkt.
Auch der Ständerat sagt Nein zur 99-Prozent-Initiative
Worum es geht: Mit 32 zu 13 Stimmen lehnt der Ständerat die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital besteuern» deutlich ab. Damit empfehlen Parlament und Bundesrat, das auch als 99-Prozent-Initiative bekannte Begehren der Jungsozialisten an der Urne abzulehnen. Der Nationalrat hatte die Initiative bereits im September abgeschmettert, Grüne und die SP stimmten in beiden Kammern dafür.
Warum Sie das wissen müssen: Die 99-Prozent-Initiative fordert, dass ein Lohnfranken prozentual weniger besteuert wird als ein Franken, der ohne Arbeit erwirtschaftet wurde, also beispielsweise durch Dividenden oder Zinsen. Die Juso zielt damit auf ihr Kernthema soziale Gerechtigkeit. Konkret verlangt die Initiative, Kapitaleinkommen ab einem bestimmten Betrag mit 150 Prozent zu besteuern. Den Freibetrag müsste das Parlament bei einer Annahme bestimmen, die Jusos sprechen von 100’000 Franken. Die Einnahmen aus dieser zusätzlichen Besteuerung sollen an die Wohlfahrt gehen. Profitieren würden etwa Kinderkrippen und Pflegeeinrichtungen, das Geld würde aber auch für Prämienverbilligungen verwendet. «Es ist jetzt Zeit für mehr Steuergerechtigkeit», sagte der langjährige SP-Ständerat Paul Rechsteiner im Ständerat und verteidigte die Initiative seines Parteinachwuchses, der laut Juso-Chefin Ronja Jansen «Krisengewinner endlich zur Kasse bitten» will.
Wie es weitergeht: Nun geht es an die Vorbereitung des Abstimmungskampfes. Mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit könnten die Jungsozialisten mit Hilfe der SP und der Grünen bei der Bevölkerung auf offene Ohren stossen. Die Corona-Krise hat den Bundeshaushalt heftig durchgeschüttelt. So könnte das 16-Milliarden-Loch in der Bundeskasse einen Teil der Bevölkerung dazu bewegen, für die Initiative zu stimmen.
Gender Data Gap: Das Parlament will Frauen sichtbarer machen
Worum es geht: Der Bund soll Statistiken und Studien vermehrt nach Geschlechtern aufschlüsseln, um damit Datenlücken – in der Wissenschaft als Gender Data Gap oder Gender Data Bias bezeichnet – zu schliessen. Gegen den Willen der Landesregierung hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat eine entsprechende Motion der Basler Ständerätin Eva Herzog angenommen.
Warum Sie das wissen müssen: Viele Untersuchungen differenzieren gar nicht oder nur wenig nach Geschlecht. So wies Herzog in ihrer Motion etwa darauf hin, dass die Datenlage bei den Sozialversicherungen ungenügend und darum der Wissenstand über die Altersvorsorge nach Geschlecht suboptimal sei. Auch im Bereich der Medizin orientieren sich viele Untersuchungen am Standardmodell Mann, was für Frauen fatale Folgen haben kann.
Wie es weitergeht: Der Bundesrat hat nun zwei Jahre Zeit, die Motion umzusetzen. Tut er das nicht, muss er zumindest in einem Bericht darlegen, was er unternommen hat und was er noch zu tun gedenkt.
Asylsuchende: Kein Lehrabschluss bei negativem Entscheid
Worum es geht: Der Ständerat hat mit 24 zu 18 Stimmen bei 3 Enthaltungen eine Motion abgelehnt, die es Asylsuchenden ermöglichen sollte, ihre Lehre trotz negativem Asylentscheid zu beenden. Das Anliegen ist damit vom Tisch.
Warum Sie das wissen müssen: Es wäre eine humanitäre Geste gegenüber jungen Migrantinnen gewesen: Wer eine Lehre macht, soll sie auch abschliessen können, auch wenn ihm kein Asyl gewährt wird. Dafür machten sich auch Gewerbetreibende stark, die nicht für eine offene Asylpolitik bekannt sind. So setzte sich der Berner Käsermeister Hausi Mäder, Mitglied der SVP Schwarzenburg, für einen Lernenden aus Afghanistan ein, der seine Lehre auf Geheiss des Bundes nach 14 Monaten abbrechen musste – und seither Nothilfe erhält, weil er nicht ausgeschafft werden kann. Eine Petition an den Kanton Bern blieb erfolglos, der Kanton verwies auf die Zuständigkeit des Bundes. Also formulierte die Staatspolitische Kommission des Nationalrats die Motion «Eine Lehre – eine Zukunft». Die grosse Kammer sagte im Dezember mit grosser Mehrheit Ja dazu. Doch der Ständerat stellt sich auf den Standpunkt, nach der Revision des Asylgesetzes vor zwei Jahren bestehe kein Handlungsbedarf mehr. Asylverfahren sollten nun kaum noch so lange dauern, dass überhaupt Lehrverträge abgeschlossen werden, sagte Kommissionssprecher Thomas Hefti (FDP). Gleich argumentiert hatte auch der Bundesrat.
Wie es weitergeht: Gemäss dem Staatssekretariat für Migration sind noch rund 2900 Fälle nach dem alten Asylgesetz beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Wie viele unter ihnen derartige Lehrabbrüche nach sich ziehen werden, ist unbekannt.
Nationalrat spricht 30 Millionen Franken pro Jahr für Schweizer Onlinemedien
Worum es geht: Der Nationalrat hat beschlossen, neu auch Onlinemedien zu fördern. Anders als vom Bundesrat beantragt, soll das entsprechende Gesetz allerdings nicht zehn, sondern nur fünf Jahre lang gelten. Gleichzeitig will die grosse Kammer die bestehende Subventionierung der gedruckten Presse stark ausbauen.
Warum Sie das wissen müssen: Seit langem befinden sich die Medien in einer strukturellen Finanzierungskrise. Während der Pandemie sind die Erlöse jener Verlage weiter erodiert, die primär auf Werbeeinnahmen setzen. Nun greift der Bund der Branche unter die Arme. Der Nationalrat will die Ermässigung der Zustelltarife für abonnierte Tageszeitungen erhöhen und neu auch die Früh- und Sonntagszustellung verbilligen. Am umstrittensten war im Nationalrat die Ausgestaltung der neuen Onlineförderung: Schliesslich sprach er 30 Millionen Franken pro Jahr und bestätigte die von der Regierung vorgesehene Holdingklausel und die Degression. Diese zwei Instrumente sollen dafür sorgen, dass kleine und mittlere Verlage überproportional von der staatlichen Förderung profitieren, was den beiden mächtigsten Schweizer Verlegern Pietro Supino (TX Group) und Peter Wanner (CH Media) ein Dorn im Auge ist. Einen Etappensieg konnten allerdings auch sie erzielen: Der Nationalrat sprach sich dafür aus, Textbeiträge auf den Onlineplattformen der SRG weiter einzuschränken. Gut möglich allerdings, dass der Ständerat einer weitergehenden Beschränkung des durch die SRG zu leistenden Service public einen Riegel schieben wird.
Wie es weitergeht: Im Juni ist wieder der Ständerat an der Reihe, der dem Förderpaket im Grundsatz bereits im vergangenen Juni zugestimmt hat. Nun muss er unter anderem die Ausgabenbremse lösen, damit Onlinemedien dann wirklich Geld erhalten. Ein Inkrafttreten des Gesetzes vor Anfang 2023 ist unrealistisch, weil es für die neuartige Förderung der Onlinemedien eine ordentliche Vernehmlassung braucht. Printmedien hingegen können voraussichtlich schon ab Januar 2022 von mehr staatlicher Hilfe profitieren.
Geldwäscherei: Nationalrat will strengere Regeln – aber nur ein bisschen
Worum es geht: Noch im Dezember hatte der Nationalrat das Geschäft an seine Rechtskommission zurückgewiesen, nun aber ist er weitgehend der Vorlage des Ständerats gefolgt. Dieser hatte den Vorschlag des Bundesrats zur Verschärfung des Geldwäschereigesetzes schon im Herbst abgeschwächt. Übrig bleibt nun eine Minireform, die noch einmal zurück an den Ständerat geht.
Warum Sie das wissen müssen: Die Schweiz steht unter Druck aus dem Ausland, stärker gegen Geldwäsche vorzugehen. Die Gesetzesrevision ist eine Reaktion darauf. Doch der Vorschlag des Bundesrates hatte im Parlament einen schweren Stand. So wurden etwa Sorgfaltspflichten für Anwälte und Notarinnen gestrichen. Die Grenze für Barzahlungen im Handel mit Edelmetall und Edelsteinen will das Parlament nicht senken. Und das Geldwäschereigesetz soll nicht auf Goldraffinerien ausgedehnt werden. Immerhin hat der Nationalrat nach Warnungen der Finanzmarktaufsicht darauf verzichtet, die Hürde für Verdachtsmeldungen zu erhöhen. Die Linke findet die Reform in dieser Form trotzdem nutzlos. Mehrheitsfähig gemacht hat die Vorlage die SVP, die nach anfänglichem Widerstand nun mit der vorliegenden Minimalvariante leben kann.
Wie es weitergeht: Das Geschäft geht zur Bereinigung letzter Differenzen namentlich bei der Meldepflicht für Verdachtsfälle zurück an den Ständerat. Doch selbst wenn sich die Räte einigen, wird der Druck aus dem Ausland für weitere Verschärfungen hoch bleiben. Finanzminister Ueli Maurer kündigte im Nationalrat bereits an, bald eine nächste Revision mit neuen Lösungen vorzulegen.
Rahmenabkommen: EU lässt die Schweiz auflaufen
Worum es geht: Sieben Stunden lang soll Staatssekretärin Livia Leu vergangene Woche in Brüssel verhandelt haben – ohne Erfolg. Die EU ist offenbar zu keinen Zugeständnissen beim institutionellen Rahmenabkommen bereit. Nun sucht der Bundesrat Ausstiegsszenarien aus dem vertrackten Dossier. Denn was jetzt auf dem Tisch liegt, ist nicht mehrheitsfähig. Von der SVP wird der vorliegende Entwurf integral bekämpft. Von links schiessen die Gewerkschaften scharf gegen das Abkommen und fordern einen griffigen Lohnschutz für Schweizer Arbeitnehmer.
Warum Sie das wissen müssen: Das Rahmenabkommen ist das wichtigste Dossier in der Beziehung der Schweiz zur EU. Doch ohne Präzisierungen beim Lohnschutz, den sogenannten Staatshilfen sowie einer ausdrücklichen Ausschliessung der Unionsbürgerrichtlinie werden weder der Bundesrat noch das Parlament Ja dazu sagen. Die Schweiz möchte sichergehen, dass EU-Bürgerinnen nach einem Stellenverlust nicht ohne weiteres Sozialhilfe beziehen können. Und sie fürchtet, dass Ausschaffungen von kriminellen Ausländern schwieriger würden. Doch dafür hat Brüssel kein Gehör. Auch beim Lohnschutz ist die EU hart geblieben. So ist man weit davon entfernt, dass die Schweiz Elemente ihres Lohnschutzgesetzes – wie etwa die flankierenden Massnahmen – selbst gestalten könnte.
Wie es weitergeht: Die eine Seite macht nur mit, wenn die andere etwas nachgibt. Doch diese bewegt sich kein bisschen. Wie also aus dem Dilemma finden? Entweder die Übung abbrechen – oder alles aufschieben. Sicher ist: Ohne Zugeständnisse der EU wird das Rahmenabkommen in der Schweiz beerdigt.
Rücktritt der Woche
Zehn Jahre lang sass die Waadtländerin Isabelle Chevalley im Nationalrat – und war immer mal wieder für eine Schlagzeile gut. So veranstaltete die GLP-Politikerin im Bundeshaus einen denkwürdigen Würmer-Apéro, um für den Verzehr von Insekten zu werben. Zuletzt sorgte sie als Gegnerin der Konzernverantwortungsinitiative für Aufsehen: Chevalley liess den Handelsminister von Burkina Faso in die Schweiz einfliegen, um gegen die Initiative Stimmung zu machen. Chevalley besitzt nämlich einen Diplomatenpass des Landes und ist offizielle Beraterin des Präsidenten. Mehrmals pro Jahr reist sie ins westafrikanische Land und lässt sich dort gerne für Wahlkampfauftritte einspannen. Dafür wird sie in Zukunft viel Zeit haben: Chevalley tritt aus dem Nationalrat zurück. «In der Politik braucht es zwei Qualitäten: Geduld und Durchhaltewillen», sagt sie, «Die Geduld habe ich verloren.» Mit ihrem Rücktritt erübrigt sich auch der Entscheid des Büros des Nationalrats, welches derzeit berät, ob eine amtierende Nationalrätin mit einem ausländischen Diplomatenpass herumreisen darf. Als Alt-Nationalrätin darf Chevalley das auch in Zukunft, was ihr entgegenkommt. Denn sie fühle sich in ihrer «Wahlheimat» Burkina Faso mehr zu Hause als in der Schweizer Kultur. Laut einer afrikanischen Freundin hat sie gar «weisse Haut, aber ein schwarzes Herz».
Illustration: Till Lauer