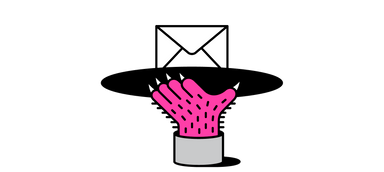
Stimmrechtsalter 16 rückt näher, neue Impfdosen bestellt – und wieder kein Geld fürs Pflegepersonal
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (133).
Von Elia Blülle, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine und Cinzia Venafro, 04.02.2021
Vor lauter Nachrichten den Überblick verloren? Jeden Donnerstag fassen wir für Sie das Wichtigste aus Parlament, Regierung und Verwaltung zusammen.
Kommen Sie an Bord, und abonnieren Sie unser wöchentliches «Briefing aus Bern»!
Plötzlich steht er wieder im Rampenlicht: Aussenminister Ignazio Cassis, im Jahr 2020 weitgehend abgetaucht, äussert sich dieser Tage auf allen Kanälen.
Erst beantwortete er in einem Interview die Frage, wie er als einziger Arzt in der Regierung die Corona-Krise erlebt, dann nahm er Stellung zur Verhaftung einer Schweizer TV-Korrespondentin in Belarus (dazu später mehr in diesem Briefing). Am Mittwoch verabschiedete der Gesamtbundesrat den von Cassis vorgelegten Aussenpolitischen Bericht zum abgelaufenen Jahr und nutzte die Gelegenheit zur Bekräftigung seines europapolitischen Ziels: des Abschlusses eines institutionellen Abkommens mit der EU. Eines Abkommens notabene, das inzwischen selbst bei Vertretern von Cassis’ FDP in die Kritik geraten ist.
Für die grössten Schlagzeilen sorgte Cassis in den letzten Tagen aber mit seiner Chinastrategie, die er vergangene Woche in die verwaltungsinterne Konsultation gab. Gleich zu Beginn werde darin die Menschenrechtslage in China kritisiert, berichtete die «NZZ am Sonntag»: «Autoritäre Tendenzen haben in den letzten Jahren zugenommen, ebenso wie die Repression gegen Andersdenkende und die Verfolgung von Minderheiten.»
Die neue Strategie begründet eine Abkehr vom über Jahrzehnte verfolgten Prinzip «Wandel durch Handel», also der Hoffnung, dass die marktwirtschaftliche Öffnung auch eine politische Liberalisierung mit sich bringen werde. «Weder Handel noch Internet haben zu einem entsprechenden Wandel Chinas geführt», heisst es im Papier des Aussendepartements. «China wurde wohlhabender, aber nicht freier.» Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutze das Land vor allem zur «sozialen Disziplinierung».
Infrage gestellt scheint angesichts dieser klaren Worte das Fortbestehen des Menschenrechtsdialogs, den der Bundesrat seit 30 Jahren mit Peking führt. Allerdings liegt dieser zurzeit ohnehin auf Eis: Seit zweieinhalb Jahren fand kein Treffen mehr statt.
Cassis’ dezidierte Chinakritik erstaunt, wenn man sich daran erinnert, dass er sich seit seinem Amtsantritt 2017 weniger deutlich für Menschenrechte und rechtsstaatliche Prinzipien engagierte als seine Vorgänger im Aussendepartement EDA; allerdings liegt sie auf der Linie der letzten US-Regierung von Donald Trump und dessen Aussenminister Mike Pompeo, zu dem Cassis ein gutes Verhältnis nachgesagt wird.
Vor einem guten Jahr berichtete die Republik in einem Porträt mit dem Titel «Die Schadensbilanz» ausführlich darüber, wie Cassis gemeinsam mit seinem Generalsekretär Markus Seiler die Schweizer Aussenpolitik umkrempelt. Am vergangenen Freitag bestätigte die Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» die damaligen Recherchen – und schrieb sie bis in die Gegenwart fort. Noch immer interessiere sich der Tessiner Bundesrat eher wenig für internationale Fragen, heisst es im mehrseitigen Artikel. Und er informiere sich schlecht. So habe er etwa während einer Dinnerparty seinen Tischnachbarn nach dem genauen Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten gefragt.
Damit zum Briefing aus Bern.
Covid-19: Neue Impfdosen für die Schweiz und keine Lockerungen im Februar
Worum es geht: Gestern Mittwoch hat sich der Bund weitere 17 Millionen Impfdosen bei drei weiteren Herstellern für die Schweiz gesichert. Zudem übernimmt er neu auch die Kosten für die Impfung von Personen, die nicht obligatorisch krankenversichert sind, aber in der Schweiz leben – wie etwa Diplomatinnen. Auch für Grenzgänger, die in Schweizer Gesundheitseinrichtungen arbeiten, soll die Impfung künftig kostenlos sein.
Warum Sie das wissen müssen: Bundesrat Alain Berset wollte ursprünglich, dass die Kantone bis Ende Februar allen über 75-Jährigen einen Impftermin anbieten können. Am Dienstag sagte nun der Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), Michael Jordi, dass die Schweiz bis weit in den Februar hinter den Impfzielen des Bundes bleiben werde. Engpässe verzögern die geplante Durchimpfung. Mit den neuen Dosen soll das Programm nun wieder auf Kurs gebracht werden.
Wie es weitergeht: Sofern die klinischen Testphasen und die Zulassung erfolgreich verlaufen, sollen die neuen Impfstoffe so bald wie möglich zum Einsatz kommen. Ferner hat der Bundesrat gestern mitgeteilt, dass er erst in zwei Wochen entscheiden werde, wie es ab März weitergeht. Das heisst, für den Februar sind trotz sinkender Infektionszahlen keine Lockerungen der gegenwärtigen Massnahmen geplant.
Uno-Migrationspakt: Bundesrat nimmt neuen Anlauf
Worum es geht: Der Bundesrat will nun doch dem Uno-Migrationspakt beitreten. Er hat am Mittwoch eine entsprechende Botschaft verabschiedet. Darin heisst es: «Die Zielsetzungen des Migrationspakts stimmen mit den Schwerpunkten der Schweizer Migrationspolitik überein.» Und: «Durch die Zustimmung zum Uno-Migrationspakt würden für die Schweiz weder ein innenpolitischer Handlungsbedarf noch neue finanzielle Verpflichtungen oder Aufgaben entstehen.»
Warum Sie das wissen müssen: Der Uno-Migrationspakt ist hochumstritten und wird von rechter Seite bekämpft. Der Bundesrat hält dazu fest: «Ziel des Uno-Migrationspakts ist es, mittels gemeinsam getragener Prinzipien und Zielsetzungen die weltweite Migration künftig sicherer und geordneter zu steuern und irreguläre Migration zu verringern.» Analysen des Migrationspakts zeigten, dass dieser mit der geltenden Schweizer Rechtsordnung und Praxis kompatibel sei. Klar ist: Als sogenanntes Soft-Law-Instrument ist der Migrationspakt rechtlich nicht verbindlich. Er ist eine Verhaltensvorgabe, mit der die Staatengemeinschaft ihre Bereitschaft unterstreicht, mit grenzüberschreitender Migration nach gemeinsamen Grundsätzen umzugehen.
Wie es weitergeht: Als Nächstes wird im Parlament über den Migrationspakt gestritten – Grundlage hierfür wird die Botschaft des Bundesrats sein. Doch ob die Mitte-rechts-Mehrheit dem Pakt zustimmt, ist fraglich.
Belarus: EDA verurteilt Festnahme von SRF-Journalistin
Worum es geht: Am Montag hat das Aussendepartement den belarussischen Botschafter einbestellt und dabei die Festnahme der Schweizer Journalistin Luzia Tschirky verurteilt sowie die Freilassung aller willkürlich inhaftierten Personen gefordert. Am Sonntag hielten belarussische Behörden die SRF-Korrespondentin während mehrerer Stunden auf einer Polizeistation fest, nachdem Tschirky sowie ihre Bekannte und deren Mann auf offener Strasse von drei maskierten Polizisten in einen Minibus gezerrt worden waren.
Warum Sie das wissen müssen: Seit Monaten demonstrieren in Belarus Hunderttausende gegen den Diktator Alexander Lukaschenko, der die Proteste mit Gewalt niederschlagen lässt. Journalistinnen und Aktivisten werden willkürlich verhaftet und inhaftiert. Tschirky ist nicht die erste Schweizerin, die von belarussischen Behörden verschleppt wurde. Bereits im Dezember hat ein Gericht in Minsk die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin Natallia Hersche wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsgewalt in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Strafkolonie verurteilt. Das belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern schwer. In einem Interview rät Bundesrat Ignazio Cassis allen Schweizerinnen mit Funktionen, welche die Regierung stören könnten, vorsichtig zu sein. Eine eindeutige Infragestellung der belarussischen Rechtsstaatlichkeit ist den Aussagen von Cassis nicht zu entnehmen.
Wie es weitergeht: Die Journalistin Luzia Tschirky wurde nach ihrer kurzzeitigen Festnahme wieder freigelassen. Ihre belarussischen Bekannten hingegen hat das Gericht wegen Teilnahme an einer Massendemonstration zu Arrest verurteilt: 20 Tage erhielt die Bekannte, 25 Tage ihr Mann. Noch im Februar soll Hersches Fall vor der zweiten Gerichtsinstanz verhandelt werden. Laut Cassis ist die Schweiz auf allen Hierarchiestufen aktiv, damit Hersche möglichst rasch freikommt.
Ständeratskommission sagt Ja zum Stimmrechtsalter 16
Worum es geht: Das aktive Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige könnte in der Schweiz Realität werden. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats hat sich dafür ausgesprochen, nachdem der Nationalrat bereits letzten Herbst Ja gesagt hatte. Grüne, SP, GLP und Mitglieder der FDP und der Mittefraktion sorgen für die Mehrheit.
Warum Sie das wissen müssen: Das Stimmrechtsalter 16 fördert und stärkt die politische Partizipation von jungen Menschen. Das zeigen Erfahrungen aus Österreich und dem Kanton Glarus, der als einziger Kanton das Stimmrechtsalter auf kantonaler Ebene bereits 2007 auf 16 Jahre gesenkt hat. Obwohl die Wirkung einer Senkung des Stimmrechtsalters weitgehend unbestritten ist, machen die Gegner vor allem staatspolitische Gründe für ihre Opposition geltend. So findet es etwa FDP-Ständerat Andrea Caroni stossend, dass mit der neuen Regelung 16-Jährige abstimmen könnten, aber noch keine vollständige Mündigkeit besässen. Er sagt deshalb: «Wenn schon, müsste man über ein allgemeines Mündigkeitsalter 16 diskutieren.»
Wie es weitergeht: Die Nationalratskommission wird nun einen Entwurf ausarbeiten, um Artikel 136 der Bundesverfassung zu ändern. Konkret soll neu stehen: «Alle Schweizerinnen und Schweizer, die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht entmündigt sind, haben das aktive Wahl- und Stimmrecht.» Die grosse Hürde für das Stimmrechtsalter 16 ist dann das Ständemehr: Denn für eine Verfassungsänderung braucht es eine Volksabstimmung und ein Ja von Volk und Ständen.
Sexualstrafrecht: Neuer Straftatbestand, aber keine Zustimmungslösung
Worum es geht: Die Rechtskommission des Ständerats will mit dem «sexuellen Übergriff» einen neuen Straftatbestand schaffen. Damit will sie sicherstellen, dass sexuelle Handlungen gegen den Willen der Opfer auch dann gebührend bestraft werden können, wenn es nicht zu Gewalt oder Drohungen kam. Nicht vorgesehen ist im Revisionsvorschlag eine Zustimmungslösung («Ja heisst Ja»), wie sie etwa in Schweden seit 2018 gilt. Des Weiteren soll mit der Revision neu auch das Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern – zum Beispiel im Netz – mit Strafe belegt werden.
Warum Sie das wissen müssen: Nach dem derzeitigen Schweizer Strafrecht handelt es sich bei sexueller Gewalt nur dann um eine Vergewaltigung, wenn der Täter sein Opfer bedroht, Gewalt anwendet, es unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht. Liegt kein solches sogenanntes Nötigungsmittel vor, gilt die Tat in der Schweiz nicht als schweres Delikt – auch wenn das Opfer Nein gesagt hat. Dann kommt nur der Tatbestand der sexuellen Belästigung infrage, der nur auf Antrag verfolgt wird. Die Istanbul-Konvention, der sich die Schweiz angeschlossen hat, sieht vor, dass die fehlende Einwilligung im Mittelpunkt jeder rechtlichen Definition von Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt steht. Darum zeigen sich diverse Frauen- und Menschenrechtsorganisationen enttäuscht, dass die Zustimmungslösung mit dem Revisionsvorschlag nicht zur Diskussion gestellt wird.
Wie es weitergeht: Die Vorschläge der Kommission gehen jetzt in die Vernehmlassung, wo sich Kantone, Verbände, die Wirtschaft und andere interessierte Organisationen oder Personen dazu äussern dürfen. Dann muss sich das Parlament damit beschäftigen.
Lehrabschluss: Kommission ist gegen Kulanz für Asylbewerber
Worum es geht: Der Nationalrat hat sich Ende 2020 dafür ausgesprochen, dass Asylbewerber ihre angefangene Lehre beenden dürfen, auch wenn sie einen negativen Asylentscheid erhalten haben. Die zuständige ständerätliche Kommission empfiehlt ihrem Rat nun, auf eine solche Ausnahmeregelung zu verzichten.
Warum Sie das wissen müssen: Immer wieder kommt es auf lokaler Ebene zu Protesten, wenn Asylbewerber ausgewiesen werden, obwohl sie mitten in einer Lehre oder Ausbildung stehen – schliesslich handelt es sich meist um gut integrierte Personen. Entsprechend haben sich in der Vergangenheit auch oft Lehrmeister und Gewerblerinnen für eine Anpassung im Asylrecht starkgemacht. Wie viele Asylsuchende durch negative Asylentscheide zum Lehrabbruch gezwungen werden, ist unklar; allein im Kanton Bern geht man jedoch von 60 bis 100 Personen pro Jahr aus. Im Nationalrat feierten die Befürworterinnen einer Neuregelung im Dezember einen Erfolg. Eine Gesetzesänderung aber gibt es nur, wenn im März auch der Ständerat zustimmt. Diese Woche hat jedoch seine Staatspolitische Kommission Nein gesagt. Sie folgt damit dem Bundesrat, der festhält, eine glaubwürdige und konsequente Asylpolitik setze voraus, dass abgewiesene Asylsuchende die Schweiz auch tatsächlich wieder verlassen. Anzumerken ist, dass es in Zukunft bedeutend seltener zu erzwungenen Lehrabbrüchen kommen sollte. Dies, weil das seit rund zwei Jahren geltende sogenannte «beschleunigte Asylverfahren» garantieren soll, dass innert 140 Tagen ein rechtskräftiger Asylentscheid vorliegt – bevor Asylsuchende überhaupt die Chance haben, eine Ausbildung oder Lehre zu beginnen.
Wie es weitergeht: Der Ständerat entscheidet im März über die Motion. Sagt er Nein, ist das Anliegen vom Tisch.
Entscheid der Woche
Wenn eine Pflegefachfrau für jedes Lob einen Franken bekäme, sie wäre wohl stinkreich. Doch dass man sich von Applaus nichts kaufen kann, mussten die Männer und Frauen an der Pflegefront gerade während der Pandemie schmerzlich erfahren. Womit sie sich jedoch sehr wohl etwas kaufen könnten: Geld, das sie bekommen für Zeit, die sie an ihrem Arbeitsplatz verbringen müssen. Beispielsweise Zeit, in der sie sich – wie vom Arbeitgeber vorgeschrieben – vor Ort umziehen. Für das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist klar, dass die Umkleidezeit als Arbeitszeit anzurechnen ist, wenn das Umziehen für die Tätigkeit notwendig ist. In seiner 2019 präzisierten Wegleitung zum Arbeitsgesetz lässt es keinen Zweifel daran, dass beispielsweise das «Anziehen von Überzugskleidern oder steriler Arbeitskleidung» als Arbeitszeit gilt. Weil diverse Arbeitgeber im Gesundheitsbereich trotzdem nicht bezahlen wollen, kam es vielerorts zu Gerichtsfällen. Einer davon wurde nun in letzter Instanz entschieden: Das Bundesgericht hat die Beschwerde von Angestellten des Spitals Limmattal abgewiesen, die für die Umkleidezeit der letzten fünf Jahre entschädigt werden wollten (was rund 16’000 Franken pro Kopf bedeutet hätte). Das Bundesgericht hält in seinem Entscheid die bisher gelebte Praxis zwar für «fraglich», will den Entscheid der Vorinstanz aber trotzdem nicht aufheben. Wir applaudieren mal.
Illustration: Till Lauer