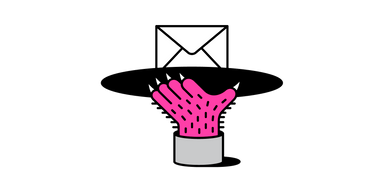
Endlich Ehe für alle, traurige Nachrichten für Gewerbler und lustige Musikanten im Bundeshaus
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (126).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 03.12.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
«Und sie bewegt sich doch – die Welt im Ständerat», jubelte GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Nach sieben Jahren – ja, Sie haben richtig gelesen – nach sieben Jahren parlamentarischer Debatte, Störmanövern und einem Pingpong zwischen National- und Ständerat wird die Ehe für alle in der Schweiz Realität.
Mit knappen 22 zu 20 Stimmen hat die kleine Kammer am Dienstag entschieden, dass es keine Verfassungsänderung braucht, um die gesellschaftspolitisch wichtigste Vorlage des Jahres abzuschliessen. Doch fast hätte die Vorlage abermals eine Extrarunde gedreht. Auch wenn CVP-Ständerätinnen wie Heidi Z’graggen sich persönlich die Ehe für alle wünschen, «und zwar rasch», wie sie betonte, müsse dies über eine Verfassungsänderung geschehen. Eingeflüstert hatte das der ehemaligen Bundesratskandidatin die konservative Juristin Isabelle Häner mit einem Geheimgutachten.
Zur Erinnerung: Bei einer Verfassungsänderung braucht es eine obligatorische Volksabstimmung und somit das Ja von Volk und Kantonen. Das Ständemehr kann für progressive Vorlagen zum Stolperstein werden, so wie letzten Sonntag für die Konzernverantwortungsinitiative (mehr dazu weiter unten).
Im Stöckli kam es also zum Streit der Verfassungsrechtlerinnen – und zum Schlagabtausch zwischen konservativen CVPlern wie Beat Rieder und FDP-Mann Andrea Caroni, der für die Einführung der Ehe für alle auf Gesetzesstufe plädierte. Im Vergleich zur Revision des Eherechts Anfang der Achtzigerjahre sei die Einführung der Ehe für alle eine «Pinselrenovation», sagte der Harvard-Jurist Caroni. Damals sei den Männern mit dem Patriarchat etwas weggenommen worden – und selbst dies sei auf Gesetzesstufe geschehen.
Den Männern sei sicher nichts weggenommen worden, entgegnete Justizministerin Karin Keller-Sutter schmunzelnd. Zudem sei es egal, was man sich einst unter einer Ehe vorgestellt habe, betonte Keller-Sutter: «Der Gesetzgeber ist vor hundert Jahren auch nicht auf die Idee gekommen, dass der Mann nicht das Oberhaupt der Familie ist.»
Am Ende spielte der Freisinn das Zünglein an der Waage: Weil er sich mehrheitlich gegen den Verfassungsweg aussprach und die beiden Innerschweizer Hans Wicki und Josef Dittli sich der Stimme enthielten, unterlagen die CVP und die SVP.
Grünes Licht gab der Ständerat auch für die Samenspende für lesbische Paare. Anders als der Nationalrat es will, soll dies aber nur über eine Schweizer Samenbank legal sein.
Jetzt geht das Geschäft zur Differenzbereinigung zurück in den Nationalrat, noch diese Session will man das Geschäft abschliessen. Im Nationalrat wird die Ehe-für-alle-Lobby für den uneingeschränkten Zugang zur Reproduktionsmedizin für Lesben kämpfen. Oder wie SP-Frau Tamara Funiciello es ausdrückt: «Lesbische Frauen werden mit der Ständeratslösung nicht gleichgestellt. Der Teufel steckt im Detail. Details sind in der Schweizer Politik meist Frauen.»
Am Mittwochnachmittag kündigte die EDU an, zusammen mit verbündeten Kräften das Referendum zu ergreifen.
Und damit zum Briefing aus Bern.
Abstimmungen: Pyrrhussieg und Ständemehr-Diskussion
Worum es geht: Beide Volksinitiativen, die am Sonntag zur Abstimmung standen, wurden abgelehnt. Während die Kriegsgeschäfteinitiative auf 42,5 Prozent Zustimmung stiess, wurde die Konzernverantwortungsinitiative von 50,7 Prozent der Abstimmenden angenommen, scheiterte jedoch am Ständemehr.
Warum Sie das wissen müssen: Die Stimmbevölkerung sagt Ja, die Stände sagen Nein – einen solchen Ausgang nahm eine Volksinitiative zuvor erst ein einziges Mal: als es 1955 um den «Schutz der Mieter und Konsumenten» ging. Nachdem die ländlichen Kantone der Deutschschweiz am Sonntag den Ausschlag gegen die Konzern-Initiative gegeben hatten, ist eine Diskussion über Sinn und Unsinn des Ständemehrs entbrannt. Juso-Präsidentin Ronja Jansen plädiert für die Abschaffung; Grünen-Präsident Balthasar Glättli schlägt dem Parlament vor, dass ein Volksmehr künftig nicht mehr von einer einfachen Mehrheit der Stände, sondern bloss von zwei Dritteln von ihnen gekippt werden kann; FDP-Ständerat Andrea Caroni hingegen wollte das Ständemehr schon vor einem Monat ausbauen.
Wie es weitergeht: Nach der Ablehnung der Konzern-Initiative tritt der Gegenvorschlag in Kraft, auf den sich das Parlament im Sommer geeinigt hatte. Warum die Wirtschaftsverbände und die federführende Bundesrätin Karin Keller-Sutter damit einen Pyrrhussieg feierten, lesen Sie im Kommentar von Daniel Binswanger. Im Themenfeld der Kriegsgeschäfteinitiative kommt es bald zu einer nächsten Abstimmung: Im Sommer 2019 ist die Korrektur-Initiative zustande gekommen, die Waffenexporte in Länder einschränken will, die in Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Vor eineinhalb Monaten beschloss der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag; kürzlich wurde publik, dass ausgerechnet Verteidigungsministerin Viola Amherd den Initianten noch weiter hatte entgegenkommen wollen. Das Parlament berät 2021 über die Korrektur-Initiative.
Kein Corona-Mieterlass für Gewerbler
Worum es geht: Es ist ein herber Dämpfer für Ladenbesitzerinnen, Clubbetreiber und viele weitere Gewerbler. Die Mitte-rechts-Mehrheit im National- und im Ständerat hat das Covid-19-Geschäftsmietengesetz bachab geschickt. Die grosse Kammer wollte mit 100 zu 87 Stimmen nicht, dass Mietern für die Zeit des pandemiebedingten Lockdowns ein Teil ihrer Miete erlassen wird. Und auch der Ständerat sprach sich am Mittwoch mit 30 zu 14 Stimmen dagegen aus.
Warum Sie das wissen müssen: Noch im Sommer schien im Parlament der Weg frei für einen Corona-Mieterlass. Doch weil unter anderem ein Teil der GLP mit den Bürgerlichen stimmte, müssen Mieter und Vermieter nun selbst Lösungen finden. SP-Ständerat Christian Levrat, frisch aus der Quarantäne zurück, ärgerte sich: «Es ist ein unglaubliches Zeichen der Schwäche unseres Parlaments, dass wir es nach neun Monaten nicht schaffen, eine Lösung für Gewerbetreibende zu finden.» SVP-Bundesrat Guy Parmelin hatte den Mieterlass nur widerwillig aufgegleist und freute sich gestern über das definitive Nein: «Die Vorlage widerspricht der Wirtschaftsfreiheit und führt zu einer Verzerrung der Konkurrenz.»
Wie es weitergeht: Nun wird wohl vermehrt auf Kantonsebene über Mietzinsreduktionen diskutiert. In Baselland zum Beispiel beschloss das Stimmvolk letzten Sonntag, dass der Kanton ein Drittel der geschuldeten Geschäftsmieten von April bis Juni 2020 übernimmt, sofern der Vermieter auf ein Drittel des Mietzinses verzichtet. Ein ähnliches Modell hatte das basel-städtische Parlament schon im Mai beschlossen.
Krankenkassen zahlen für frühe Fehlgeburten
Worum es geht: Jährlich erleiden in der Schweiz 20’000 Frauen eine Fehlgeburt. Je nach Zählart endet jede dritte bis fünfte Schwangerschaft in einem persönlichen Drama. Bisher galten Frauen in der Schweiz aber erst ab der 13. Woche als «schwanger», kam es zuvor zu Komplikationen oder einem Frühabort, waren sie rechtlich betrachtet also «krank». Konsequenz: Zur seelischen Belastung durch eine Fehlgeburt gab es obendrauf eine Rechnung der Krankenkasse. Der Ständerat will das nun wie auch der Nationalrat ändern.
Warum Sie das wissen müssen: Frauen sind künftig ab dem ersten Schwangerschaftstag kostenbefreit. Dafür gekämpft hatte die Grünen-Nationalrätin Irène Kälin. Auch der erzkonservative SVP-Mann Jean-Luc Addor hatte eine gleichlautende Motion eingereicht – so kam es zu einer Allianz zwischen Links und Rechts.
Wie es weitergeht: Ab wann das Gesetz eingeführt wird, ist noch nicht definiert.
Transmenschen: Änderung von Namen und Geschlecht wird einfacher
Worum es geht: Menschen mit Transidentität und Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung sollen künftig ihr Geschlecht und ihren Vornamen auf dem Zivilstandsamt unbürokratisch ändern können. Uneinig ist sich die Politik noch, ob Minderjährige dafür die Zustimmung ihrer Eltern einholen müssen. Der Bundesrat will es so (worin das Transgender Network Switzerland einen Rückschritt sieht), der Nationalrat nicht – und der Ständerat hat sich für einen Mittelweg entschieden: Minderjährige ab 16 Jahren sollen selbstständig handeln können.
Warum Sie das wissen müssen: Bis vor wenigen Jahren mussten Menschen, die ihren Geschlechtseintrag ändern wollten, sehr hohe Hürden überwinden. Erlaubt war ihnen das nämlich nur, wenn sie sich chirurgisch sterilisieren liessen; diese Praxis hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im April 2017 verboten. Mit der nun geplanten Änderung des Zivilgesetzbuches werden Personen, die innerlich fest davon überzeugt sind, das Geschlecht und den Vornamen wechseln zu wollen, beim Zivilstandsamt eine Änderung des Eintrags bewirken können, indem sie dort persönlich vorsprechen.
Wie es weitergeht: Die Vorlage geht zurück an den Nationalrat. Im September hat er sich dafür ausgesprochen, dass alle urteilsfähigen Minderjährigen – auch unter 16-Jährige – ihr Geschlecht und ihren Namen ändern können. Sobald sich die beiden Parlamentskammern in dieser Frage einig sind, ist das Geschäft bereit für die Schlussabstimmung. Wird dagegen kein Referendum ergriffen, tritt es in Kraft.
Fair-Preis-Initiative: Auch der Ständerat will einen Gegenvorschlag
Worum es geht: Der Ständerat lehnt die Initiative «Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise» ab. Er will ihr aber genauso wie der Bundesrat und der Nationalrat einen indirekten Gegenvorschlag entgegenstellen, der Verschärfungen im Kartellrecht beinhaltet. Der Gegenvorschlag träte in Kraft, falls die Initiantinnen ihre Initiative zurückzögen oder wenn die Initiative an der Urne scheitern sollte.
Warum Sie das wissen müssen: Das Ziel der Fair-Preis-Initiative ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen zu stärken, indem ihre Beschaffungsfreiheit im In- und Ausland gewährleistet wird. Indirekt sollen so die Preise für importierte Waren und Dienstleistungen gesenkt werden. Getragen wird die Initiative von der Stiftung für Konsumentenschutz, Gastrosuisse und dem Wirtschaftsverband Swissmechanic, der 1400 KMU in der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche vereint. Der Gegenvorschlag nimmt neben marktbeherrschenden auch relativ marktmächtige Unternehmen verstärkt in die Pflicht. Gemeint sind Unternehmen, von denen andere mangels Alternative faktisch abhängig sind. Eine von FDP-Ständerat Ruedi Noser angeführte und vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse unterstützte Minderheit der ständerätlichen Wirtschaftskommission hatte nicht auf den Gegenvorschlag eintreten wollen, unterlag aber.
Wie es weitergeht: Noch gibt es einige wenige Differenzen zwischen den Räten. So stellt sich der Ständerat etwa gegen eine Re-Importklausel, die der Nationalrat in den Gegenvorschlag eingefügt hat. Die Klausel soll verhindern, dass günstig ins Ausland gelieferte Produkte zum tieferen Preis in die Schweiz zurückimportiert werden. Der Nationalrat wird deshalb noch einmal über den Gegenvorschlag beraten.
Ständchen der Woche
Politik ist harte Arbeit. Und wer hart arbeitet, darf sich zwischendurch auch eine kleine Freude gönnen. Also wurde die Wahl des Schwyzers Alex Kuprecht zum Ständeratspräsidenten am Montag mit Musik gefeiert. Der beliebte Volksmusiker Carlo Brunner spielte mit seiner Länderkapelle ein paar lüpfige Lieder, ein Video davon landete auf Twitter, und dort brach sogleich der Shitstorm los. So enervierte sich der Virologe Christian Althaus, Mitglied der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes: «Das Land, welches bald 5000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen hat, feiert munter weiter. Und zwar mit Blasmusik.»
Im Parlament stiess Althaus’ Kritik auf taube Ohren. Denn schon am anderen Tag erklang im Bundeshaus bereits wieder Musik, wenn auch ohne Blasinstrumente. Dafür sang der Nationalrat Ueli Maurer ein Ständchen zum Siebzigsten. Auch Ballons mit Schweizer Wappen gabs für das magistrale Geburtstagskind, es war schön wie ein Kindergeburtstag. Weniger schön fielen aber auch hier die Reaktionen aus. So kommentierte ein Lehrer auf Twitter: «Kinder dürfen nicht mehr in den Gesangsunterricht. Aber im Bundeshaus kann man locker singen.»
Wir ersparen uns und Ihnen weitere Kommentare und verweisen stattdessen auf das Bundesamt für Gesundheit, das in seinen Tipps für die Festtage schreibt: «Gemeinsames Singen und das Spielen von Blasinstrumenten können das Ansteckungsrisiko erhöhen. Hören Sie besser Weihnachtslieder auf Ihrer Musikanlage.» Von Carlo Brunner zum Beispiel gibt es ein Stück namens «Wiehnacht z Lache am See», gesungen von seiner Schwester Maja. Und Frau Brunners Gesang aus der Musikanlage ist nicht nur virensicher, er klingt auch besser als der von Tante Marlies oder irgendeinem Nationalrat.
Illustration: Till Lauer