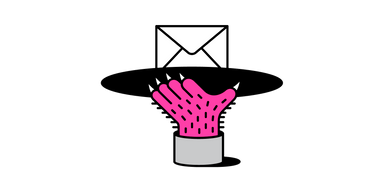
Kritik am Bund wegen Moria, Schweiz wird zu Corona-Risikogebiet – und das beste Geheimnis der Woche
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (115).
Von Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine, Carlos Hanimann und Cinzia Venafro, 17.09.2020
Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:
«Unsere Asylzentren sind halb leer», sagte Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried vor kurzem in der Republik. «Wir haben in der Schweiz heute die Kapazitäten, sofort 500 Menschen aus Moria aufzunehmen.»
Derweil warten die Menschen auf Moria immer noch auf Hilfe. Vor etwas mehr als einer Woche, in der Nacht auf den 9. September, brannte das aus Zelten und Wohncontainern bestehende Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland nieder. Die 13’000 Bewohnerinnen – ein knappes Drittel von ihnen Kinder – leben seither in noch grösserer Not als zuvor schon. Für Verzweiflung sorgt zudem das Coronavirus: In der ersten Septemberwoche hatten sich mindestens 35 Personen im Lager infiziert, von den meisten von ihnen fehlt inzwischen jede Spur. Die Behörden befürchten, das Virus könnte angesichts der prekären Bedingungen rasend schnell um sich greifen. Oder hat das bereits getan.
Doch Europa tut sich schwer damit, den Bewohnern des Lagers rasch und unbürokratisch zu helfen. Auch die Schweiz verhält sich passiv. Dafür wird sie unter anderem von der Uno kritisiert.
Vergangene Woche forderten bei einer Demonstration in Bern zudem rund 300 Personen die sofortige Evakuierung der Geflüchteten aus Lesbos. Zum Thema wurde Moria aber auch im Bundeshaus: Mehrere Politikerinnen von SP und Grünen reichten in den letzten Tagen Vorstösse ein, in denen sie dem Bundesrat unbequeme Fragen stellen – die mit Standardformulierungen beantwortet werden. Man sei «besorgt über die Entwicklungen», man «verfolgt die Situation laufend», die «betroffenen Departemente stimmen sich eng ab».
Ungehört verhallten nicht nur die Aufrufe der Parlamentarier, sondern auch die Appelle der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Ebenso wenig Gehör schenkt der Bundesrat bis anhin den acht grössten Schweizer Städten, die sich schon vor Monaten bereit erklärt hatten, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen und im Juni den Appell «Evakuieren jetzt!» unterzeichnet hatten.
Doch die Justizministerin Karin Keller-Sutter will davon nichts wissen. «Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage», sagte sie Ende letzte Woche. Für Asylverfahren sei der Bund zuständig. «Es ist nicht möglich, dass die Städte direkt Personen aufnehmen können.»
In den letzten Tagen verschärften die Stadtregierungen den Druck auf die Regierung: So forderte Zürich den Bund auf, umgehend eine nationale Konferenz zur Direktaufnahme von Flüchtlingen einzuberufen. Und Berns Stadtpräsident von Graffenried stellte sich im Republik-Interview an die Spitze der Unzufriedenen, als er die Justizministerin offen kritisierte: «Keller-Sutter handelt aus Angst, auf Ablehnung zu stossen in den Dörfern, welche die Flüchtlinge aufnehmen müssten. Ich erhoffe mir, dass sie mutig ist und sagt: Wir nehmen diese Leute auf und bringen sie in jene Städte und Gemeinden, wo diese Bereitschaft besteht.»
Und damit zum Briefing aus Bern.
Corona: Quarantäne für Rückkehrer aus Paris und Wien
Worum es geht: Der Bundesrat hat entschieden, Nachbarländer wie Frankreich oder Österreich nicht auf die Corona-Risiko-Liste zu setzen. Neu gelten aber für Rückkehrerinnen aus einzelnen Regionen wie Paris, der Côte d’Azur, Wien oder Korsika 10 Tage Quarantäne.
Warum Sie das wissen müssen: Schon früher haben sich Schweizer Grenzkantone dagegen gewehrt, dass Nachbarländer auf die Risikoliste kommen, weil sie auf die Grenzgänger angewiesen sind. Grenzgebiete sind nun auch ausdrücklich von der Quarantänepflicht ausgenommen. Bundesrat Berset argumentiert mit dem regen sozialen und kulturellen Austausch. Dies, obwohl auch dort der Grenzwert von 60 Neuansteckungen pro 100’000 Einwohnerinnen teilweise stark überschritten wird. Derweil ist die Schweiz nun selbst ein Risikogebiet, nachdem sie das Kriterium der 60 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner über 14 Tage erreicht hat. Trotzdem dürfen wir vorläufig weiterhin in unsere Nachbarländer reisen.
Wie es weitergeht: Komme es zum exponentiellen Anstieg in Grenzgebieten, werde man die Situation neu beurteilen, so Berset. Zudem wird die Quarantänepflicht für Rückkehrer nicht systematisch kontrolliert. Der Bund setzt auf Eigenverantwortung. Wer sich der Quarantäne widersetzt, dem droht eine Busse.
Pflegeinitiative: Das Parlament ist sich noch nicht einig
Worum es geht: Die Pflegeinitiative, die eine Stärkung des Pflegeberufs fordert, ist eingereicht und im Volk beliebt. Um diese zu bodigen, stellt das Parlament dem Begehren einen indirekten Gegenvorschlag entgegen. Noch streiten sich die beiden Kammern aber über die Details. Am Dienstag ging es unter anderem um die Frage, ob Pflegende Leistungen selbst abrechnen können. Der Nationalrat lehnt dies ab, nachdem sich der Ständerat zuvor dafür ausgesprochen hat.
Warum Sie das wissen müssen: Bereits im Jahr 2017, als die Initiative eingereicht wurde, fehlten 6000 Pflegefachpersonen, Anfang dieses Jahres hatte sich die Zahl auf 11’000 erhöht. Der Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner rechnet damit, dass in zehn Jahren 65’000 Fachkräfte fehlen werden, wenn sich nichts ändert. Die Gründe dafür: die Alterung der Gesellschaft, die vielen Berufsaussteigerinnen und der zu wenig zahlreiche Nachwuchs. Im Jahr von Corona ist die Initiative aktueller denn je.
Wie es weitergeht: Das Geschäft geht nun erst wieder in die ständerätliche Kommission – also die Gesetzeswerkstatt. Und dann frühestens in der Wintersession ins Stöckli. Sollten Stände- und Nationalrat sich dann noch immer nicht einig sein, kommt es zur Einigungskonferenz. Unklar ist derzeit auch, ob die Initianten ihr Begehren zurückziehen, wenn ein Gegenvorschlag zustande kommt – oder per Volksabstimmung aufs Ganze gehen.
Trinkwasser- und Pestizidinitiative: Ständerat wählt eigenen Weg
Worum es geht: Der Ständerat empfiehlt sowohl die Trinkwasser- als auch die Pestizidinitiative zur Ablehnung und folgt damit dem Bundes- und dem Nationalrat. Ein wenig will der Ständerat den Initianten aber entgegenkommen: Er plant, ihre Kernanliegen in einen eigenen Gesetzesvorschlag aufzunehmen. Allerdings handelt es sich um einen ziemlich zahnlosen Vorschlag – dem während der Ständeratsdebatte weitere Zähne gezogen wurden. Unter Federführung der CVP strich der Ständerat am Montag konkrete Zielvorgaben aus dem Gesetz, mit denen der Stickstoff- und der Phosphorüberschuss hätten gesenkt werden sollen.
Warum Sie das wissen müssen: Im August hatte die Wirtschaftskommission bereits entschieden, dem Ständerat die Sistierung des Reformpakets «Agrarpolitik ab 2022» zu beantragen – mit jener Vorlage hatte der Bundesrat der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative den Wind aus den Segeln nehmen wollen. Über die Sistierung der «AP 22+» berät der Ständerat im Dezember.
Wie es weitergeht: Nun geht der Gesetzesvorschlag an den Nationalrat. Unabhängig davon kommen im nächsten Jahr die beiden Volksinitiativen an die Urne. Kürzlich publik gewordene Zahlen zeigen, dass das Grundwasser in manchen Gemeinden stark mit Pestiziden belastet ist – teilweise wurden die gesetzlich zugelassenen Höchstwerte um ein Vielfaches überschritten.
Bundesstrafgericht: 50 Monate für «Emir von Winterthur»
Worum es geht: Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat am letzten Freitag zwei Anhänger der Terrormiliz IS verurteilt. Der Hauptangeklagte muss 50 Monate ins Gefängnis, der zweite Beschuldigte erhielt eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 40 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren.
Warum Sie das wissen müssen: Der Hauptangeklagte Sandro V. gilt als einer der wichtigsten Jihadisten der Schweiz. Die Staatsanwältin des Bundes, Juliette Noto, bezeichnete den 34-jährigen schweizerisch-italienischen Doppelbürger als «Leitwolf» der Winterthurer Islamistenszene, IS-Sympathisanten nannten ihn «Emir» von Winterthur. Er war bereits 2013 nach Syrien gereist, um sich islamistischen Gruppierungen anzuschliessen. In der Schweiz wurde er später eine zentrale Figur der Islamistenszene und rekrutierte im Rahmen der Koranverteilaktion «Lies!» und im Umfeld der Winterthurer An’Nur-Moschee mehrere junge Menschen für den IS und half ihnen dabei, nach Syrien zu reisen. Vor Gericht gab er an, sich selbst entradikalisiert zu haben, und zeigte sich reuig. Dem zweiten Beschuldigten waren neben IS-Propaganda sexuelle Handlungen mit einem Kind vorgeworfen worden. Das Gericht fand keine Beweise für die Vorwürfe und sprach den heute 36-jährigen Mann in diesem Punkt frei.
Wie es weitergeht: Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte von Sandro V. und seinem Mitangeklagten kündigten an, in Berufung zu gehen.
Nationalrat hat Herz für Mütter kranker Kinder
Worum es geht: Der Nationalrat will, dass Mütter einen verlängerten Mutterschaftsurlaub erhalten, sollte ihr Neugeborenes unmittelbar nach der Geburt länger als zwei Wochen im Spital bleiben müssen. Davon profitieren sollen jedoch nur Mütter, die nachweislich ins Erwerbsleben zurückkehren.
Warum Sie das wissen müssen: Die Mehrkosten würden zulasten der Erwerbsersatzordnung gehen. Aus diesem Grund beantragte die SVP Nichteintreten auf die Vorlage. Man könne den Frauen zumuten, dass sie sich selbst organisierten, so Therese Schläpfer (SVP/ZH). Viel wichtiger als Finanzhilfen sei nach der Geburt sowieso die Nähe der Mutter zum Kind.
Wie es weitergeht: Nun muss der Ständerat wieder debattieren. Er hatte sich zuvor, wie auch der Bundesrat, bereits für eine Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs ausgesprochen, will aber, dass dies erst nach drei Wochen Spitalaufenthalt möglich ist.
Geheimnis der Woche
Für Journalistinnen ist es manchmal äusserst schwierig, an Dokumente heranzukommen, die sie für ihre Recherchen brauchen. Verwaltungen blocken ab, verweigern, verzögern, verhindern. Das musste auch die «SonntagsZeitung» erfahren, als sie Einsicht in eine E-Mail des EU-Unterhändlers Roberto Balzaretti wollte. Via Öffentlichkeitsgesetz kam die Zeitung schliesslich an das Schreiben heran, doch hatte das Aussendepartement einen Satz geschwärzt, über den es partout keine Auskunft geben wollte. Damit wurde natürlich das Interesse der Journalisten nur noch grösser: Was konnte so geheim sein? Sprach sich Balzaretti etwa für einen EU-Beitritt aus? Doch was dann nach einer Intervention des Datenschutzbeauftragten ans Licht kam, war noch viel überraschender: Balzaretti hatte einem Arbeitskollegen geschrieben, er sei unterwegs nach Genf – an eine Tupperware-Party.
Illustration: Till Lauer